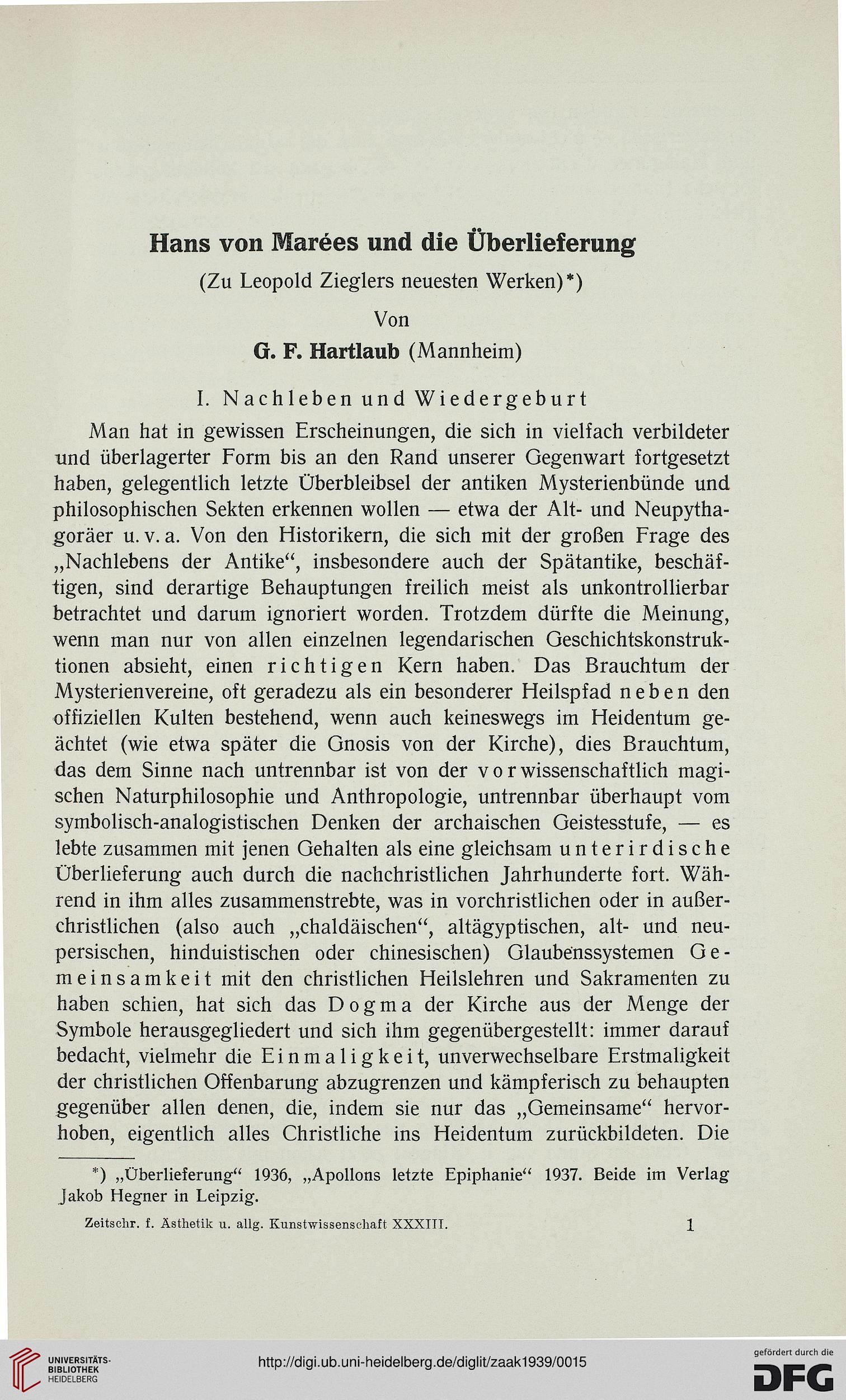Hans von Marees und die Überlieferung
(Zu Leopold Zieglers neuesten Werken)*)
Von
G. F. Hartlaub (Mannheim)
I. Nachleben und Wiedergeburt
Man hat in gewissen Erscheinungen, die sich in vielfach verbildeter
und überlagerter Form bis an den Rand unserer Gegenwart fortgesetzt
haben, gelegentlich letzte Überbleibsel der antiken Mysterienbünde und
philosophischen Sekten erkennen wollen — etwa der Alt- und Neupytha-
goräer u. v. a. Von den Historikern, die sich mit der großen Frage des
„Nachlebens der Antike", insbesondere auch der Spätantike, beschäf-
tigen, sind derartige Behauptungen freilich meist als unkontrollierbar
betrachtet und darum ignoriert worden. Trotzdem dürfte die Meinung,
wenn man nur von allen einzelnen legendarischen Geschichtskonstruk-
tionen absieht, einen richtigen Kern haben. Das Brauchtum der
Mysterienvereine, oft geradezu als ein besonderer Heilspfad neben den
offiziellen Kulten bestehend, wenn auch keineswegs im Heidentum ge-
ächtet (wie etwa später die Gnosis von der Kirche), dies Brauchtum,
das dem Sinne nach untrennbar ist von der v o r wissenschaftlich magi-
schen Naturphilosophie und Anthropologie, untrennbar überhaupt vom
symbolisch-analogistischen Denken der archaischen Geistesstufe, — es
lebte zusammen mit jenen Gehalten als eine gleichsam unterirdische
Überlieferung auch durch die nachchristlichen Jahrhunderte fort. Wäh-
rend in ihm alles zusammenstrebte, was in vorchristlichen oder in außer-
christlichen (also auch „chaldäischen", altägyptischen, alt- und neu-
persischen, hinduistischen oder chinesischen) Glaubenssystemen Ge-
meinsamkeit mit den christlichen Heilslehren und Sakramenten zu
haben schien, hat sich das Dogma der Kirche aus der Menge der
Symbole herausgegliedert und sich ihm gegenübergestellt: immer darauf
bedacht, vielmehr die Einmaligkeit, unverwechselbare Erstmaligkeit
der christlichen Offenbarung abzugrenzen und kämpferisch zu behaupten
gegenüber allen denen, die, indem sie nur das „Gemeinsame" hervor-
hoben, eigentlich alles Christliche ins Heidentum zurückbildeten. Die
*) „Überlieferung" 1936, „Apollons letzte Epiphanie" 1937. Beide im Verlag
Jakob Hegner in Leipzig.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 1
(Zu Leopold Zieglers neuesten Werken)*)
Von
G. F. Hartlaub (Mannheim)
I. Nachleben und Wiedergeburt
Man hat in gewissen Erscheinungen, die sich in vielfach verbildeter
und überlagerter Form bis an den Rand unserer Gegenwart fortgesetzt
haben, gelegentlich letzte Überbleibsel der antiken Mysterienbünde und
philosophischen Sekten erkennen wollen — etwa der Alt- und Neupytha-
goräer u. v. a. Von den Historikern, die sich mit der großen Frage des
„Nachlebens der Antike", insbesondere auch der Spätantike, beschäf-
tigen, sind derartige Behauptungen freilich meist als unkontrollierbar
betrachtet und darum ignoriert worden. Trotzdem dürfte die Meinung,
wenn man nur von allen einzelnen legendarischen Geschichtskonstruk-
tionen absieht, einen richtigen Kern haben. Das Brauchtum der
Mysterienvereine, oft geradezu als ein besonderer Heilspfad neben den
offiziellen Kulten bestehend, wenn auch keineswegs im Heidentum ge-
ächtet (wie etwa später die Gnosis von der Kirche), dies Brauchtum,
das dem Sinne nach untrennbar ist von der v o r wissenschaftlich magi-
schen Naturphilosophie und Anthropologie, untrennbar überhaupt vom
symbolisch-analogistischen Denken der archaischen Geistesstufe, — es
lebte zusammen mit jenen Gehalten als eine gleichsam unterirdische
Überlieferung auch durch die nachchristlichen Jahrhunderte fort. Wäh-
rend in ihm alles zusammenstrebte, was in vorchristlichen oder in außer-
christlichen (also auch „chaldäischen", altägyptischen, alt- und neu-
persischen, hinduistischen oder chinesischen) Glaubenssystemen Ge-
meinsamkeit mit den christlichen Heilslehren und Sakramenten zu
haben schien, hat sich das Dogma der Kirche aus der Menge der
Symbole herausgegliedert und sich ihm gegenübergestellt: immer darauf
bedacht, vielmehr die Einmaligkeit, unverwechselbare Erstmaligkeit
der christlichen Offenbarung abzugrenzen und kämpferisch zu behaupten
gegenüber allen denen, die, indem sie nur das „Gemeinsame" hervor-
hoben, eigentlich alles Christliche ins Heidentum zurückbildeten. Die
*) „Überlieferung" 1936, „Apollons letzte Epiphanie" 1937. Beide im Verlag
Jakob Hegner in Leipzig.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft XXXIII. 1