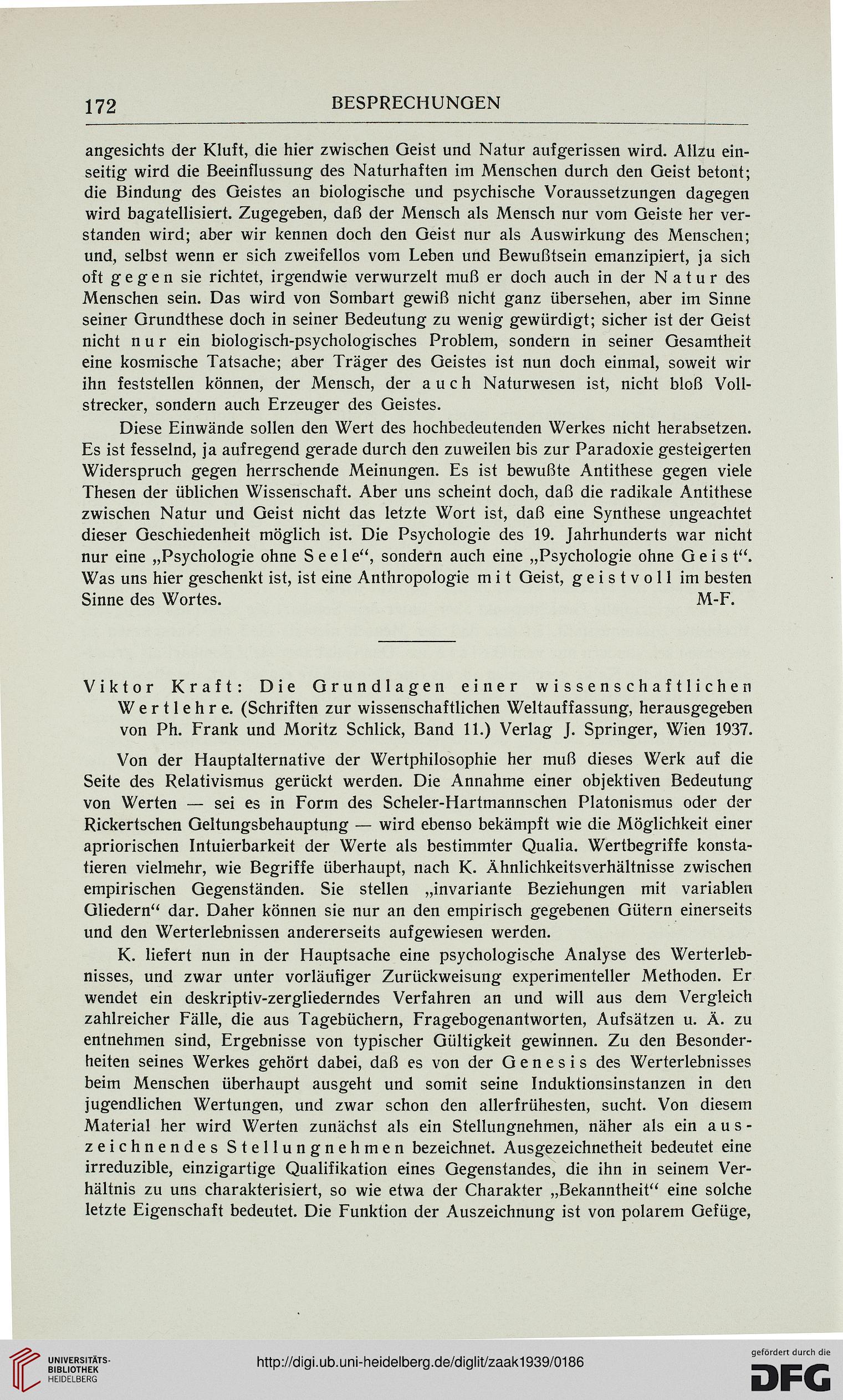172
BESPRECHUNGEN
angesichts der Kluft, die hier zwischen Geist und Natur aufgerissen wird. Allzu ein-
seitig wird die Beeinflussung des Naturhaften im Menschen durch den Geist betont;
die Bindung des Geistes an biologische und psychische Voraussetzungen dagegen
wird bagatellisiert. Zugegeben, daß der Mensch als Mensch nur vom Geiste her ver-
standen wird; aber wir kennen doch den Geist nur als Auswirkung des Menschen;
und, selbst wenn er sich zweifellos vom Leben und Bewußtsein emanzipiert, ja sich
oft gegen sie richtet, irgendwie verwurzelt muß er doch auch in der Natur des
Menschen sein. Das wird von Sombart gewiß nicht ganz übersehen, aber im Sinne
seiner Grundthese doch in seiner Bedeutung zu wenig gewürdigt; sicher ist der Geist
nicht nur ein biologisch-psychologisches Problem, sondern in seiner Gesamtheit
eine kosmische Tatsache; aber Träger des Geistes ist nun doch einmal, soweit wir
ihn feststellen können, der Mensch, der auch Naturwesen ist, nicht bloß Voll-
strecker, sondern auch Erzeuger des Geistes.
Diese Einwände sollen den Wert des hochbedeutenden Werkes nicht herabsetzen.
Es ist fesselnd, ja aufregend gerade durch den zuweilen bis zur Paradoxie gesteigerten
Widerspruch gegen herrschende Meinungen. Es ist bewußte Antithese gegen viele
Thesen der üblichen Wissenschaft. Aber uns scheint doch, daß die radikale Antithese
zwischen Natur und Geist nicht das letzte Wort ist, daß eine Synthese ungeachtet
dieser Geschiedenheit möglich ist. Die Psychologie des 19. Jahrhunderts war nicht
nur eine „Psychologie ohne S e e 1 e", sondern auch eine „Psychologie ohne Geis t".
Was uns hier geschenkt ist, ist eine Anthropologie m i t Geist, geistvoll im besten
Sinne des Wortes. M-F.
Viktor Kraft: Die Grundlagen einer wissenschaftlichen
Wertlehre. (Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung, herausgegeben
von Ph. Frank und Moritz Schlick, Band 11.) Verlag J. Springer, Wien 1937.
Von der Hauptalternative der Wertphilosophie her muß dieses Werk auf die
Seite des Relativismus gerückt werden. Die Annahme einer objektiven Bedeutung
von Werten — sei es in Form des Scheler-Hartmannschen Piatonismus oder der
Rickertschen Geltungsbehauptung — wird ebenso bekämpft wie die Möglichkeit einer
apriorischen Intuierbarkeit der Werte als bestimmter Qualia. Wertbegriffe konsta-
tieren vielmehr, wie Begriffe überhaupt, nach K. Ähnlichkeitsverhältnisse zwischen
empirischen Gegenständen. Sie stellen „invariante Beziehungen mit variablen
Gliedern" dar. Daher können sie nur an den empirisch gegebenen Gütern einerseits
und den Werterlebnissen andererseits aufgewiesen werden.
K. liefert nun in der Hauptsache eine psychologische Analyse des Werterleb-
nisses, und zwar unter vorläufiger Zurückweisung experimenteller Methoden. Er
wendet ein deskriptiv-zergliederndes Verfahren an und will aus dem Vergleich
zahlreicher Fälle, die aus Tagebüchern, Fragebogenantworten, Aufsätzen u. Ä. zu
entnehmen sind, Ergebnisse von typischer Gültigkeit gewinnen. Zu den Besonder-
heiten seines Werkes gehört dabei, daß es von der Genesis des Werterlebnisses
beim Menschen überhaupt ausgeht und somit seine Induktionsinstanzen in den
jugendlichen Wertungen, und zwar schon den allerfrühesten, sucht. Von diesem
Material her wird Werten zunächst als ein Stellungnehmen, näher als ein aus-
zeichnendes Stellungnehmen bezeichnet. Ausgezeichnetheit bedeutet eine
irreduzible, einzigartige Qualifikation eines Gegenstandes, die ihn in seinem Ver-
hältnis zu uns charakterisiert, so wie etwa der Charakter „Bekanntheit" eine solche
letzte Eigenschaft bedeutet. Die Funktion der Auszeichnung ist von polarem Gefüge,
BESPRECHUNGEN
angesichts der Kluft, die hier zwischen Geist und Natur aufgerissen wird. Allzu ein-
seitig wird die Beeinflussung des Naturhaften im Menschen durch den Geist betont;
die Bindung des Geistes an biologische und psychische Voraussetzungen dagegen
wird bagatellisiert. Zugegeben, daß der Mensch als Mensch nur vom Geiste her ver-
standen wird; aber wir kennen doch den Geist nur als Auswirkung des Menschen;
und, selbst wenn er sich zweifellos vom Leben und Bewußtsein emanzipiert, ja sich
oft gegen sie richtet, irgendwie verwurzelt muß er doch auch in der Natur des
Menschen sein. Das wird von Sombart gewiß nicht ganz übersehen, aber im Sinne
seiner Grundthese doch in seiner Bedeutung zu wenig gewürdigt; sicher ist der Geist
nicht nur ein biologisch-psychologisches Problem, sondern in seiner Gesamtheit
eine kosmische Tatsache; aber Träger des Geistes ist nun doch einmal, soweit wir
ihn feststellen können, der Mensch, der auch Naturwesen ist, nicht bloß Voll-
strecker, sondern auch Erzeuger des Geistes.
Diese Einwände sollen den Wert des hochbedeutenden Werkes nicht herabsetzen.
Es ist fesselnd, ja aufregend gerade durch den zuweilen bis zur Paradoxie gesteigerten
Widerspruch gegen herrschende Meinungen. Es ist bewußte Antithese gegen viele
Thesen der üblichen Wissenschaft. Aber uns scheint doch, daß die radikale Antithese
zwischen Natur und Geist nicht das letzte Wort ist, daß eine Synthese ungeachtet
dieser Geschiedenheit möglich ist. Die Psychologie des 19. Jahrhunderts war nicht
nur eine „Psychologie ohne S e e 1 e", sondern auch eine „Psychologie ohne Geis t".
Was uns hier geschenkt ist, ist eine Anthropologie m i t Geist, geistvoll im besten
Sinne des Wortes. M-F.
Viktor Kraft: Die Grundlagen einer wissenschaftlichen
Wertlehre. (Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung, herausgegeben
von Ph. Frank und Moritz Schlick, Band 11.) Verlag J. Springer, Wien 1937.
Von der Hauptalternative der Wertphilosophie her muß dieses Werk auf die
Seite des Relativismus gerückt werden. Die Annahme einer objektiven Bedeutung
von Werten — sei es in Form des Scheler-Hartmannschen Piatonismus oder der
Rickertschen Geltungsbehauptung — wird ebenso bekämpft wie die Möglichkeit einer
apriorischen Intuierbarkeit der Werte als bestimmter Qualia. Wertbegriffe konsta-
tieren vielmehr, wie Begriffe überhaupt, nach K. Ähnlichkeitsverhältnisse zwischen
empirischen Gegenständen. Sie stellen „invariante Beziehungen mit variablen
Gliedern" dar. Daher können sie nur an den empirisch gegebenen Gütern einerseits
und den Werterlebnissen andererseits aufgewiesen werden.
K. liefert nun in der Hauptsache eine psychologische Analyse des Werterleb-
nisses, und zwar unter vorläufiger Zurückweisung experimenteller Methoden. Er
wendet ein deskriptiv-zergliederndes Verfahren an und will aus dem Vergleich
zahlreicher Fälle, die aus Tagebüchern, Fragebogenantworten, Aufsätzen u. Ä. zu
entnehmen sind, Ergebnisse von typischer Gültigkeit gewinnen. Zu den Besonder-
heiten seines Werkes gehört dabei, daß es von der Genesis des Werterlebnisses
beim Menschen überhaupt ausgeht und somit seine Induktionsinstanzen in den
jugendlichen Wertungen, und zwar schon den allerfrühesten, sucht. Von diesem
Material her wird Werten zunächst als ein Stellungnehmen, näher als ein aus-
zeichnendes Stellungnehmen bezeichnet. Ausgezeichnetheit bedeutet eine
irreduzible, einzigartige Qualifikation eines Gegenstandes, die ihn in seinem Ver-
hältnis zu uns charakterisiert, so wie etwa der Charakter „Bekanntheit" eine solche
letzte Eigenschaft bedeutet. Die Funktion der Auszeichnung ist von polarem Gefüge,