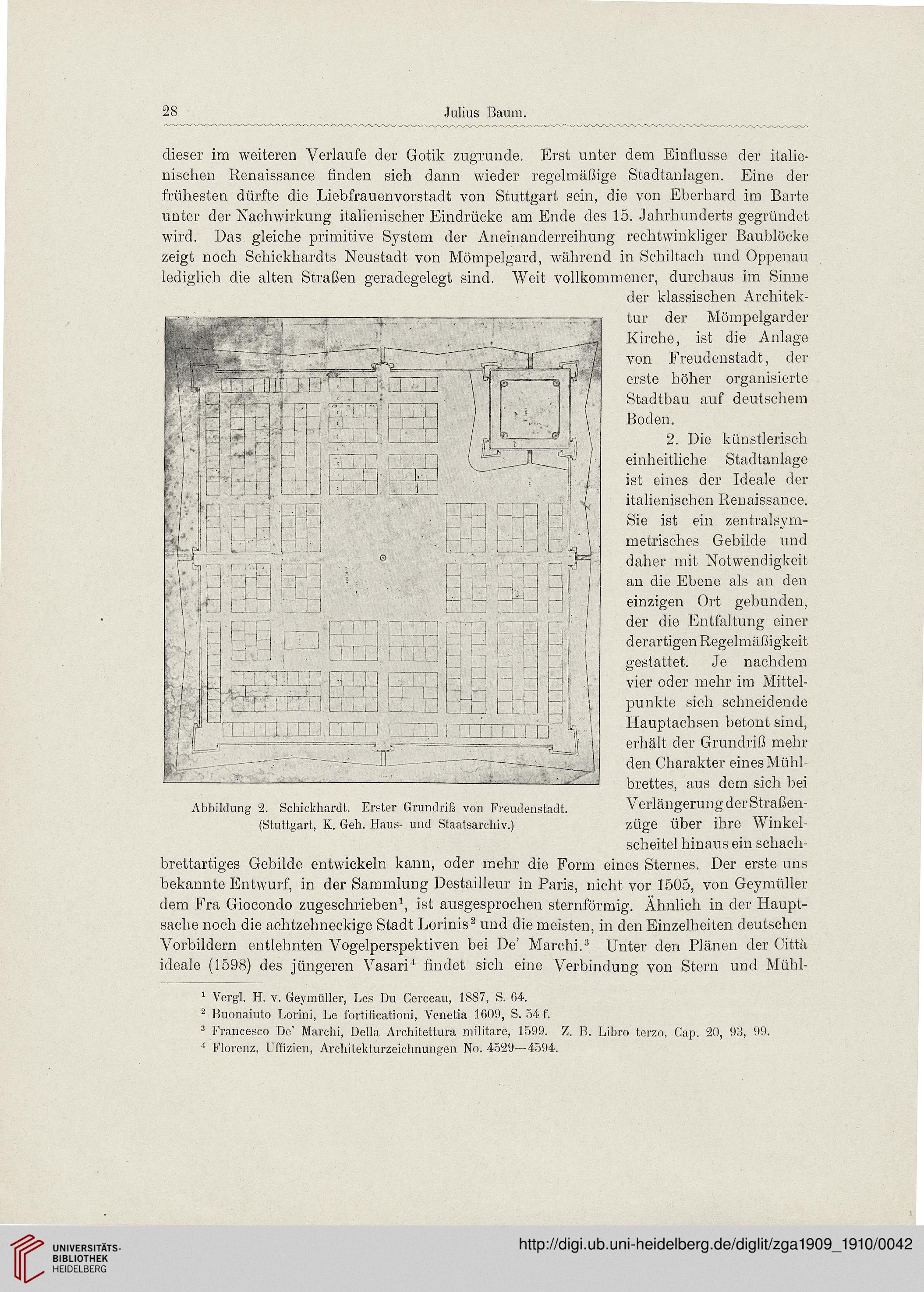28
dieser im weiteren Verlaufe der Gotik zugrunde. Erst unter dem Einflüsse der italie-
nischen Renaissance finden sich dann wieder regelmäßige Stadtanlagen. Eine der
frühesten dürfte die Liebfrauenvorstadt von Stuttgart sein, die von Eberhard im Barte
unter der Nachwirkung italienischer Eindrücke am Ende des 15. «Jahrhunderts gegründet
wird. Das gleiche primitive System der Aneinanderreihung rechtwinkliger Baublöcke
zeigt noch Schickhardts Neustadt von Mömpelgard, während in Schiltach und Oppenau
lediglich die alten Straßen geradegelegt sind. Weit vollkommener, durchaus im Sinne
der klassischen Architek-
tur der Mömpelgarder
Kirche, ist die Anlage
von Freudenstadt, der
erste höher organisierte
Stadtbau auf deutschem
Boden.
2. Die künstlerisch
einheitliche Stadtanlage
ist eines der Ideale der
italienischen Renaissance.
Sie ist ein zentralsym-
metrisches Gebilde und
daher mit Notwendigkeit
an die Ebene als an den
einzigen Ort gebunden,
der die Entfaltung einer
derartigen Regelmäßigkeit
gestattet. Je nachdem
vier oder mehr im Mittel-
punkte sich schneidende
Hauptachsen betont sind,
erhält der Grundriß mehr
den Charakter eines Mühl-
brettes, aus dem sich bei
Abbildung 2. Schickhardt. Erster Grundriß von Freudenstadt. Verlängerung der Straßen-
(Stuttgart, K. Geh. Haus- und Staatsarchiv.) züge über ihre Winkel-
scheitel hinaus ein schach-
brettartiges Gebilde entwickeln kann, oder mehr die Form eines Sternes. Der erste uns
bekannte Entwurf, in der Sammlung Destailleur in Paris, nicht vor 1505, von Geymüller
dem Fra Giocondo zugeschrieben1, ist ausgesprochen sternförmig. Ähnlich in der Haupt-
sache noch die achtzehneckige Stadt Lorinis2 und die meisten, in den Einzelheiten deutschen
Vorbildern entlehnten Vogelperspektiven bei De' Marchi.3 Unter den Plänen der Cittä
ideale (1598) des jüngeren Vasari4 findet sich eine Verbindung von Stern und Mühl-
1 Vergl, H. v. Geymüller, Les Du Gerceau, 1887, S. G4.
2 Buonaiuto Lorini, Le fortificationi, Venetia 1609, S. 54 f.
3 Francesco De' Marchi, Deila Architettura militare, 1599. Z. R. Libro terzo, Cap. 20, 93, 99.
4 Florenz, Uffizien, Architekturzeichnungen No. 4529—4594.
dieser im weiteren Verlaufe der Gotik zugrunde. Erst unter dem Einflüsse der italie-
nischen Renaissance finden sich dann wieder regelmäßige Stadtanlagen. Eine der
frühesten dürfte die Liebfrauenvorstadt von Stuttgart sein, die von Eberhard im Barte
unter der Nachwirkung italienischer Eindrücke am Ende des 15. «Jahrhunderts gegründet
wird. Das gleiche primitive System der Aneinanderreihung rechtwinkliger Baublöcke
zeigt noch Schickhardts Neustadt von Mömpelgard, während in Schiltach und Oppenau
lediglich die alten Straßen geradegelegt sind. Weit vollkommener, durchaus im Sinne
der klassischen Architek-
tur der Mömpelgarder
Kirche, ist die Anlage
von Freudenstadt, der
erste höher organisierte
Stadtbau auf deutschem
Boden.
2. Die künstlerisch
einheitliche Stadtanlage
ist eines der Ideale der
italienischen Renaissance.
Sie ist ein zentralsym-
metrisches Gebilde und
daher mit Notwendigkeit
an die Ebene als an den
einzigen Ort gebunden,
der die Entfaltung einer
derartigen Regelmäßigkeit
gestattet. Je nachdem
vier oder mehr im Mittel-
punkte sich schneidende
Hauptachsen betont sind,
erhält der Grundriß mehr
den Charakter eines Mühl-
brettes, aus dem sich bei
Abbildung 2. Schickhardt. Erster Grundriß von Freudenstadt. Verlängerung der Straßen-
(Stuttgart, K. Geh. Haus- und Staatsarchiv.) züge über ihre Winkel-
scheitel hinaus ein schach-
brettartiges Gebilde entwickeln kann, oder mehr die Form eines Sternes. Der erste uns
bekannte Entwurf, in der Sammlung Destailleur in Paris, nicht vor 1505, von Geymüller
dem Fra Giocondo zugeschrieben1, ist ausgesprochen sternförmig. Ähnlich in der Haupt-
sache noch die achtzehneckige Stadt Lorinis2 und die meisten, in den Einzelheiten deutschen
Vorbildern entlehnten Vogelperspektiven bei De' Marchi.3 Unter den Plänen der Cittä
ideale (1598) des jüngeren Vasari4 findet sich eine Verbindung von Stern und Mühl-
1 Vergl, H. v. Geymüller, Les Du Gerceau, 1887, S. G4.
2 Buonaiuto Lorini, Le fortificationi, Venetia 1609, S. 54 f.
3 Francesco De' Marchi, Deila Architettura militare, 1599. Z. R. Libro terzo, Cap. 20, 93, 99.
4 Florenz, Uffizien, Architekturzeichnungen No. 4529—4594.