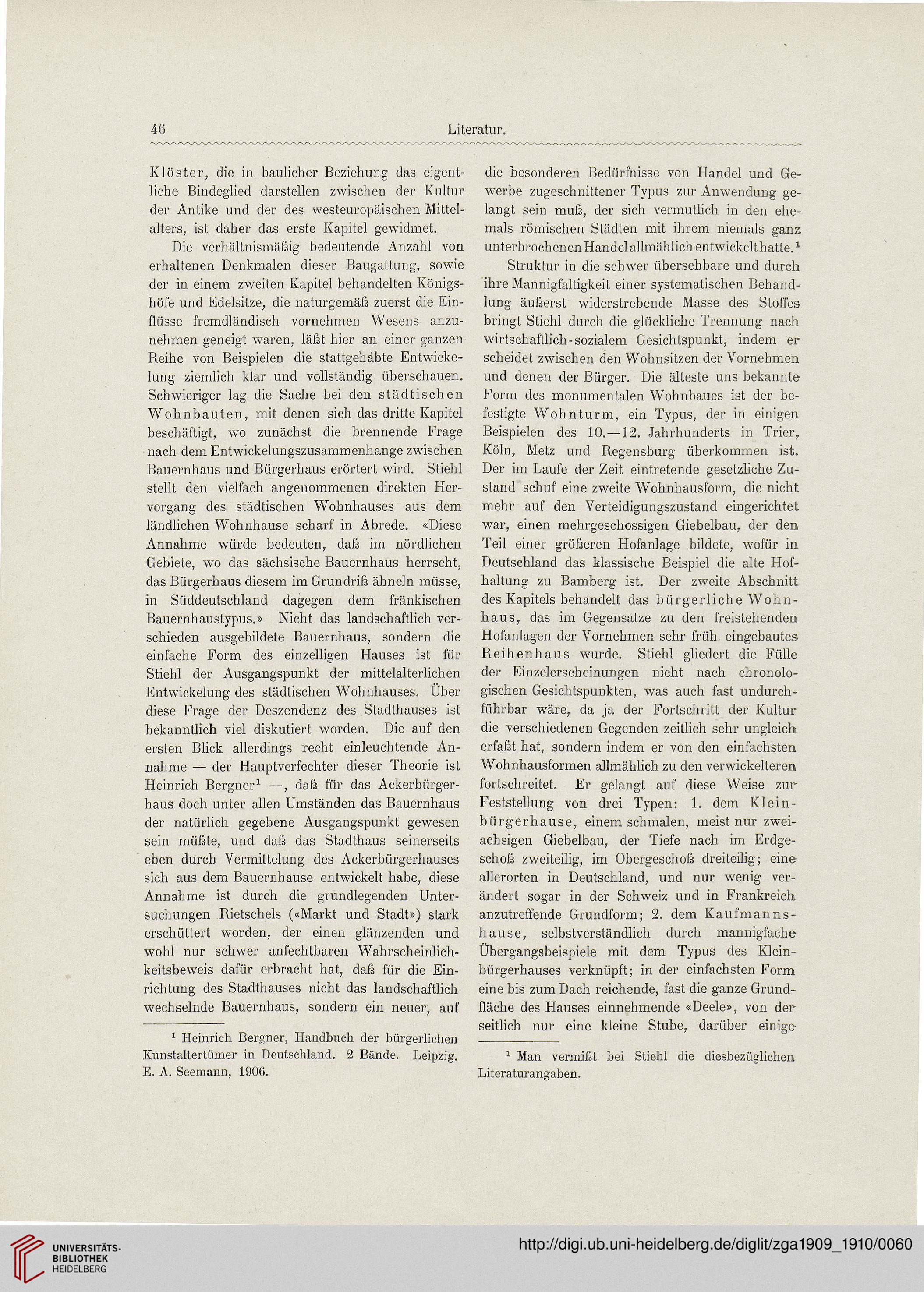46
Klöster, die in baulicher Beziehung das eigent-
liche Bindeglied darstellen zwischen der Kultur
der Antike und der des westeuropäischen Mittel-
alters, ist daher das erste Kapitel gewidmet.
Die verhältnismäßig bedeutende Anzahl von
erhaltenen Denkmalen dieser Baugattung, sowie
der in einem zweiten Kapitel behandelten Königs-
höfe und Edelsitze, die naturgemäß zuerst die Ein-
flüsse fremdländisch vornehmen Wesens anzu-
nehmen geneigt waren, läßt hier an einer ganzen
Reihe von Beispielen die stattgehabte Entwicke-
lung ziemlich klar und vollständig überschauen.
Schwieriger lag die Sache bei den städtischen
Wohnbauten, mit denen sich das dritte Kapitel
beschäftigt, wo zunächst die brennende Frage
nach dem Entwickelungszusammenhange zwischen
Bauernhaus und Bürgerhaus erörtert wird. Stiehl
stellt den vielfach angenommenen direkten Her-
vorgang des städtischen Wohnhauses aus dem
ländlichen Wohnhause scharf in Abrede. «Diese
Annahme würde bedeuten, daß im nördlichen
Gebiete, wo das sächsische Bauernhaus herrscht,
das Bürgerhaus diesem im Grundriß ähneln müsse,
in Süddeutschland dagegen dem fränkischen
Bauernhaustypus.» Nicht das landschaftlich ver-
schieden ausgebildete Bauernhaus, sondern die
einfache Form des einzelligen Hauses ist für
Stiehl der Ausgangspunkt der mittelalterlichen
Entwickelung des städtischen Wohnhauses. Über
diese Frage der Deszendenz des Stadthauses ist
bekanntlich viel diskutiert worden. Die auf den
ersten Blick allerdings recht einleuchtende An-
nahme — der Hauptverfechter dieser Theorie ist
Heinrich Bergner1 —, daß für das Ackerbürger-
haus doch unter allen Umständen das Bauernhaus
der natürlich gegebene Ausgangspunkt gewesen
sein müßte, und daß das Stadthaus seinerseits
eben durch Vermittelung des Ackerbürgerhauses
sich aus dem Bauernhause entwickelt habe, diese
Annahme ist durch die grundlegenden Unter-
suchungen Rietschels («Markt und Stadt») stark
erschüttert worden, der einen glänzenden und
wohl nur schwer anfechtbaren Wahrscheinlich-
keitsbeweis dafür erbracht hat, daß für die Ein-
richtung des Stadthauses nicht das landschaftlich
wechselnde Bauernhaus, sondern ein neuer, auf
1 Heinrich Bergner, Handbuch der bürgerlichen
Kunstaltertümer in Deutschland. 2 Bände. Leipzig.
E. A. Seemann, 1906.
die besonderen Bedürfnisse von Handel und Ge-
werbe zugeschnittener Typus zur Anwendung ge-
langt sein muß, der sich vermutlich in den ehe-
mals römischen Städten mit ihrem niemals ganz
unterbrochenen Handel allmählich entwickelt hatte.1
Struktur in die schwer übersehbare und durch
ihre Mannigfaltigkeit einer systematischen Behand-
lung äußerst widerstrebende Masse des Stoffes
bringt Stiehl durch die glückliche Trennung nach
wirtschaftlich-sozialem Gesichtspunkt, indem er
scheidet zwischen den Wohnsitzen der Vornehmen
und denen der Bürger. Die älteste uns bekannte
Form des monumentalen Wohnbaues ist der be-
festigte Wohnturm, ein Typus, der in einigen
Beispielen des 10.—12. Jahrhunderts in Trier,
Köln, Metz und Begensburg überkommen ist.
Der im Laufe der Zeit eintretende gesetzliche Zu-
stand schuf eine zweite Wohnhausform, die nicht
mehr auf den Verteidigungszustand eingerichtet
war, einen mehrgeschossigen Giebelbau, der den
Teil einer größeren Hofanlage bildete, wofür in
Deutschland das klassische Beispiel die alte Hof-
haltung zu Bamberg ist. Der zweite Abschnitt
des Kapitels behandelt das bürgerliche Wohn-
haus, das im Gegensatze zu den freistehenden
Hofanlagen der Vornehmen sehr früh eingebautes
Reihenhaus wurde. Stiehl gliedert die Fülle
der Einzelerscheinungen nicht nach chronolo-
gischen Gesichtspunkten, was auch fast undurch-
führbar wäre, da ja der Fortschritt der Kultur
die verschiedenen Gegenden zeitlich sehr ungleich
erfaßt hat, sondern indem er von den einfachsten
Wohnhausformen allmählich zu den verwickeiteren
fortschreitet. Er gelangt auf diese Weise zur
Feststellung von drei Typen: 1. dem Klein-
bürgerhause, einem schmalen, meist nur zwei-
achsigen Giebelbau, der Tiefe nach im Erdge-
schoß zweiteilig, im Obergeschoß dreiteilig; eine
allerorten in Deutschland, und nur wenig ver-
ändert sogar in der Schweiz und in Frankreich,
anzutreffende Grundform; 2. dem Kaufmanns-
hause, selbstverständlich durch mannigfache
Übergangsbeispiele mit dem Typus des Klein-
bürgerhauses verknüpft; in der einfachsten Form
eine bis zum Dach reichende, fast die ganze Grund-
fläche des Hauses einnehmende «Deele», von der
seitlich nur eine kleine Stube, darüber einige
1 Man vermißt bei Stiehl die diesbezüglichen
Literaturangaben.
Klöster, die in baulicher Beziehung das eigent-
liche Bindeglied darstellen zwischen der Kultur
der Antike und der des westeuropäischen Mittel-
alters, ist daher das erste Kapitel gewidmet.
Die verhältnismäßig bedeutende Anzahl von
erhaltenen Denkmalen dieser Baugattung, sowie
der in einem zweiten Kapitel behandelten Königs-
höfe und Edelsitze, die naturgemäß zuerst die Ein-
flüsse fremdländisch vornehmen Wesens anzu-
nehmen geneigt waren, läßt hier an einer ganzen
Reihe von Beispielen die stattgehabte Entwicke-
lung ziemlich klar und vollständig überschauen.
Schwieriger lag die Sache bei den städtischen
Wohnbauten, mit denen sich das dritte Kapitel
beschäftigt, wo zunächst die brennende Frage
nach dem Entwickelungszusammenhange zwischen
Bauernhaus und Bürgerhaus erörtert wird. Stiehl
stellt den vielfach angenommenen direkten Her-
vorgang des städtischen Wohnhauses aus dem
ländlichen Wohnhause scharf in Abrede. «Diese
Annahme würde bedeuten, daß im nördlichen
Gebiete, wo das sächsische Bauernhaus herrscht,
das Bürgerhaus diesem im Grundriß ähneln müsse,
in Süddeutschland dagegen dem fränkischen
Bauernhaustypus.» Nicht das landschaftlich ver-
schieden ausgebildete Bauernhaus, sondern die
einfache Form des einzelligen Hauses ist für
Stiehl der Ausgangspunkt der mittelalterlichen
Entwickelung des städtischen Wohnhauses. Über
diese Frage der Deszendenz des Stadthauses ist
bekanntlich viel diskutiert worden. Die auf den
ersten Blick allerdings recht einleuchtende An-
nahme — der Hauptverfechter dieser Theorie ist
Heinrich Bergner1 —, daß für das Ackerbürger-
haus doch unter allen Umständen das Bauernhaus
der natürlich gegebene Ausgangspunkt gewesen
sein müßte, und daß das Stadthaus seinerseits
eben durch Vermittelung des Ackerbürgerhauses
sich aus dem Bauernhause entwickelt habe, diese
Annahme ist durch die grundlegenden Unter-
suchungen Rietschels («Markt und Stadt») stark
erschüttert worden, der einen glänzenden und
wohl nur schwer anfechtbaren Wahrscheinlich-
keitsbeweis dafür erbracht hat, daß für die Ein-
richtung des Stadthauses nicht das landschaftlich
wechselnde Bauernhaus, sondern ein neuer, auf
1 Heinrich Bergner, Handbuch der bürgerlichen
Kunstaltertümer in Deutschland. 2 Bände. Leipzig.
E. A. Seemann, 1906.
die besonderen Bedürfnisse von Handel und Ge-
werbe zugeschnittener Typus zur Anwendung ge-
langt sein muß, der sich vermutlich in den ehe-
mals römischen Städten mit ihrem niemals ganz
unterbrochenen Handel allmählich entwickelt hatte.1
Struktur in die schwer übersehbare und durch
ihre Mannigfaltigkeit einer systematischen Behand-
lung äußerst widerstrebende Masse des Stoffes
bringt Stiehl durch die glückliche Trennung nach
wirtschaftlich-sozialem Gesichtspunkt, indem er
scheidet zwischen den Wohnsitzen der Vornehmen
und denen der Bürger. Die älteste uns bekannte
Form des monumentalen Wohnbaues ist der be-
festigte Wohnturm, ein Typus, der in einigen
Beispielen des 10.—12. Jahrhunderts in Trier,
Köln, Metz und Begensburg überkommen ist.
Der im Laufe der Zeit eintretende gesetzliche Zu-
stand schuf eine zweite Wohnhausform, die nicht
mehr auf den Verteidigungszustand eingerichtet
war, einen mehrgeschossigen Giebelbau, der den
Teil einer größeren Hofanlage bildete, wofür in
Deutschland das klassische Beispiel die alte Hof-
haltung zu Bamberg ist. Der zweite Abschnitt
des Kapitels behandelt das bürgerliche Wohn-
haus, das im Gegensatze zu den freistehenden
Hofanlagen der Vornehmen sehr früh eingebautes
Reihenhaus wurde. Stiehl gliedert die Fülle
der Einzelerscheinungen nicht nach chronolo-
gischen Gesichtspunkten, was auch fast undurch-
führbar wäre, da ja der Fortschritt der Kultur
die verschiedenen Gegenden zeitlich sehr ungleich
erfaßt hat, sondern indem er von den einfachsten
Wohnhausformen allmählich zu den verwickeiteren
fortschreitet. Er gelangt auf diese Weise zur
Feststellung von drei Typen: 1. dem Klein-
bürgerhause, einem schmalen, meist nur zwei-
achsigen Giebelbau, der Tiefe nach im Erdge-
schoß zweiteilig, im Obergeschoß dreiteilig; eine
allerorten in Deutschland, und nur wenig ver-
ändert sogar in der Schweiz und in Frankreich,
anzutreffende Grundform; 2. dem Kaufmanns-
hause, selbstverständlich durch mannigfache
Übergangsbeispiele mit dem Typus des Klein-
bürgerhauses verknüpft; in der einfachsten Form
eine bis zum Dach reichende, fast die ganze Grund-
fläche des Hauses einnehmende «Deele», von der
seitlich nur eine kleine Stube, darüber einige
1 Man vermißt bei Stiehl die diesbezüglichen
Literaturangaben.