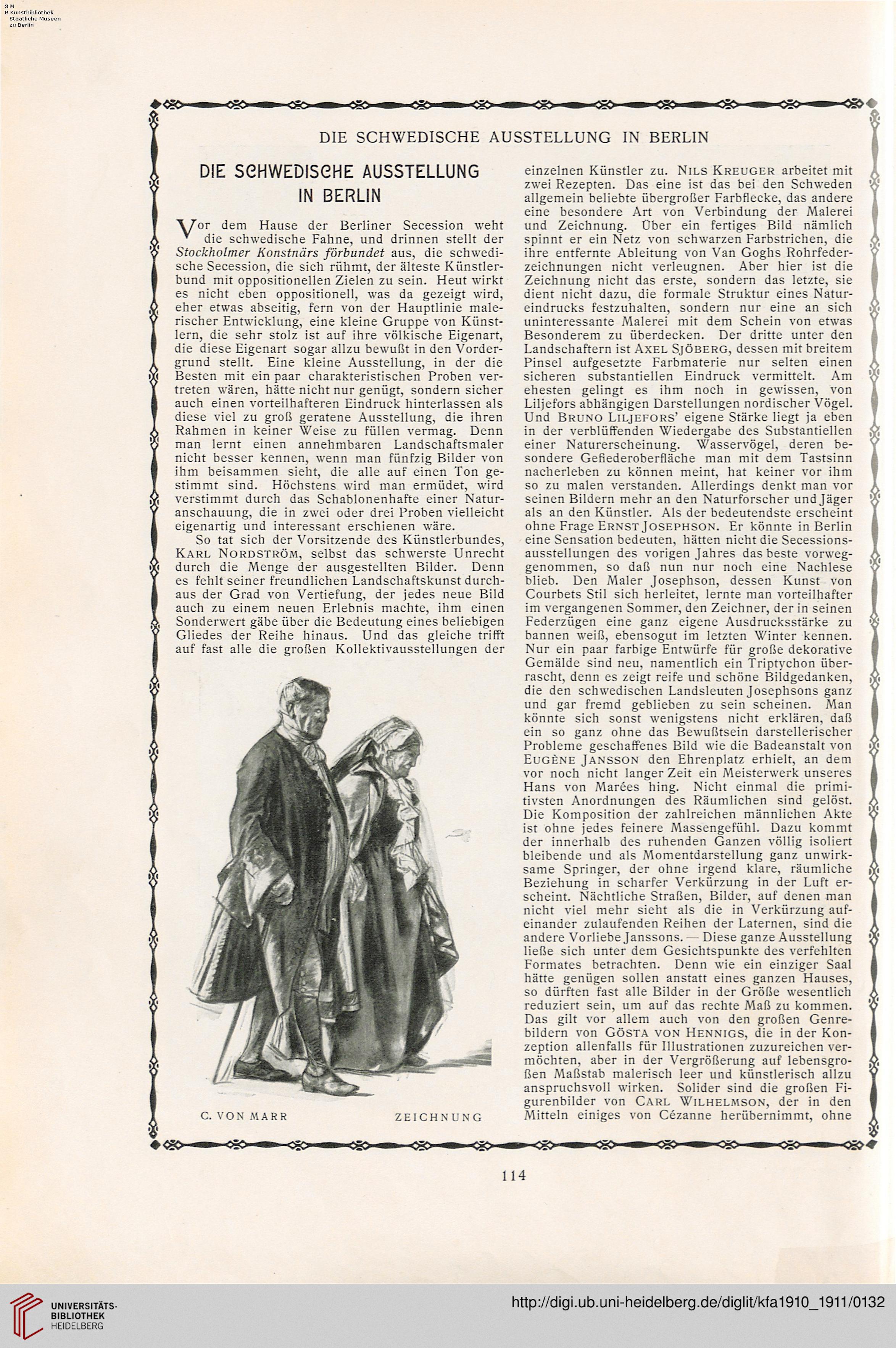DIE SCHWEDISCHE AUSSTELLUNG IN BERLIN
DIE SCHWEDISCHE AUSSTELLUNG
IN BERLIN
\Iot dem Hause der Berliner Secession weht
" die schwedische Fahne, und drinnen stellt der
Stockholmer Konstnärs förbundet aus, die schwedi-
sche Secession, die sich rühmt, der älteste Künstler-
bund mit oppositionellen Zielen zu sein. Heut wirkt
es nicht eben oppositionell, was da gezeigt wird,
eher etwas abseitig, fern von der Hauptlinie male-
rischer Entwicklung, eine kleine Gruppe von Künst-
lern, die sehr stolz ist auf ihre völkische Eigenart,
die diese Eigenart sogar allzu bewußt in den Vorder-
grund stellt. Eine kleine Ausstellung, in der die
Besten mit ein paar charakteristischen Proben ver-
treten wären, hätte nicht nur genügt, sondern sicher
auch einen vorteilhafteren Eindruck hinterlassen als
diese viel zu groß geratene Ausstellung, die ihren
Rahmen in keiner Weise zu füllen vermag. Denn
man lernt einen annehmbaren Landschaftsmaler
nicht besser kennen, wenn man fünfzig Bilder von
ihm beisammen sieht, die alle auf einen Ton ge-
stimmt sind. Höchstens wird man ermüdet, wird
verstimmt durch das Schablonenhafte einer Natur-
anschauung, die in zwei oder drei Proben vielleicht
eigenartig und interessant erschienen wäre.
So tat sich der Vorsitzende des Künstlerbundes,
Karl Nordstrom, selbst das schwerste Unrecht
durch die Menge der ausgestellten Bilder. Denn
es fehlt seiner freundlichen Landschaftskunst durch-
aus der Grad von Vertiefung, der jedes neue Bild
auch zu einem neuen Erlebnis machte, ihm einen
Sonderwert gäbe über die Bedeutung eines beliebigen
Gliedes der Reihe hinaus. Und das gleiche trifft
auf fast alle die großen Kollektivausstellungen der
c. von mar r zeichnung
einzelnen Künstler zu. Nils Kreuger arbeitet mit
zwei Rezepten. Das eine ist das bei den Schweden
allgemein beliebte übergroßer Farbflecke, das andere
eine besondere Art von Verbindung der Malerei
und Zeichnung. Ober ein fertiges Bild nämlich
spinnt er ein Netz von schwarzen Farbstrichen, die
ihre entfernte Ableitung von Van Goghs Rohrfeder-
zeichnungen nicht verleugnen. Aber hier ist die
Zeichnung nicht das erste, sondern das letzte, sie
dient nicht dazu, die formale Struktur eines Natur-
eindrucks festzuhalten, sondern nur eine an sich
uninteressante Malerei mit dem Schein von etwas
Besonderem zu überdecken. Der dritte unter den
Landschaftern ist Axel Sjöberg, dessen mit breitem
Pinsel aufgesetzte Farbmaterie nur selten einen
sicheren substantiellen Eindruck vermittelt. Am
ehesten gelingt es ihm noch in gewissen, von
Liljefors abhängigen Darstellungen nordischer Vögel.
Und Bruno Liljefors' eigene Stärke liegt ja eben
in der verblüffenden Wiedergabe des Substantiellen
einer Naturerscheinung. Wasservögel, deren be-
sondere Gefiederoberfläche man mit dem Tastsinn
nacherleben zu können meint, hat keiner vor ihm
so zu malen verstanden. Allerdings denkt man vor
seinen Bildern mehr an den Naturforscher und Jäger
als an den Künstler. Als der bedeutendste erscheint
ohne Frage Ernst Josephson. Er könnte in Berlin
eine Sensation bedeuten, hätten nicht die Secessions-
ausstellungen des vorigen Jahres das beste vorweg-
genommen, so daß nun nur noch eine Nachlese
blieb. Den Maler Josephson, dessen Kunst von
Courbets Stil sich herleitet, lernte man vorteilhafter
im vergangenen Sommer, den Zeichner, der in seinen
Federzügen eine ganz eigene Ausdrucksstärke zu
bannen weiß, ebensogut im letzten Winter kennen.
Nur ein paar farbige Entwürfe für große dekorative
Gemälde sind neu, namentlich ein Triptychon über-
rascht, denn es zeigt reife und schöne Bildgedanken,
die den schwedischen Landsleuten Josephsons ganz
und gar fremd geblieben zu sein scheinen. Man
könnte sich sonst wenigstens nicht erklären, daß
ein so ganz ohne das Bewußtsein darstellerischer
Probleme geschaffenes Bild wie die Badeanstalt von
Eugene Jansson den Ehrenplatz erhielt, an dem
vor noch nicht langer Zeit ein Meisterwerk unseres
Hans von Marees hing. Nicht einmal die primi-
tivsten Anordnungen des Räumlichen sind gelöst.
Die Komposition der zahlreichen männlichen Akte
ist ohne jedes feinere Massengefühl. Dazu kommt
der innerhalb des ruhenden Ganzen völlig isoliert
bleibende und als Momentdarstellung ganz unwirk-
same Springer, der ohne irgend klare, räumliche
Beziehung in scharfer Verkürzung in der Luft er-
scheint. Nächtliche Straßen, Bilder, auf denen man
nicht viel mehr sieht als die in Verkürzung auf-
einander zulaufenden Reihen der Laternen, sind die
andere Vorliebe Janssons. — Diese ganze Ausstellung
ließe sich unter dem Gesichtspunkte des verfehlten
Formates betrachten. Denn wie ein einziger Saal
hätte genügen sollen anstatt eines ganzen Hauses,
so dürften fast alle Bilder in der Größe wesentlich
reduziert sein, um auf das rechte Maß zu kommen.
Das gilt vor allem auch von den großen Genre-
bildern von Gösta von Hennigs, die in der Kon-
zeption allenfalls für Illustrationen zuzureichen ver-
möchten, aber in der Vergrößerung auf lebensgro-
ßen Maßstab malerisch leer und künstlerisch allzu
anspruchsvoll wirken. Solider sind die großen Fi-
gurenbilder von Carl Wilhelmson, der in den
Mitteln einiges von Cezanne herübernimmt, ohne
114
DIE SCHWEDISCHE AUSSTELLUNG
IN BERLIN
\Iot dem Hause der Berliner Secession weht
" die schwedische Fahne, und drinnen stellt der
Stockholmer Konstnärs förbundet aus, die schwedi-
sche Secession, die sich rühmt, der älteste Künstler-
bund mit oppositionellen Zielen zu sein. Heut wirkt
es nicht eben oppositionell, was da gezeigt wird,
eher etwas abseitig, fern von der Hauptlinie male-
rischer Entwicklung, eine kleine Gruppe von Künst-
lern, die sehr stolz ist auf ihre völkische Eigenart,
die diese Eigenart sogar allzu bewußt in den Vorder-
grund stellt. Eine kleine Ausstellung, in der die
Besten mit ein paar charakteristischen Proben ver-
treten wären, hätte nicht nur genügt, sondern sicher
auch einen vorteilhafteren Eindruck hinterlassen als
diese viel zu groß geratene Ausstellung, die ihren
Rahmen in keiner Weise zu füllen vermag. Denn
man lernt einen annehmbaren Landschaftsmaler
nicht besser kennen, wenn man fünfzig Bilder von
ihm beisammen sieht, die alle auf einen Ton ge-
stimmt sind. Höchstens wird man ermüdet, wird
verstimmt durch das Schablonenhafte einer Natur-
anschauung, die in zwei oder drei Proben vielleicht
eigenartig und interessant erschienen wäre.
So tat sich der Vorsitzende des Künstlerbundes,
Karl Nordstrom, selbst das schwerste Unrecht
durch die Menge der ausgestellten Bilder. Denn
es fehlt seiner freundlichen Landschaftskunst durch-
aus der Grad von Vertiefung, der jedes neue Bild
auch zu einem neuen Erlebnis machte, ihm einen
Sonderwert gäbe über die Bedeutung eines beliebigen
Gliedes der Reihe hinaus. Und das gleiche trifft
auf fast alle die großen Kollektivausstellungen der
c. von mar r zeichnung
einzelnen Künstler zu. Nils Kreuger arbeitet mit
zwei Rezepten. Das eine ist das bei den Schweden
allgemein beliebte übergroßer Farbflecke, das andere
eine besondere Art von Verbindung der Malerei
und Zeichnung. Ober ein fertiges Bild nämlich
spinnt er ein Netz von schwarzen Farbstrichen, die
ihre entfernte Ableitung von Van Goghs Rohrfeder-
zeichnungen nicht verleugnen. Aber hier ist die
Zeichnung nicht das erste, sondern das letzte, sie
dient nicht dazu, die formale Struktur eines Natur-
eindrucks festzuhalten, sondern nur eine an sich
uninteressante Malerei mit dem Schein von etwas
Besonderem zu überdecken. Der dritte unter den
Landschaftern ist Axel Sjöberg, dessen mit breitem
Pinsel aufgesetzte Farbmaterie nur selten einen
sicheren substantiellen Eindruck vermittelt. Am
ehesten gelingt es ihm noch in gewissen, von
Liljefors abhängigen Darstellungen nordischer Vögel.
Und Bruno Liljefors' eigene Stärke liegt ja eben
in der verblüffenden Wiedergabe des Substantiellen
einer Naturerscheinung. Wasservögel, deren be-
sondere Gefiederoberfläche man mit dem Tastsinn
nacherleben zu können meint, hat keiner vor ihm
so zu malen verstanden. Allerdings denkt man vor
seinen Bildern mehr an den Naturforscher und Jäger
als an den Künstler. Als der bedeutendste erscheint
ohne Frage Ernst Josephson. Er könnte in Berlin
eine Sensation bedeuten, hätten nicht die Secessions-
ausstellungen des vorigen Jahres das beste vorweg-
genommen, so daß nun nur noch eine Nachlese
blieb. Den Maler Josephson, dessen Kunst von
Courbets Stil sich herleitet, lernte man vorteilhafter
im vergangenen Sommer, den Zeichner, der in seinen
Federzügen eine ganz eigene Ausdrucksstärke zu
bannen weiß, ebensogut im letzten Winter kennen.
Nur ein paar farbige Entwürfe für große dekorative
Gemälde sind neu, namentlich ein Triptychon über-
rascht, denn es zeigt reife und schöne Bildgedanken,
die den schwedischen Landsleuten Josephsons ganz
und gar fremd geblieben zu sein scheinen. Man
könnte sich sonst wenigstens nicht erklären, daß
ein so ganz ohne das Bewußtsein darstellerischer
Probleme geschaffenes Bild wie die Badeanstalt von
Eugene Jansson den Ehrenplatz erhielt, an dem
vor noch nicht langer Zeit ein Meisterwerk unseres
Hans von Marees hing. Nicht einmal die primi-
tivsten Anordnungen des Räumlichen sind gelöst.
Die Komposition der zahlreichen männlichen Akte
ist ohne jedes feinere Massengefühl. Dazu kommt
der innerhalb des ruhenden Ganzen völlig isoliert
bleibende und als Momentdarstellung ganz unwirk-
same Springer, der ohne irgend klare, räumliche
Beziehung in scharfer Verkürzung in der Luft er-
scheint. Nächtliche Straßen, Bilder, auf denen man
nicht viel mehr sieht als die in Verkürzung auf-
einander zulaufenden Reihen der Laternen, sind die
andere Vorliebe Janssons. — Diese ganze Ausstellung
ließe sich unter dem Gesichtspunkte des verfehlten
Formates betrachten. Denn wie ein einziger Saal
hätte genügen sollen anstatt eines ganzen Hauses,
so dürften fast alle Bilder in der Größe wesentlich
reduziert sein, um auf das rechte Maß zu kommen.
Das gilt vor allem auch von den großen Genre-
bildern von Gösta von Hennigs, die in der Kon-
zeption allenfalls für Illustrationen zuzureichen ver-
möchten, aber in der Vergrößerung auf lebensgro-
ßen Maßstab malerisch leer und künstlerisch allzu
anspruchsvoll wirken. Solider sind die großen Fi-
gurenbilder von Carl Wilhelmson, der in den
Mitteln einiges von Cezanne herübernimmt, ohne
114