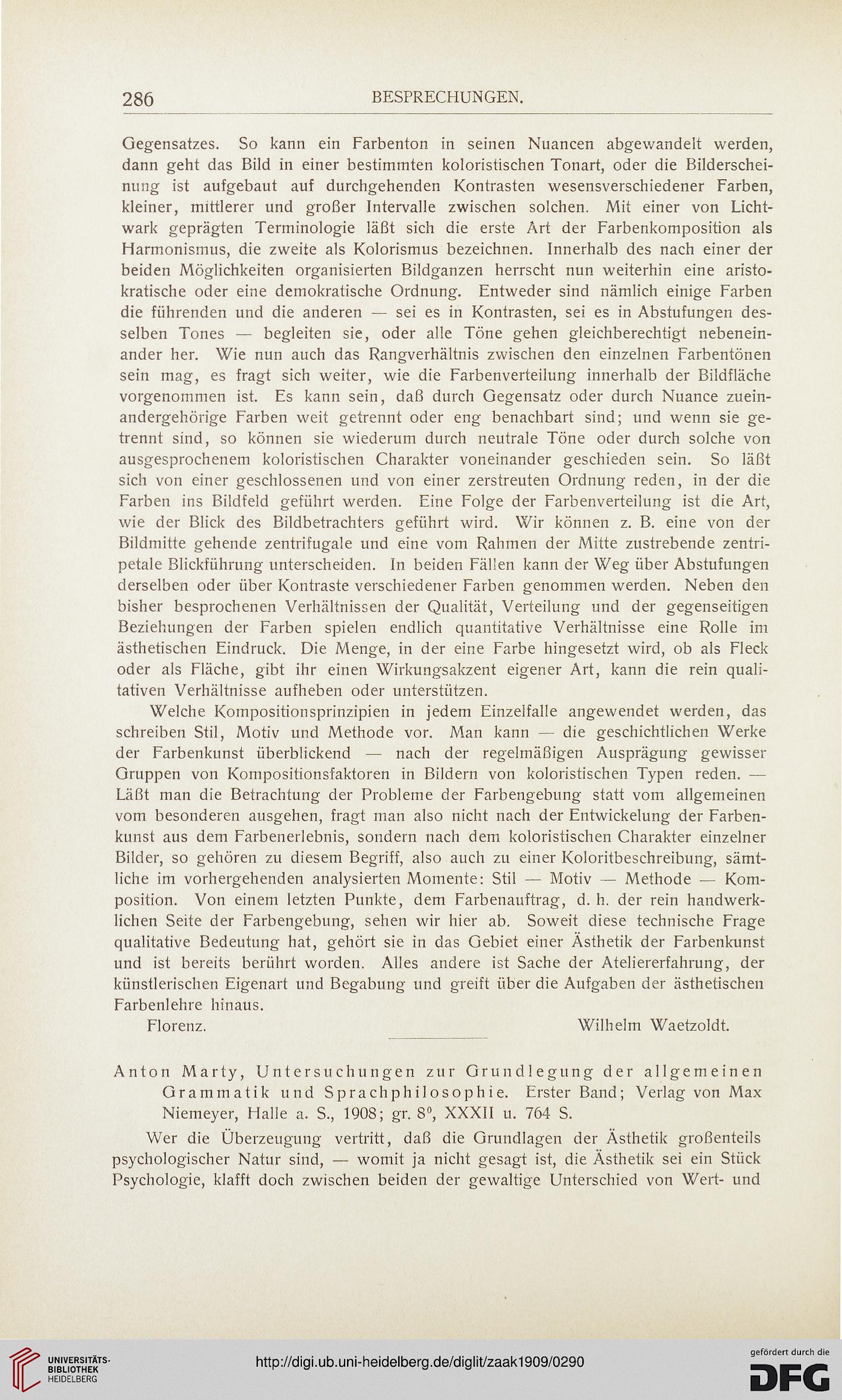286
BESPRECHUNGEN.
Gegensatzes. So kann ein Farbenton in seinen Nuancen abgewandelt werden,
dann geht das Bild in einer bestimmten koloristischen Tonart, oder die Bilderschei-
nung ist aufgebaut auf durchgehenden Kontrasten wesensverschiedener Farben,
kleiner, mittlerer und großer Intervalle zwischen solchen. Mit einer von Licht-
wark geprägten Terminologie läßt sich die erste Art der Farbenkomposition als
Harmonismus, die zweite als Kolorismus bezeichnen. Innerhalb des nach einer der
beiden Möglichkeiten organisierten Bildganzen herrscht nun weiterhin eine aristo-
kratische oder eine demokratische Ordnung. Entweder sind nämlich einige Farben
die führenden und die anderen — sei es in Kontrasten, sei es in Abstufungen des-
selben Tones — begleiten sie, oder alle Töne gehen gleichberechtigt nebenein-
ander her. Wie nun auch das Rangverhältnis zwischen den einzelnen Farbentönen
sein mag, es fragt sich weiter, wie die Farbenverteilung innerhalb der Bildfläche
vorgenommen ist. Es kann sein, daß durch Gegensatz oder durch Nuance zuein-
andergehörige Farben weit getrennt oder eng benachbart sind; und wenn sie ge-
trennt sind, so können sie wiederum durch neutrale Töne oder durch solche von
ausgesprochenem koloristischen Charakter voneinander geschieden sein. So läßt
sich von einer geschlossenen und von einer zerstreuten Ordnung reden, in der die
Farben ins Bildfeld geführt werden. Eine Folge der Farbenverteilung ist die Art,
wie der Blick des Bildbetrachters geführt wird. Wir können z. B. eine von der
Bildmitte gehende zentrifugale und eine vom Rahmen der Mitte zustrebende zentri-
petale Blickführung unterscheiden. In beiden Fällen kann der Weg über Abstufungen
derselben oder über Kontraste verschiedener Farben genommen werden. Neben den
bisher besprochenen Verhältnissen der Qualität, Verteilung und der gegenseitigen
Beziehungen der Farben spielen endlich quantitative Verhältnisse eine Rolle im
ästhetischen Eindruck. Die Menge, in der eine Farbe hingesetzt wird, ob als Fleck
oder als Fläche, gibt ihr einen Wirkungsakzent eigener Art, kann die rein quali-
tativen Verhältnisse aufheben oder unterstützen.
Welche Kompositionsprinzipien in jedem Einzelfalle angewendet werden, das
schreiben Stil, Motiv und Methode vor. Man kann — die geschichtlichen Werke
der Farbenkunst überblickend — nach der regelmäßigen Ausprägung gewisser
Gruppen von Kompositionsfaktoren in Bildern von koloristischen Typen reden. —
Läßt man die Betrachtung der Probleme der Farbengebung statt vom allgemeinen
vom besonderen ausgehen, fragt man also nicht nach der Entwickelung der Farben-
kunst aus dem Farbenerlebnis, sondern nach dem koloristischen Charakter einzelner
Bilder, so gehören zu diesem Begriff, also auch zu einer Koloritbeschreibung, sämt-
liche im vorhergehenden analysierten Momente: Stil — Motiv — Methode — Kom-
position. Von einem letzten Punkte, dem Farbenauftrag, d. h. der rein handwerk-
lichen Seite der Farbengebung, sehen wir hier ab. Soweit diese technische Frage
qualitative Bedeutung hat, gehört sie in das Gebiet einer Ästhetik der Farbenkunst
und ist bereits berührt worden. Alles andere ist Sache der Ateliererfahrung, der
künstlerischen Eigenart und Begabung und greift über die Aufgaben der ästhetischen
Farbenlehre hinaus.
Florenz. Wilhelm Waetzoldt.
Anton Marty, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen
Grammatik und Sprachphilosophie. Erster Band; Verlag von Max
Niemeyer, Halle a. S., 1908; gr. 8°, XXXII u. 764 S.
Wer die Überzeugung vertritt, daß die Grundlagen der Ästhetik großenteils
psychologischer Natur sind, — womit ja nicht gesagt ist, die Ästhetik sei ein Stück
Psychologie, klafft doch zwischen beiden der gewaltige Unterschied von Wert- und
BESPRECHUNGEN.
Gegensatzes. So kann ein Farbenton in seinen Nuancen abgewandelt werden,
dann geht das Bild in einer bestimmten koloristischen Tonart, oder die Bilderschei-
nung ist aufgebaut auf durchgehenden Kontrasten wesensverschiedener Farben,
kleiner, mittlerer und großer Intervalle zwischen solchen. Mit einer von Licht-
wark geprägten Terminologie läßt sich die erste Art der Farbenkomposition als
Harmonismus, die zweite als Kolorismus bezeichnen. Innerhalb des nach einer der
beiden Möglichkeiten organisierten Bildganzen herrscht nun weiterhin eine aristo-
kratische oder eine demokratische Ordnung. Entweder sind nämlich einige Farben
die führenden und die anderen — sei es in Kontrasten, sei es in Abstufungen des-
selben Tones — begleiten sie, oder alle Töne gehen gleichberechtigt nebenein-
ander her. Wie nun auch das Rangverhältnis zwischen den einzelnen Farbentönen
sein mag, es fragt sich weiter, wie die Farbenverteilung innerhalb der Bildfläche
vorgenommen ist. Es kann sein, daß durch Gegensatz oder durch Nuance zuein-
andergehörige Farben weit getrennt oder eng benachbart sind; und wenn sie ge-
trennt sind, so können sie wiederum durch neutrale Töne oder durch solche von
ausgesprochenem koloristischen Charakter voneinander geschieden sein. So läßt
sich von einer geschlossenen und von einer zerstreuten Ordnung reden, in der die
Farben ins Bildfeld geführt werden. Eine Folge der Farbenverteilung ist die Art,
wie der Blick des Bildbetrachters geführt wird. Wir können z. B. eine von der
Bildmitte gehende zentrifugale und eine vom Rahmen der Mitte zustrebende zentri-
petale Blickführung unterscheiden. In beiden Fällen kann der Weg über Abstufungen
derselben oder über Kontraste verschiedener Farben genommen werden. Neben den
bisher besprochenen Verhältnissen der Qualität, Verteilung und der gegenseitigen
Beziehungen der Farben spielen endlich quantitative Verhältnisse eine Rolle im
ästhetischen Eindruck. Die Menge, in der eine Farbe hingesetzt wird, ob als Fleck
oder als Fläche, gibt ihr einen Wirkungsakzent eigener Art, kann die rein quali-
tativen Verhältnisse aufheben oder unterstützen.
Welche Kompositionsprinzipien in jedem Einzelfalle angewendet werden, das
schreiben Stil, Motiv und Methode vor. Man kann — die geschichtlichen Werke
der Farbenkunst überblickend — nach der regelmäßigen Ausprägung gewisser
Gruppen von Kompositionsfaktoren in Bildern von koloristischen Typen reden. —
Läßt man die Betrachtung der Probleme der Farbengebung statt vom allgemeinen
vom besonderen ausgehen, fragt man also nicht nach der Entwickelung der Farben-
kunst aus dem Farbenerlebnis, sondern nach dem koloristischen Charakter einzelner
Bilder, so gehören zu diesem Begriff, also auch zu einer Koloritbeschreibung, sämt-
liche im vorhergehenden analysierten Momente: Stil — Motiv — Methode — Kom-
position. Von einem letzten Punkte, dem Farbenauftrag, d. h. der rein handwerk-
lichen Seite der Farbengebung, sehen wir hier ab. Soweit diese technische Frage
qualitative Bedeutung hat, gehört sie in das Gebiet einer Ästhetik der Farbenkunst
und ist bereits berührt worden. Alles andere ist Sache der Ateliererfahrung, der
künstlerischen Eigenart und Begabung und greift über die Aufgaben der ästhetischen
Farbenlehre hinaus.
Florenz. Wilhelm Waetzoldt.
Anton Marty, Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen
Grammatik und Sprachphilosophie. Erster Band; Verlag von Max
Niemeyer, Halle a. S., 1908; gr. 8°, XXXII u. 764 S.
Wer die Überzeugung vertritt, daß die Grundlagen der Ästhetik großenteils
psychologischer Natur sind, — womit ja nicht gesagt ist, die Ästhetik sei ein Stück
Psychologie, klafft doch zwischen beiden der gewaltige Unterschied von Wert- und