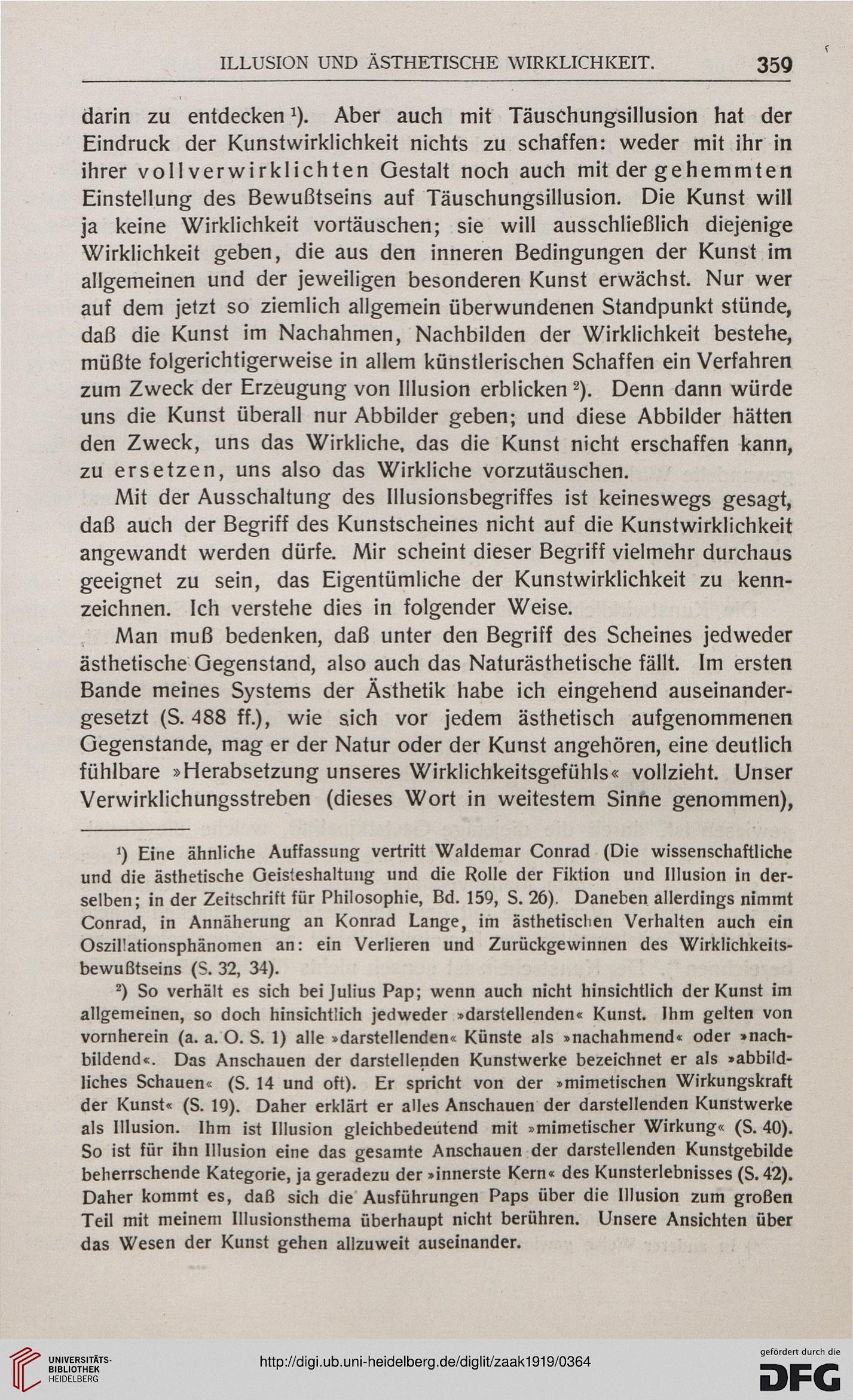ILLUSION UND ÄSTHETISCHE WIRKLICHKEIT. 359
darin zu entdecken*). Aber auch mit Täuschungsillusion hat der
Eindruck der Kunstwirklichkeit nichts zu schaffen: weder mit ihr in
ihrer voll verwirklichten Gestalt noch auch mit der gehemmten
Einstellung des Bewußtseins auf Täuschungsillusion. Die Kunst will
ja keine Wirklichkeit vortäuschen; sie will ausschließlich diejenige
Wirklichkeit geben, die aus den inneren Bedingungen der Kunst im
allgemeinen und der jeweiligen besonderen Kunst erwächst. Nur wer
auf dem jetzt so ziemlich allgemein überwundenen Standpunkt stünde,
daß die Kunst im Nachahmen, Nachbilden der Wirklichkeit bestehe,
müßte folgerichtigerweise in allem künstlerischen Schaffen ein Verfahren
zum Zweck der Erzeugung von Illusion erblicken2). Denn dann würde
uns die Kunst überall nur Abbilder geben; und diese Abbilder hätten
den Zweck, uns das Wirkliche, das die Kunst nicht erschaffen kann,
zu ersetzen, uns also das Wirkliche vorzutäuschen.
Mit der Ausschaltung des Illusionsbegriffes ist keineswegs gesagt,
daß auch der Begriff des Kunstscheines nicht auf die Kunstwirklichkeit
angewandt werden dürfe. Mir scheint dieser Begriff vielmehr durchaus
geeignet zu sein, das Eigentümliche der Kunstwirklichkeit zu kenn-
zeichnen. Ich verstehe dies in folgender Weise.
Man muß bedenken, daß unter den Begriff des Scheines jedweder
ästhetische Gegenstand, also auch das Naturästhetische fällt. Im ersten
Bande meines Systems der Ästhetik habe ich eingehend auseinander-
gesetzt (S. 488 ff.), wie sich vor jedem ästhetisch aufgenommenen
Gegenstande, mag er der Natur oder der Kunst angehören, eine deutlich
fühlbare »Herabsetzung unseres Wirklichkeitsgefühls« vollzieht. Unser
Verwirklichungsstreben (dieses Wort in weitestem Sinne genommen),
') Eine ähnliche Auffassung vertritt Waldemar Conrad (Die wissenschaftliche
und die ästhetische Geisteshaltung und die Rolle der Fiktion und Illusion in der-
selben; in der Zeitschrift für Philosophie, Bd. 159, S. 26). Daneben allerdings nimmt
Conrad, in Annäherung an Konrad Lange, im ästhetischen Verhalten auch ein
Osziüationsphänomen an: ein Verlieren und Zurückgewinnen des Wirklichkeits-
bewußtseins (S. 32, 34).
2) So verhält es sich bei Julius Pap; wenn auch nicht hinsichtlich der Kunst im
allgemeinen, so doch hinsichtlich jedweder »darstellenden« Kunst. Ihm gelten von
vornherein (a. a. O. S. 1) alle »darstellenden« Künste als »nachahmend« oder »nach-
bildend«. Das Anschauen der darstellenden Kunstwerke bezeichnet er als »abbild-
liches Schauen« (S. 14 und oft). Er spricht von der »mimetischen Wirkungskraft
der Kunst« (S. 19). Daher erklärt er alles Anschauen der darstellenden Kunstwerke
als Illusion. Ihm ist Illusion gleichbedeutend mit »mimetischer Wirkung« (S. 40).
So ist für ihn Illusion eine das gesamte Anschauen der darstellenden Kunstgebilde
beherrschende Kategorie, ja geradezu der »innerste Kern« des Kunsterlebnisses (S. 42).
Daher kommt es, daß sich die Ausführungen Paps über die Illusion zum großen
Teil mit meinem Illusionsthema überhaupt nicht berühren. Unsere Ansichten über
das Wesen der Kunst gehen allzuweit auseinander.
darin zu entdecken*). Aber auch mit Täuschungsillusion hat der
Eindruck der Kunstwirklichkeit nichts zu schaffen: weder mit ihr in
ihrer voll verwirklichten Gestalt noch auch mit der gehemmten
Einstellung des Bewußtseins auf Täuschungsillusion. Die Kunst will
ja keine Wirklichkeit vortäuschen; sie will ausschließlich diejenige
Wirklichkeit geben, die aus den inneren Bedingungen der Kunst im
allgemeinen und der jeweiligen besonderen Kunst erwächst. Nur wer
auf dem jetzt so ziemlich allgemein überwundenen Standpunkt stünde,
daß die Kunst im Nachahmen, Nachbilden der Wirklichkeit bestehe,
müßte folgerichtigerweise in allem künstlerischen Schaffen ein Verfahren
zum Zweck der Erzeugung von Illusion erblicken2). Denn dann würde
uns die Kunst überall nur Abbilder geben; und diese Abbilder hätten
den Zweck, uns das Wirkliche, das die Kunst nicht erschaffen kann,
zu ersetzen, uns also das Wirkliche vorzutäuschen.
Mit der Ausschaltung des Illusionsbegriffes ist keineswegs gesagt,
daß auch der Begriff des Kunstscheines nicht auf die Kunstwirklichkeit
angewandt werden dürfe. Mir scheint dieser Begriff vielmehr durchaus
geeignet zu sein, das Eigentümliche der Kunstwirklichkeit zu kenn-
zeichnen. Ich verstehe dies in folgender Weise.
Man muß bedenken, daß unter den Begriff des Scheines jedweder
ästhetische Gegenstand, also auch das Naturästhetische fällt. Im ersten
Bande meines Systems der Ästhetik habe ich eingehend auseinander-
gesetzt (S. 488 ff.), wie sich vor jedem ästhetisch aufgenommenen
Gegenstande, mag er der Natur oder der Kunst angehören, eine deutlich
fühlbare »Herabsetzung unseres Wirklichkeitsgefühls« vollzieht. Unser
Verwirklichungsstreben (dieses Wort in weitestem Sinne genommen),
') Eine ähnliche Auffassung vertritt Waldemar Conrad (Die wissenschaftliche
und die ästhetische Geisteshaltung und die Rolle der Fiktion und Illusion in der-
selben; in der Zeitschrift für Philosophie, Bd. 159, S. 26). Daneben allerdings nimmt
Conrad, in Annäherung an Konrad Lange, im ästhetischen Verhalten auch ein
Osziüationsphänomen an: ein Verlieren und Zurückgewinnen des Wirklichkeits-
bewußtseins (S. 32, 34).
2) So verhält es sich bei Julius Pap; wenn auch nicht hinsichtlich der Kunst im
allgemeinen, so doch hinsichtlich jedweder »darstellenden« Kunst. Ihm gelten von
vornherein (a. a. O. S. 1) alle »darstellenden« Künste als »nachahmend« oder »nach-
bildend«. Das Anschauen der darstellenden Kunstwerke bezeichnet er als »abbild-
liches Schauen« (S. 14 und oft). Er spricht von der »mimetischen Wirkungskraft
der Kunst« (S. 19). Daher erklärt er alles Anschauen der darstellenden Kunstwerke
als Illusion. Ihm ist Illusion gleichbedeutend mit »mimetischer Wirkung« (S. 40).
So ist für ihn Illusion eine das gesamte Anschauen der darstellenden Kunstgebilde
beherrschende Kategorie, ja geradezu der »innerste Kern« des Kunsterlebnisses (S. 42).
Daher kommt es, daß sich die Ausführungen Paps über die Illusion zum großen
Teil mit meinem Illusionsthema überhaupt nicht berühren. Unsere Ansichten über
das Wesen der Kunst gehen allzuweit auseinander.