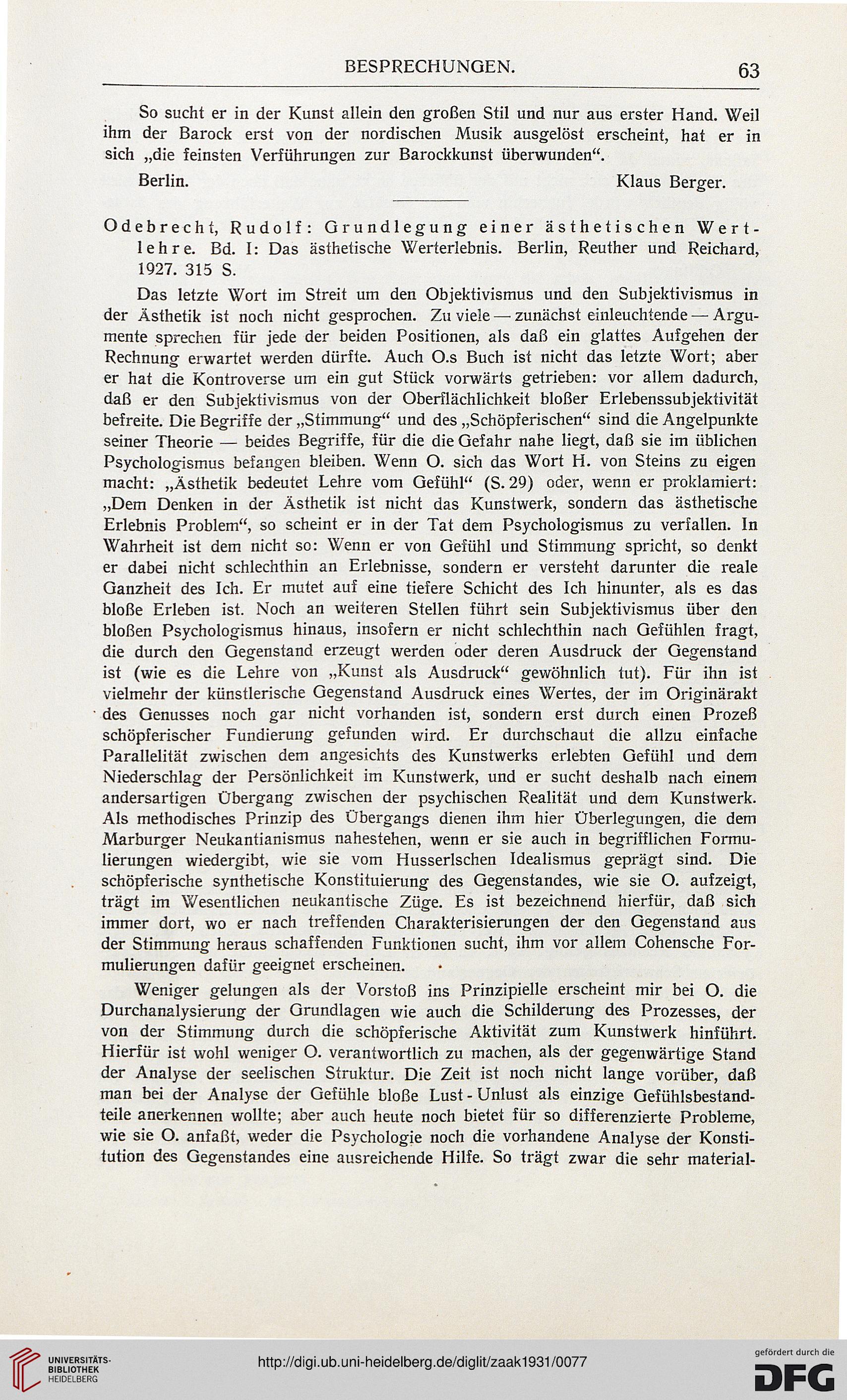BESPRECHUNGEN.
63
So sucht er in der Kunst allein den großen Stil und nur aus erster Hand. Weil
ihm der Barock erst von der nordischen Musik ausgelöst erscheint, hat er in
sich „die feinsten Verführungen zur Barockkunst überwunden".
Berlin. Klaus Berger.
Odebrecht, Rudolf: Grundlegung einer ästhetischen Wert-
lehre. Bd. I: Das ästhetische Werterlebnis. Berlin, Reuther und Reichard,
1927. 315 S.
Das letzte Wort im Streit um den Objektivismus und den Subjektivismus in
der Ästhetik ist noch nicht gesprochen. Zu viele —■ zunächst einleuchtende — Argu-
mente sprechen für jede der beiden Positionen, als daß ein glattes Aufgehen der
Rechnung erwartet werden dürfte. Auch O.s Buch ist nicht das letzte Wort; aber
er hat die Kontroverse um ein gut Stück vorwärts getrieben: vor allem dadurch,
daß er den Subjektivismus von der Oberflächlichkeit bloßer Erlebenssubjektivität
befreite. Die Begriffe der „Stimmung" und des „Schöpferischen" sind die Angelpunkte
seiner Theorie — beides Begriffe, für die die Gefahr nahe liegt, daß sie im üblichen
Psychologismus befangen bleiben. Wenn O. sich das Wort H. von Steins zu eigen
macht: „Ästhetik bedeutet Lehre vom Gefühl" (S. 29) oder, wenn er proklamiert:
„Dem Denken in der Ästhetik ist nicht das Kunstwerk, sondern das ästhetische
Erlebnis Problem", so scheint er in der Tat dem Psychologismus zu verfallen. In
Wahrheit ist dem nicht so: Wenn er von Gefühl und Stimmung spricht, so denkt
er dabei nicht schlechthin an Erlebnisse, sondern er versteht darunter die reale
Ganzheit des Ich. Er mutet auf eine tiefere Schicht des Ich hinunter, als es das
bloße Erleben ist. Noch an weiteren Stellen führt sein Subjektivismus über den
bloßen Psychologismus hinaus, insofern er nicht schlechthin nach Gefühlen fragt,
die durch den Gegenstand erzeugt werden oder deren Ausdruck der Gegenstand
ist (wie es die Lehre von „Kunst als Ausdruck" gewöhnlich tut). Für ihn ist
vielmehr der künstlerische Gegenstand Ausdruck eines Wertes, der im Originärakt
des Genusses noch gar nicht vorhanden ist, sondern erst durch einen Prozeß
schöpferischer Fundierung gefunden wird. Er durchschaut die allzu einfache
Parallelität zwischen dem angesichts des Kunstwerks erlebten Gefühl und dem
Niederschlag der Persönlichkeit im Kunstwerk, und er sucht deshalb nach einem
andersartigen Obergang zwischen der psychischen Realität und dem Kunstwerk.
Als methodisches Prinzip des Übergangs dienen ihm hier Überlegungen, die dem
Marburger Neukantianismus nahestehen, wenn er sie auch in begrifflichen Formu-
lierungen wiedergibt, wie sie vom Husserlschen Idealismus geprägt sind. Die
schöpferische synthetische Konstituierung des Gegenstandes, wie sie O. aufzeigt,
trägt im Wesentlichen neukantische Züge. Es ist bezeichnend hierfür, daß sich
immer dort, wo er nach treffenden Charakterisierungen der den Gegenstand aus
der Stimmung heraus schaffenden Funktionen sucht, ihm vor allem Cohensche For-
mulierungen dafür geeignet erscheinen.
Weniger gelungen als der Vorstoß ins Prinzipielle erscheint mir bei O. die
Durchanalysierung der Grundlagen wie auch die Schilderung des Prozesses, der
von der Stimmung durch die schöpferische Aktivität zum Kunstwerk hinführt.
Hierfür ist wohl weniger O. verantwortlich zu machen, als der gegenwärtige Stand
der Analyse der seelischen Struktur. Die Zeit ist noch nicht lange vorüber, daß
man bei der Analyse der Gefühle bloße Lust - Unlust als einzige Gefühlsbestand-
teile anerkennen wollte; aber auch heute noch bietet für so differenzierte Probleme,
wie sie O. anfaßt, weder die Psychologie noch die vorhandene Analyse der Konsti-
tution des Gegenstandes eine ausreichende Hilfe. So trägt zwar die sehr material-
63
So sucht er in der Kunst allein den großen Stil und nur aus erster Hand. Weil
ihm der Barock erst von der nordischen Musik ausgelöst erscheint, hat er in
sich „die feinsten Verführungen zur Barockkunst überwunden".
Berlin. Klaus Berger.
Odebrecht, Rudolf: Grundlegung einer ästhetischen Wert-
lehre. Bd. I: Das ästhetische Werterlebnis. Berlin, Reuther und Reichard,
1927. 315 S.
Das letzte Wort im Streit um den Objektivismus und den Subjektivismus in
der Ästhetik ist noch nicht gesprochen. Zu viele —■ zunächst einleuchtende — Argu-
mente sprechen für jede der beiden Positionen, als daß ein glattes Aufgehen der
Rechnung erwartet werden dürfte. Auch O.s Buch ist nicht das letzte Wort; aber
er hat die Kontroverse um ein gut Stück vorwärts getrieben: vor allem dadurch,
daß er den Subjektivismus von der Oberflächlichkeit bloßer Erlebenssubjektivität
befreite. Die Begriffe der „Stimmung" und des „Schöpferischen" sind die Angelpunkte
seiner Theorie — beides Begriffe, für die die Gefahr nahe liegt, daß sie im üblichen
Psychologismus befangen bleiben. Wenn O. sich das Wort H. von Steins zu eigen
macht: „Ästhetik bedeutet Lehre vom Gefühl" (S. 29) oder, wenn er proklamiert:
„Dem Denken in der Ästhetik ist nicht das Kunstwerk, sondern das ästhetische
Erlebnis Problem", so scheint er in der Tat dem Psychologismus zu verfallen. In
Wahrheit ist dem nicht so: Wenn er von Gefühl und Stimmung spricht, so denkt
er dabei nicht schlechthin an Erlebnisse, sondern er versteht darunter die reale
Ganzheit des Ich. Er mutet auf eine tiefere Schicht des Ich hinunter, als es das
bloße Erleben ist. Noch an weiteren Stellen führt sein Subjektivismus über den
bloßen Psychologismus hinaus, insofern er nicht schlechthin nach Gefühlen fragt,
die durch den Gegenstand erzeugt werden oder deren Ausdruck der Gegenstand
ist (wie es die Lehre von „Kunst als Ausdruck" gewöhnlich tut). Für ihn ist
vielmehr der künstlerische Gegenstand Ausdruck eines Wertes, der im Originärakt
des Genusses noch gar nicht vorhanden ist, sondern erst durch einen Prozeß
schöpferischer Fundierung gefunden wird. Er durchschaut die allzu einfache
Parallelität zwischen dem angesichts des Kunstwerks erlebten Gefühl und dem
Niederschlag der Persönlichkeit im Kunstwerk, und er sucht deshalb nach einem
andersartigen Obergang zwischen der psychischen Realität und dem Kunstwerk.
Als methodisches Prinzip des Übergangs dienen ihm hier Überlegungen, die dem
Marburger Neukantianismus nahestehen, wenn er sie auch in begrifflichen Formu-
lierungen wiedergibt, wie sie vom Husserlschen Idealismus geprägt sind. Die
schöpferische synthetische Konstituierung des Gegenstandes, wie sie O. aufzeigt,
trägt im Wesentlichen neukantische Züge. Es ist bezeichnend hierfür, daß sich
immer dort, wo er nach treffenden Charakterisierungen der den Gegenstand aus
der Stimmung heraus schaffenden Funktionen sucht, ihm vor allem Cohensche For-
mulierungen dafür geeignet erscheinen.
Weniger gelungen als der Vorstoß ins Prinzipielle erscheint mir bei O. die
Durchanalysierung der Grundlagen wie auch die Schilderung des Prozesses, der
von der Stimmung durch die schöpferische Aktivität zum Kunstwerk hinführt.
Hierfür ist wohl weniger O. verantwortlich zu machen, als der gegenwärtige Stand
der Analyse der seelischen Struktur. Die Zeit ist noch nicht lange vorüber, daß
man bei der Analyse der Gefühle bloße Lust - Unlust als einzige Gefühlsbestand-
teile anerkennen wollte; aber auch heute noch bietet für so differenzierte Probleme,
wie sie O. anfaßt, weder die Psychologie noch die vorhandene Analyse der Konsti-
tution des Gegenstandes eine ausreichende Hilfe. So trägt zwar die sehr material-