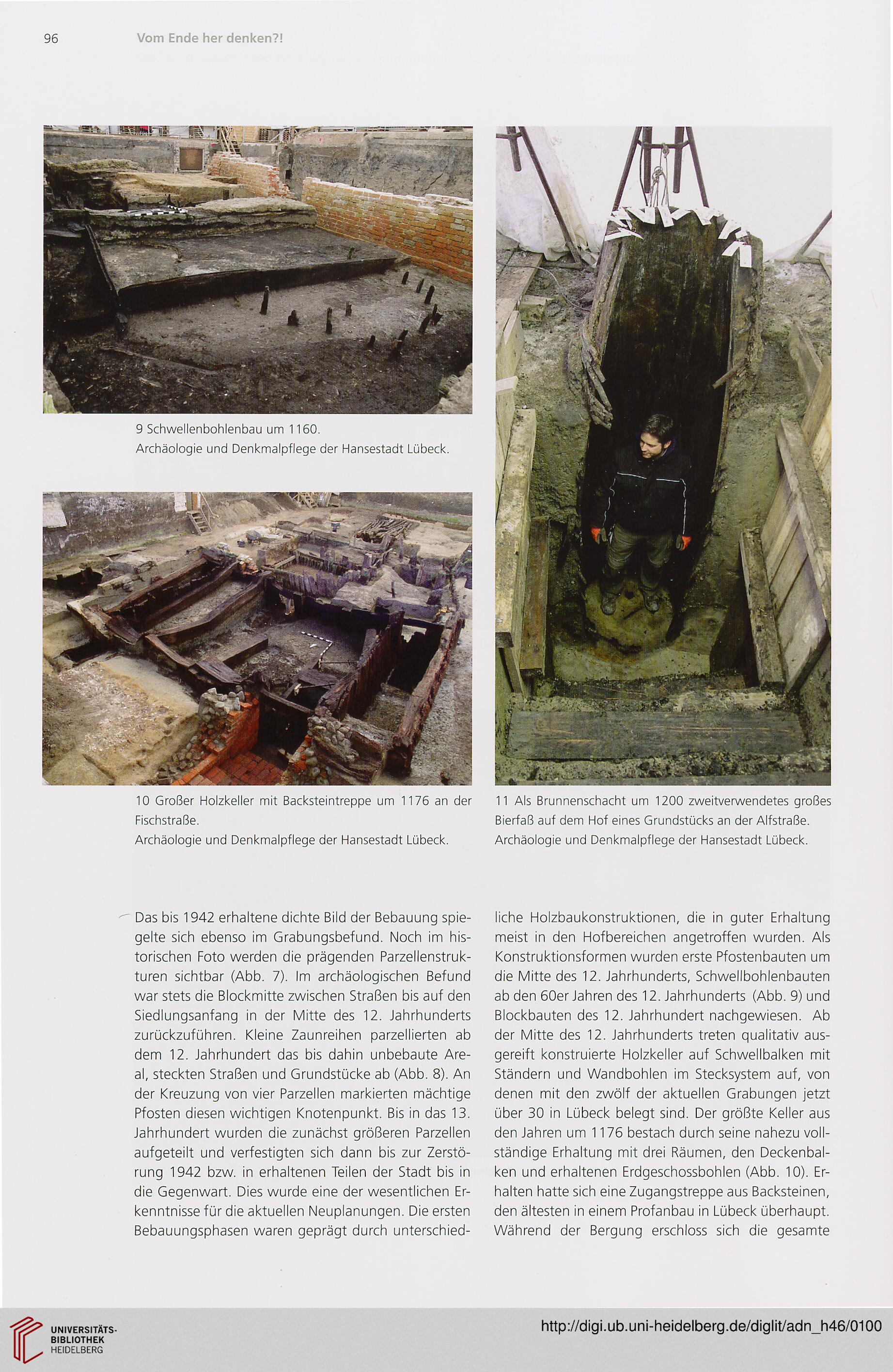96
Vom Ende her denken?!
9 Schwellenbohlenbau um 1160.
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.
10 Großer Holzkeller mit Backsteintreppe um 1176 an der
Fischstraße.
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.
11 Als Brunnenschacht um 1200 zweitverwendetes großes
Bierfaß auf dem Hof eines Grundstücks an der Alfstraße.
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.
" Das bis 1942 erhaltene dichte Bild der Bebauung spie-
gelte sich ebenso im Grabungsbefund. Noch im his-
torischen Foto werden die prägenden Parzellenstruk-
turen sichtbar (Abb. 7). Im archäologischen Befund
war stets die Blockmitte zwischen Straßen bis auf den
Siedlungsanfang in der Mitte des 12. Jahrhunderts
zurückzuführen. Kleine Zaunreihen parzellierten ab
dem 12. Jahrhundert das bis dahin unbebaute Are-
al, steckten Straßen und Grundstücke ab (Abb. 8). An
der Kreuzung von vier Parzellen markierten mächtige
Pfosten diesen wichtigen Knotenpunkt. Bis in das 13.
Jahrhundert wurden die zunächst größeren Parzellen
aufgeteilt und verfestigten sich dann bis zur Zerstö-
rung 1942 bzw. in erhaltenen Teilen der Stadt bis in
die Gegenwart. Dies wurde eine der wesentlichen Er-
kenntnisse für die aktuellen Neuplanungen. Die ersten
Bebauungsphasen waren geprägt durch unterschied-
liche Holzbaukonstruktionen, die in guter Erhaltung
meist in den Hofbereichen angetroffen wurden. Als
Konstruktionsformen wurden erste Pfostenbauten um
die Mitte des 12. Jahrhunderts, Schwellbohlenbauten
ab den 60er Jahren des 12. Jahrhunderts (Abb. 9) und
Blockbauten des 12. Jahrhundert nachgewiesen. Ab
der Mitte des 12. Jahrhunderts treten qualitativ aus-
gereift konstruierte Holzkeller auf Schwellbalken mit
Ständern und Wandbohlen im Stecksystem auf, von
denen mit den zwölf der aktuellen Grabungen jetzt
über 30 in Lübeck belegt sind. Der größte Keller aus
den Jahren um 1176 bestach durch seine nahezu voll-
ständige Erhaltung mit drei Räumen, den Deckenbal-
ken und erhaltenen Erdgeschossbohlen (Abb. 10). Er-
halten hatte sich eine Zugangstreppe aus Backsteinen,
den ältesten in einem Profanbau in Lübeck überhaupt.
Während der Bergung erschloss sich die gesamte
Vom Ende her denken?!
9 Schwellenbohlenbau um 1160.
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.
10 Großer Holzkeller mit Backsteintreppe um 1176 an der
Fischstraße.
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.
11 Als Brunnenschacht um 1200 zweitverwendetes großes
Bierfaß auf dem Hof eines Grundstücks an der Alfstraße.
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt Lübeck.
" Das bis 1942 erhaltene dichte Bild der Bebauung spie-
gelte sich ebenso im Grabungsbefund. Noch im his-
torischen Foto werden die prägenden Parzellenstruk-
turen sichtbar (Abb. 7). Im archäologischen Befund
war stets die Blockmitte zwischen Straßen bis auf den
Siedlungsanfang in der Mitte des 12. Jahrhunderts
zurückzuführen. Kleine Zaunreihen parzellierten ab
dem 12. Jahrhundert das bis dahin unbebaute Are-
al, steckten Straßen und Grundstücke ab (Abb. 8). An
der Kreuzung von vier Parzellen markierten mächtige
Pfosten diesen wichtigen Knotenpunkt. Bis in das 13.
Jahrhundert wurden die zunächst größeren Parzellen
aufgeteilt und verfestigten sich dann bis zur Zerstö-
rung 1942 bzw. in erhaltenen Teilen der Stadt bis in
die Gegenwart. Dies wurde eine der wesentlichen Er-
kenntnisse für die aktuellen Neuplanungen. Die ersten
Bebauungsphasen waren geprägt durch unterschied-
liche Holzbaukonstruktionen, die in guter Erhaltung
meist in den Hofbereichen angetroffen wurden. Als
Konstruktionsformen wurden erste Pfostenbauten um
die Mitte des 12. Jahrhunderts, Schwellbohlenbauten
ab den 60er Jahren des 12. Jahrhunderts (Abb. 9) und
Blockbauten des 12. Jahrhundert nachgewiesen. Ab
der Mitte des 12. Jahrhunderts treten qualitativ aus-
gereift konstruierte Holzkeller auf Schwellbalken mit
Ständern und Wandbohlen im Stecksystem auf, von
denen mit den zwölf der aktuellen Grabungen jetzt
über 30 in Lübeck belegt sind. Der größte Keller aus
den Jahren um 1176 bestach durch seine nahezu voll-
ständige Erhaltung mit drei Räumen, den Deckenbal-
ken und erhaltenen Erdgeschossbohlen (Abb. 10). Er-
halten hatte sich eine Zugangstreppe aus Backsteinen,
den ältesten in einem Profanbau in Lübeck überhaupt.
Während der Bergung erschloss sich die gesamte