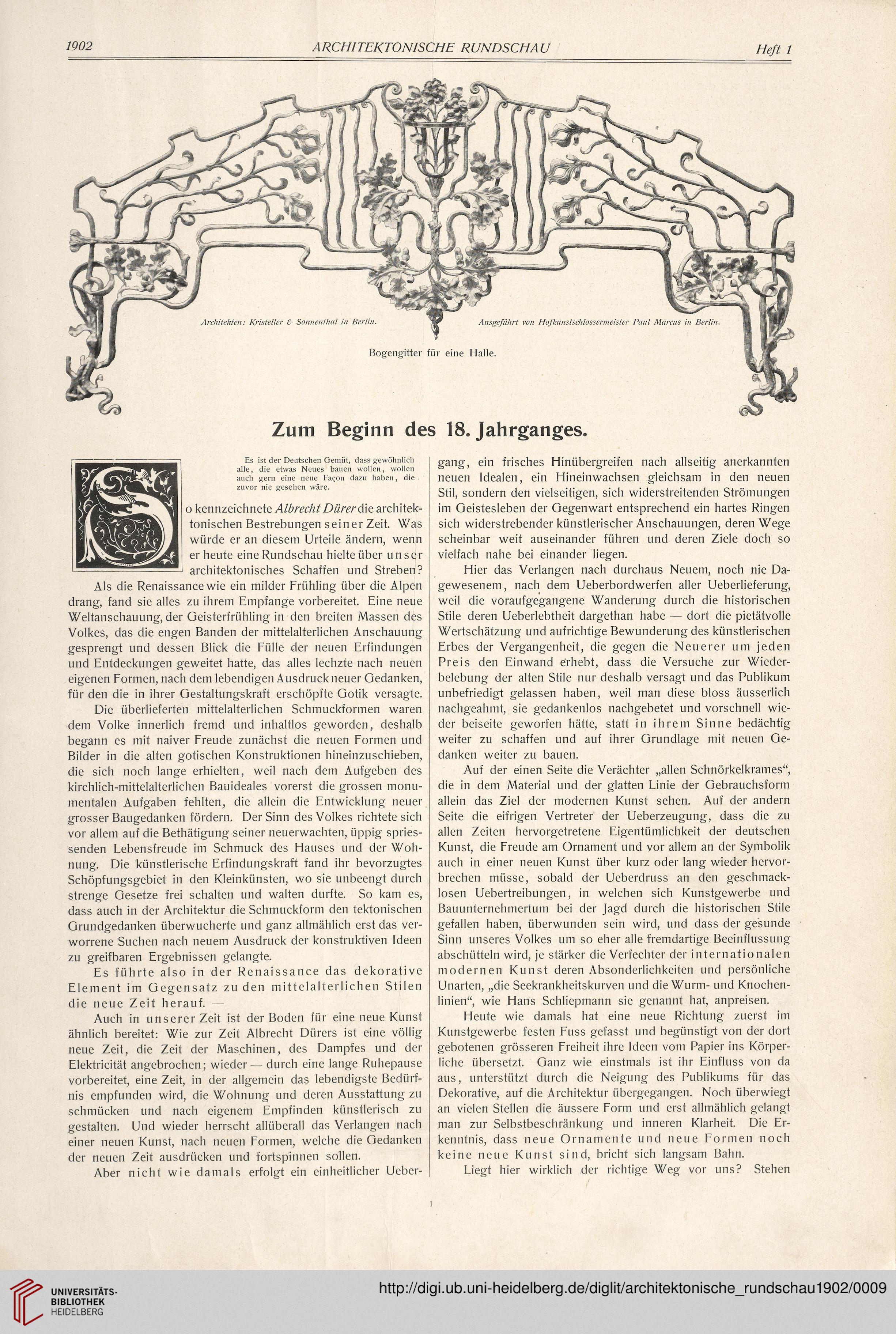1902
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 1
Es ist der Deutschen Gemüt, dass gewöhnlich
alle, die etwas Neues bauen wollen, wollen
auch gern eine neue Facon dazu haben, die
zuvor nie gesehen wäre.
o kennzeichnete Albrecht Dürer die architek-
tonischen Bestrebungen seiner Zeit. Was
würde er an diesem Urteile ändern, wenn
er heute eine Rundschau hielte über unser
architektonisches Schaffen und Streben?
Als die Renaissance wie ein milder Frühling über die Alpen
drang, fand sie alles zu ihrem Empfange vorbereitet. Eine neue
Weltanschauung, der Geisterfrühling in den breiten Massen des
Volkes, das die engen Banden der mittelalterlichen Anschauung
gesprengt und dessen Blick die Fülle der neuen Erfindungen
und Entdeckungen geweitet hatte, das alles lechzte nach neuen
eigenen Formen, nach dem lebendigen Ausdruck neuer Gedanken,
für den die in ihrer Gestaltungskraft erschöpfte Gotik versagte.
Die überlieferten mittelalterlichen Schmuckformen waren
dem Volke innerlich fremd und inhaltlos geworden, deshalb
begann es mit naiver Freude zunächst die neuen Formen und
Bilder in die alten gotischen Konstruktionen hineinzuschieben,
die sich noch lange erhielten, weil nach dem Aufgeben des
kirchlich-mittelalterlichen Bauideales vorerst die grossen monu-
mentalen Aufgaben fehlten, die allein die Entwicklung neuer
grosser Baugedanken fördern. Der Sinn des Volkes richtete sich
vor allem auf die Bethätigung seiner neuerwachten, üppig spries-
senden Lebensfreude im Schmuck des Hauses und der Woh-
nung. Die künstlerische Erfindungskraft fand ihr bevorzugtes
Schöpfungsgebiet in den Kleinkünsten, wo sie unbeengt durch
strenge Gesetze frei schalten und walten durfte. So kam es,
dass auch in der Architektur die Schmuckform den tektonischen
Grundgedanken überwucherte und ganz allmählich erst das ver-
worrene Suchen nach neuem Ausdruck der konstruktiven Ideen
zu greifbaren Ergebnissen gelangte.
Es führte also in der Renaissance das dekorative
Element im Gegensatz zu den mittelalterlichen Stilen
die neue Zeit herauf. —
Auch in unserer Zeit ist der Boden für eine neue Kunst
ähnlich bereitet: Wie zur Zeit Albrecht Dürers ist eine völlig
neue Zeit, die Zeit der Maschinen, des Dampfes und der
Elektricität angebrochen; wieder — durch eine lange Ruhepause
vorbereitet, eine Zeit, in der allgemein das lebendigste Bedürf-
nis empfunden wird, die Wohnung und deren Ausstattung zu
schmücken und nach eigenem Empfinden künstlerisch zu
gestalten. Und wieder herrscht allüberall das Verlangen nach
einer neuen Kunst, nach neuen Formen, welche die Gedanken
der neuen Zeit ausdrücken und fortspinnen sollen.
Aber nicht wie damals erfolgt ein einheitlicher Ueber-
gang, ein frisches Hinübergreifen nach allseitig anerkannten
neuen Idealen, ein Hineinwachsen gleichsam in den neuen
Stil, sondern den vielseitigen, sich widerstreitenden Strömungen
im Geistesleben der Gegenwart entsprechend ein hartes Ringen
sich widerstrebender künstlerischer Anschauungen, deren Wege
scheinbar weit auseinander führen und deren Ziele doch so
vielfach nahe bei einander liegen.
Hier das Verlangen nach durchaus Neuem, noch nie Da-
gewesenem, nach dem Ueberbordwerfen aller Ueberlieferung,
weil die voraufgegangene Wanderung durch die historischen
Stile deren Ueberlebtheit dargethan habe dort die pietätvolle
Wertschätzung und aufrichtige Bewunderung des künstlerischen
Erbes der Vergangenheit, die gegen die Neuerer um jeden
Preis den Einwand erhebt, dass die Versuche zur Wieder-
belebung der alten Stile nur deshalb versagt und das Publikum
unbefriedigt gelassen haben, weil man diese bloss äusserlich
nachgeahmt, sie gedankenlos nachgebetet und vorschnell wie-
der beiseite geworfen hätte, statt in ihrem Sinne bedächtig
weiter zu schaffen und auf ihrer Grundlage mit neuen Ge-
danken weiter zu bauen.
Auf der einen Seite die Verächter „allen Schnörkelkrames“,
die in dem Material und der glatten Linie der Gebrauchsform
allein das Ziel der modernen Kunst sehen. Auf der andern
Seite die eifrigen Vertreter der Ueberzeugung, dass die zu
allen Zeiten hervorgetretene Eigentümlichkeit der deutschen
Kunst, die Freude am Ornament und vor allem an der Symbolik
auch in einer neuen Kunst über kurz oder lang wieder hervor-
brechen müsse, sobald der Ueberdruss an den geschmack-
losen Uebertreibungen, in welchen sich Kunstgewerbe und
Bauunternehmertum bei der Jagd durch die historischen Stile
gefallen haben, überwunden sein wird, und dass der gesunde
Sinn unseres Volkes um so eher alle fremdartige Beeinflussung
abschütteln wird, je stärker die Verfechter der internationalen
modernen Kunst deren Absonderlichkeiten und persönliche
Unarten, „die Seekrankheitskurven und die Wurm- und Knochen-
linien“, wie Hans Schliepmann sie genannt hat, anpreisen.
Heute wie damals hat eine neue Richtung zuerst im
Kunstgewerbe festen Fuss gefasst und begünstigt von der dort
gebotenen grösseren Freiheit ihre Ideen vom Papier ins Körper-
liche übersetzt. Ganz wie einstmals ist ihr Einfluss von da
aus, unterstützt durch die Neigung des Publikums für das
Dekorative, auf die Architektur übergegangen. Noch überwiegt
an vielen Stellen die äussere Form und erst allmählich gelangt
man zur Selbstbeschränkung und inneren Klarheit. Die Er-
kenntnis, dass neue Ornamente und neue Formen noch
keine neue Kunst sind, bricht sich langsam Bahn.
Liegt hier wirklich der richtige Weg vor uns? Stehen
i
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 1
Es ist der Deutschen Gemüt, dass gewöhnlich
alle, die etwas Neues bauen wollen, wollen
auch gern eine neue Facon dazu haben, die
zuvor nie gesehen wäre.
o kennzeichnete Albrecht Dürer die architek-
tonischen Bestrebungen seiner Zeit. Was
würde er an diesem Urteile ändern, wenn
er heute eine Rundschau hielte über unser
architektonisches Schaffen und Streben?
Als die Renaissance wie ein milder Frühling über die Alpen
drang, fand sie alles zu ihrem Empfange vorbereitet. Eine neue
Weltanschauung, der Geisterfrühling in den breiten Massen des
Volkes, das die engen Banden der mittelalterlichen Anschauung
gesprengt und dessen Blick die Fülle der neuen Erfindungen
und Entdeckungen geweitet hatte, das alles lechzte nach neuen
eigenen Formen, nach dem lebendigen Ausdruck neuer Gedanken,
für den die in ihrer Gestaltungskraft erschöpfte Gotik versagte.
Die überlieferten mittelalterlichen Schmuckformen waren
dem Volke innerlich fremd und inhaltlos geworden, deshalb
begann es mit naiver Freude zunächst die neuen Formen und
Bilder in die alten gotischen Konstruktionen hineinzuschieben,
die sich noch lange erhielten, weil nach dem Aufgeben des
kirchlich-mittelalterlichen Bauideales vorerst die grossen monu-
mentalen Aufgaben fehlten, die allein die Entwicklung neuer
grosser Baugedanken fördern. Der Sinn des Volkes richtete sich
vor allem auf die Bethätigung seiner neuerwachten, üppig spries-
senden Lebensfreude im Schmuck des Hauses und der Woh-
nung. Die künstlerische Erfindungskraft fand ihr bevorzugtes
Schöpfungsgebiet in den Kleinkünsten, wo sie unbeengt durch
strenge Gesetze frei schalten und walten durfte. So kam es,
dass auch in der Architektur die Schmuckform den tektonischen
Grundgedanken überwucherte und ganz allmählich erst das ver-
worrene Suchen nach neuem Ausdruck der konstruktiven Ideen
zu greifbaren Ergebnissen gelangte.
Es führte also in der Renaissance das dekorative
Element im Gegensatz zu den mittelalterlichen Stilen
die neue Zeit herauf. —
Auch in unserer Zeit ist der Boden für eine neue Kunst
ähnlich bereitet: Wie zur Zeit Albrecht Dürers ist eine völlig
neue Zeit, die Zeit der Maschinen, des Dampfes und der
Elektricität angebrochen; wieder — durch eine lange Ruhepause
vorbereitet, eine Zeit, in der allgemein das lebendigste Bedürf-
nis empfunden wird, die Wohnung und deren Ausstattung zu
schmücken und nach eigenem Empfinden künstlerisch zu
gestalten. Und wieder herrscht allüberall das Verlangen nach
einer neuen Kunst, nach neuen Formen, welche die Gedanken
der neuen Zeit ausdrücken und fortspinnen sollen.
Aber nicht wie damals erfolgt ein einheitlicher Ueber-
gang, ein frisches Hinübergreifen nach allseitig anerkannten
neuen Idealen, ein Hineinwachsen gleichsam in den neuen
Stil, sondern den vielseitigen, sich widerstreitenden Strömungen
im Geistesleben der Gegenwart entsprechend ein hartes Ringen
sich widerstrebender künstlerischer Anschauungen, deren Wege
scheinbar weit auseinander führen und deren Ziele doch so
vielfach nahe bei einander liegen.
Hier das Verlangen nach durchaus Neuem, noch nie Da-
gewesenem, nach dem Ueberbordwerfen aller Ueberlieferung,
weil die voraufgegangene Wanderung durch die historischen
Stile deren Ueberlebtheit dargethan habe dort die pietätvolle
Wertschätzung und aufrichtige Bewunderung des künstlerischen
Erbes der Vergangenheit, die gegen die Neuerer um jeden
Preis den Einwand erhebt, dass die Versuche zur Wieder-
belebung der alten Stile nur deshalb versagt und das Publikum
unbefriedigt gelassen haben, weil man diese bloss äusserlich
nachgeahmt, sie gedankenlos nachgebetet und vorschnell wie-
der beiseite geworfen hätte, statt in ihrem Sinne bedächtig
weiter zu schaffen und auf ihrer Grundlage mit neuen Ge-
danken weiter zu bauen.
Auf der einen Seite die Verächter „allen Schnörkelkrames“,
die in dem Material und der glatten Linie der Gebrauchsform
allein das Ziel der modernen Kunst sehen. Auf der andern
Seite die eifrigen Vertreter der Ueberzeugung, dass die zu
allen Zeiten hervorgetretene Eigentümlichkeit der deutschen
Kunst, die Freude am Ornament und vor allem an der Symbolik
auch in einer neuen Kunst über kurz oder lang wieder hervor-
brechen müsse, sobald der Ueberdruss an den geschmack-
losen Uebertreibungen, in welchen sich Kunstgewerbe und
Bauunternehmertum bei der Jagd durch die historischen Stile
gefallen haben, überwunden sein wird, und dass der gesunde
Sinn unseres Volkes um so eher alle fremdartige Beeinflussung
abschütteln wird, je stärker die Verfechter der internationalen
modernen Kunst deren Absonderlichkeiten und persönliche
Unarten, „die Seekrankheitskurven und die Wurm- und Knochen-
linien“, wie Hans Schliepmann sie genannt hat, anpreisen.
Heute wie damals hat eine neue Richtung zuerst im
Kunstgewerbe festen Fuss gefasst und begünstigt von der dort
gebotenen grösseren Freiheit ihre Ideen vom Papier ins Körper-
liche übersetzt. Ganz wie einstmals ist ihr Einfluss von da
aus, unterstützt durch die Neigung des Publikums für das
Dekorative, auf die Architektur übergegangen. Noch überwiegt
an vielen Stellen die äussere Form und erst allmählich gelangt
man zur Selbstbeschränkung und inneren Klarheit. Die Er-
kenntnis, dass neue Ornamente und neue Formen noch
keine neue Kunst sind, bricht sich langsam Bahn.
Liegt hier wirklich der richtige Weg vor uns? Stehen
i