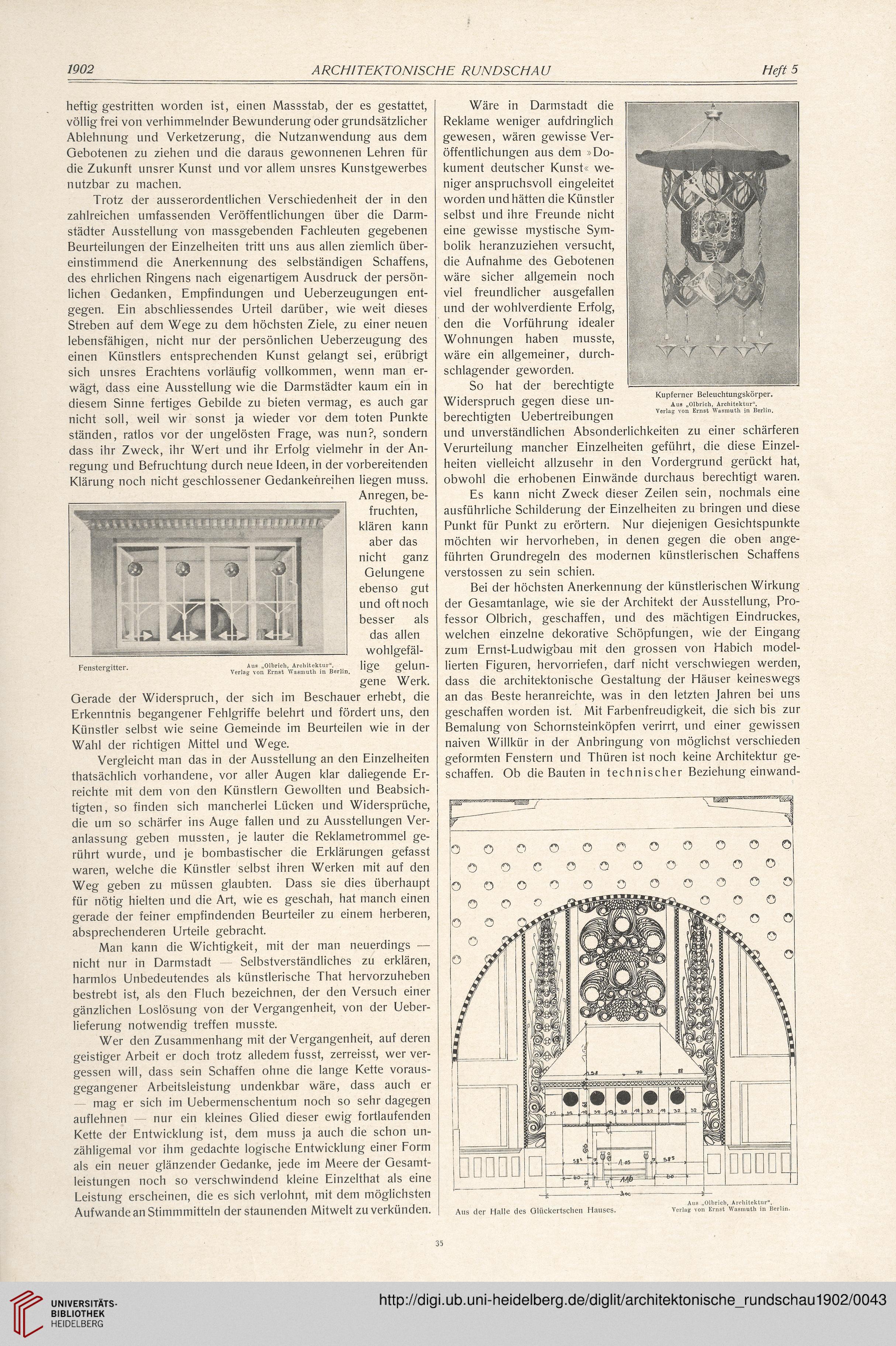1Q02
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 5
heftig gestritten worden ist, einen Massstab, der es gestattet,
völlig frei von verhimmelnder Bewunderung oder grundsätzlicher
Ablehnung und Verketzerung, die Nutzanwendung aus dem
Gebotenen zu ziehen und die daraus gewonnenen Lehren für
die Zukunft unsrer Kunst und vor allem unsres Kunstgewerbes
nutzbar zu machen.
Trotz der ausserordentlichen Verschiedenheit der in den
zahlreichen umfassenden Veröffentlichungen über die Darm-
städter Ausstellung von massgebenden Fachleuten gegebenen
Beurteilungen der Einzelheiten tritt uns aus allen ziemlich über-
einstimmend die Anerkennung des selbständigen Schaffens,
des ehrlichen Ringens nach eigenartigem Ausdruck der persön-
lichen Gedanken, Empfindungen und Ueberzeugungen ent-
gegen. Ein abschliessendes Urteil darüber, wie weit dieses
Streben auf dem Wege zu dem höchsten Ziele, zu einer neuen
lebensfähigen, nicht nur der persönlichen Ueberzeugung des
einen Künstlers entsprechenden Kunst gelangt sei, erübrigt
sich unsres Erachtens vorläufig vollkommen, wenn man er-
wägt, dass eine Ausstellung wie die Darmstädter kaum ein in
diesem Sinne fertiges Gebilde zu bieten vermag, es auch gar
nicht soll, weil wir sonst ja wieder vor dem toten Punkte
ständen, ratlos vor der ungelösten Frage, was nun?, sondern
dass ihr Zweck, ihr Wert und ihr Erfolg vielmehr in der An-
regung und Befruchtung durch neue Ideen, in der vorbereitenden
Klärung noch nicht geschlossener Gedankenreihen liegen muss.
Anregen, be-
fruchten,
klären kann
aber das
nicht ganz
Gelungene
ebenso gut
und oft noch
besser als
das allen
wohlgefäl-
lige gelun-
gene Werk.
Gerade der Widerspruch, der sich im Beschauer erhebt, die
Erkenntnis begangener Fehlgriffe belehrt und fördert uns, den
Künstler selbst wie seine Gemeinde im Beurteilen wie in der
Wahl der richtigen Mittel und Wege.
Vergleicht man das in der Ausstellung an den Einzelheiten
thatsächlich vorhandene, vor aller Augen klar daliegende Er-
reichte mit dem von den Künstlern Gewollten und Beabsich-
tigten, so finden sich mancherlei Lücken und Widersprüche,
die um so schärfer ins Auge fallen und zu Ausstellungen Ver-
anlassung geben mussten, je lauter die Reklametrommel ge-
rührt wurde, und je bombastischer die Erklärungen gefasst
waren, welche die Künstler selbst ihren Werken mit auf den
Weg geben zu müssen glaubten. Dass sie dies überhaupt
für nötig hielten und die Art, wie es geschah, hat manch einen
gerade der feiner empfindenden Beurteiler zu einem herberen,
absprechenderen Urteile gebracht.
Man kann die Wichtigkeit, mit der man neuerdings —
nicht nur in Darmstadt Selbstverständliches zu erklären,
harmlos Unbedeutendes als künstlerische That hervorzuheben
bestrebt ist, als den Fluch bezeichnen, der den Versuch einer
gänzlichen Loslösung von der Vergangenheit, von der Ueber-
lieferung notwendig treffen musste.
Wer den Zusammenhang mit der Vergangenheit, auf deren
geistiger Arbeit er doch trotz alledem fusst, zerreisst, wer ver-
gessen will, dass sein Schaffen ohne die lange Kette voraus-
gegangener Arbeitsleistung undenkbar wäre, dass auch er
mag er sich im Uebermenschentum noch so sehr dagegen
auflehnen — nur ein kleines Glied dieser ewig fortlaufenden
Kette der Entwicklung ist, dem muss ja auch die schon un-
zähligemal vor ihm gedachte logische Entwicklung einer Form
als ein neuer glänzender Gedanke, jede im Meere der Gesamt-
leistungen noch so verschwindend kleine Einzelthat als eine
Leistung erscheinen, die es sich verlohnt, mit dem möglichsten
Aufwande an Stimmmitteln der staunenden Mitwelt zu verkünden.
Fenstergitter.
s „Olbrich, Architektur“,
on Ernst Wasmuth in B<
Wäre in Darmstadt die
Reklame weniger aufdringlich
gewesen, wären gewisse Ver¬
öffentlichungen aus dem »Do¬
kument deutscher Kunst« we¬
niger anspruchsvoll eingeleitet
worden und hätten die Künstler
selbst und ihre Freunde nicht
eine gewisse mystische Sym¬
bolik heranzuziehen versucht,
die Aufnahme des Gebotenen
wäre sicher allgemein noch
viel freundlicher ausgefallen
und der wohlverdiente Erfolg,
den die Vorführung idealer
Wohnungen haben musste,
wäre ein allgemeiner, durch¬
schlagender geworden.
So hat der berechtigte
Widerspruch gegen diese un¬
berechtigten Uebertreibungen
und unverständlichen Absonderlichkeiten zu einer schärferen
Verurteilung mancher Einzelheiten geführt, die diese Einzel-
heiten vielleicht allzusehr in den Vordergrund gerückt hat,
obwohl die erhobenen Einwände durchaus berechtigt waren.
Es kann nicht Zweck dieser Zeilen sein, nochmals eine
ausführliche Schilderung der Einzelheiten zu bringen und diese
Punkt für Punkt zu erörtern. Nur diejenigen Gesichtspunkte
möchten wir hervorheben, in denen gegen die oben ange-
führten Grundregeln des modernen künstlerischen Schaffens
verstossen zu sein schien.
Bei der höchsten Anerkennung der künstlerischen Wirkung
der Gesamtanlage, wie sie der Architekt der Ausstellung, Pro-
fessor Olbrich, geschaffen, und des mächtigen Eindruckes,
welchen einzelne dekorative Schöpfungen, wie der Eingang
zum Ernst-Ludwigbau mit den grossen von Habich model-
lierten Figuren, hervorriefen, darf nicht verschwiegen werden,
dass die architektonische Gestaltung der Häuser keineswegs
an das Beste heranreichte, was in den letzten Jahren bei uns
geschaffen worden ist. Mit Farbenfreudigkeit, die sich bis zur
Bemalung von Schornsteinköpfen verirrt, und einer gewissen
naiven Willkür in der Anbringung von möglichst verschieden
geformten Fenstern und Thüren ist noch keine Architektur ge-
schaffen. Ob die Bauten in technischer Beziehung einwand-
Kupferner Beleuchtungskörper.
Aus „Olbrich, Architektur“.
Verlag von Ernst Wasmuth in Berlin.
35
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 5
heftig gestritten worden ist, einen Massstab, der es gestattet,
völlig frei von verhimmelnder Bewunderung oder grundsätzlicher
Ablehnung und Verketzerung, die Nutzanwendung aus dem
Gebotenen zu ziehen und die daraus gewonnenen Lehren für
die Zukunft unsrer Kunst und vor allem unsres Kunstgewerbes
nutzbar zu machen.
Trotz der ausserordentlichen Verschiedenheit der in den
zahlreichen umfassenden Veröffentlichungen über die Darm-
städter Ausstellung von massgebenden Fachleuten gegebenen
Beurteilungen der Einzelheiten tritt uns aus allen ziemlich über-
einstimmend die Anerkennung des selbständigen Schaffens,
des ehrlichen Ringens nach eigenartigem Ausdruck der persön-
lichen Gedanken, Empfindungen und Ueberzeugungen ent-
gegen. Ein abschliessendes Urteil darüber, wie weit dieses
Streben auf dem Wege zu dem höchsten Ziele, zu einer neuen
lebensfähigen, nicht nur der persönlichen Ueberzeugung des
einen Künstlers entsprechenden Kunst gelangt sei, erübrigt
sich unsres Erachtens vorläufig vollkommen, wenn man er-
wägt, dass eine Ausstellung wie die Darmstädter kaum ein in
diesem Sinne fertiges Gebilde zu bieten vermag, es auch gar
nicht soll, weil wir sonst ja wieder vor dem toten Punkte
ständen, ratlos vor der ungelösten Frage, was nun?, sondern
dass ihr Zweck, ihr Wert und ihr Erfolg vielmehr in der An-
regung und Befruchtung durch neue Ideen, in der vorbereitenden
Klärung noch nicht geschlossener Gedankenreihen liegen muss.
Anregen, be-
fruchten,
klären kann
aber das
nicht ganz
Gelungene
ebenso gut
und oft noch
besser als
das allen
wohlgefäl-
lige gelun-
gene Werk.
Gerade der Widerspruch, der sich im Beschauer erhebt, die
Erkenntnis begangener Fehlgriffe belehrt und fördert uns, den
Künstler selbst wie seine Gemeinde im Beurteilen wie in der
Wahl der richtigen Mittel und Wege.
Vergleicht man das in der Ausstellung an den Einzelheiten
thatsächlich vorhandene, vor aller Augen klar daliegende Er-
reichte mit dem von den Künstlern Gewollten und Beabsich-
tigten, so finden sich mancherlei Lücken und Widersprüche,
die um so schärfer ins Auge fallen und zu Ausstellungen Ver-
anlassung geben mussten, je lauter die Reklametrommel ge-
rührt wurde, und je bombastischer die Erklärungen gefasst
waren, welche die Künstler selbst ihren Werken mit auf den
Weg geben zu müssen glaubten. Dass sie dies überhaupt
für nötig hielten und die Art, wie es geschah, hat manch einen
gerade der feiner empfindenden Beurteiler zu einem herberen,
absprechenderen Urteile gebracht.
Man kann die Wichtigkeit, mit der man neuerdings —
nicht nur in Darmstadt Selbstverständliches zu erklären,
harmlos Unbedeutendes als künstlerische That hervorzuheben
bestrebt ist, als den Fluch bezeichnen, der den Versuch einer
gänzlichen Loslösung von der Vergangenheit, von der Ueber-
lieferung notwendig treffen musste.
Wer den Zusammenhang mit der Vergangenheit, auf deren
geistiger Arbeit er doch trotz alledem fusst, zerreisst, wer ver-
gessen will, dass sein Schaffen ohne die lange Kette voraus-
gegangener Arbeitsleistung undenkbar wäre, dass auch er
mag er sich im Uebermenschentum noch so sehr dagegen
auflehnen — nur ein kleines Glied dieser ewig fortlaufenden
Kette der Entwicklung ist, dem muss ja auch die schon un-
zähligemal vor ihm gedachte logische Entwicklung einer Form
als ein neuer glänzender Gedanke, jede im Meere der Gesamt-
leistungen noch so verschwindend kleine Einzelthat als eine
Leistung erscheinen, die es sich verlohnt, mit dem möglichsten
Aufwande an Stimmmitteln der staunenden Mitwelt zu verkünden.
Fenstergitter.
s „Olbrich, Architektur“,
on Ernst Wasmuth in B<
Wäre in Darmstadt die
Reklame weniger aufdringlich
gewesen, wären gewisse Ver¬
öffentlichungen aus dem »Do¬
kument deutscher Kunst« we¬
niger anspruchsvoll eingeleitet
worden und hätten die Künstler
selbst und ihre Freunde nicht
eine gewisse mystische Sym¬
bolik heranzuziehen versucht,
die Aufnahme des Gebotenen
wäre sicher allgemein noch
viel freundlicher ausgefallen
und der wohlverdiente Erfolg,
den die Vorführung idealer
Wohnungen haben musste,
wäre ein allgemeiner, durch¬
schlagender geworden.
So hat der berechtigte
Widerspruch gegen diese un¬
berechtigten Uebertreibungen
und unverständlichen Absonderlichkeiten zu einer schärferen
Verurteilung mancher Einzelheiten geführt, die diese Einzel-
heiten vielleicht allzusehr in den Vordergrund gerückt hat,
obwohl die erhobenen Einwände durchaus berechtigt waren.
Es kann nicht Zweck dieser Zeilen sein, nochmals eine
ausführliche Schilderung der Einzelheiten zu bringen und diese
Punkt für Punkt zu erörtern. Nur diejenigen Gesichtspunkte
möchten wir hervorheben, in denen gegen die oben ange-
führten Grundregeln des modernen künstlerischen Schaffens
verstossen zu sein schien.
Bei der höchsten Anerkennung der künstlerischen Wirkung
der Gesamtanlage, wie sie der Architekt der Ausstellung, Pro-
fessor Olbrich, geschaffen, und des mächtigen Eindruckes,
welchen einzelne dekorative Schöpfungen, wie der Eingang
zum Ernst-Ludwigbau mit den grossen von Habich model-
lierten Figuren, hervorriefen, darf nicht verschwiegen werden,
dass die architektonische Gestaltung der Häuser keineswegs
an das Beste heranreichte, was in den letzten Jahren bei uns
geschaffen worden ist. Mit Farbenfreudigkeit, die sich bis zur
Bemalung von Schornsteinköpfen verirrt, und einer gewissen
naiven Willkür in der Anbringung von möglichst verschieden
geformten Fenstern und Thüren ist noch keine Architektur ge-
schaffen. Ob die Bauten in technischer Beziehung einwand-
Kupferner Beleuchtungskörper.
Aus „Olbrich, Architektur“.
Verlag von Ernst Wasmuth in Berlin.
35