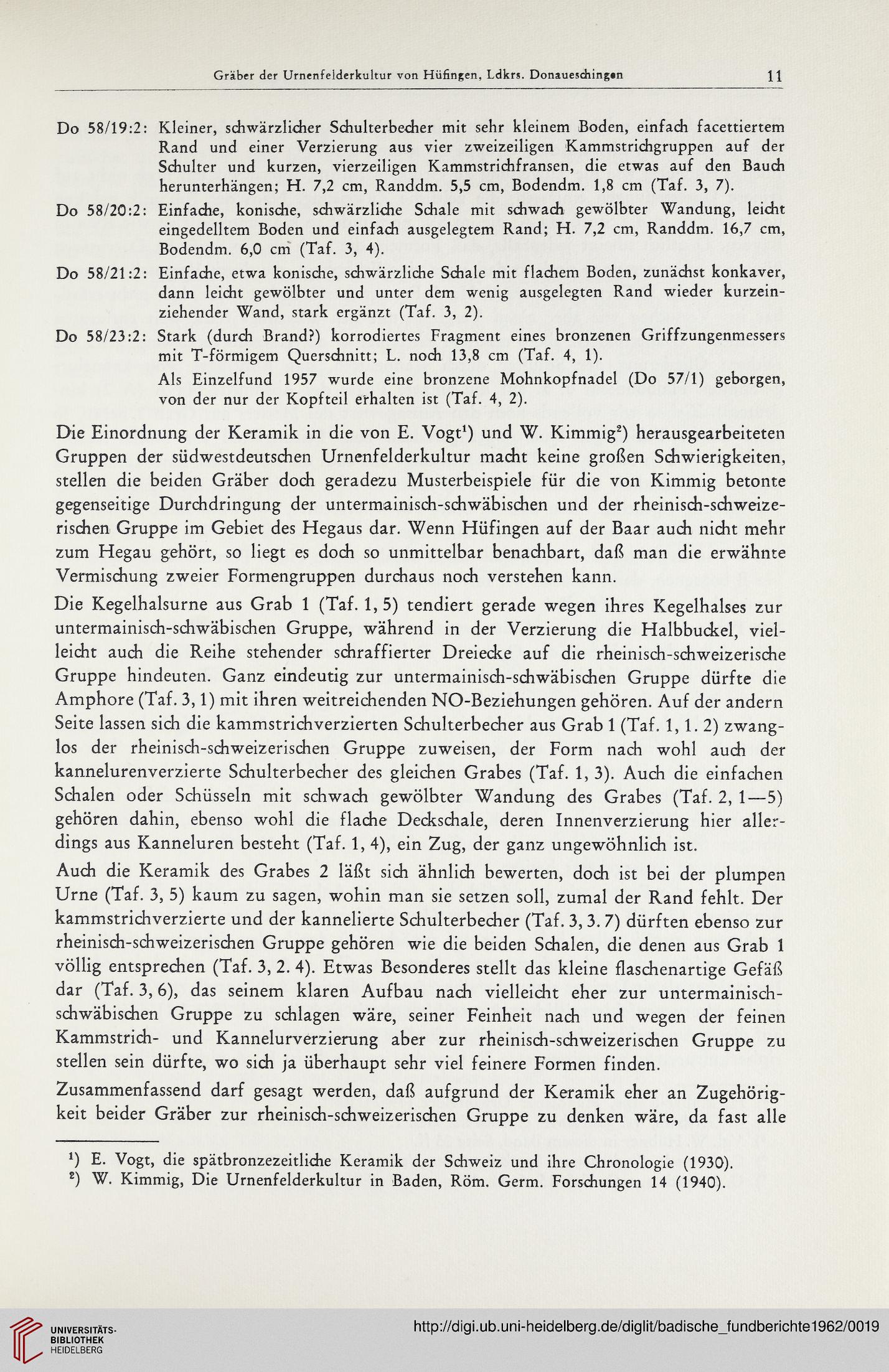Graber der Urnenfelderkultur von Hüfingen, Ldkrs. Donaueschingen
11
Do 58/19:2: Kleiner, schwärzlicher Schulterbecher mit sehr kleinem Boden, einfach facettiertem
Rand und einer Verzierung aus vier zweizeiligen Kammstrichgruppen auf der
Schulter und kurzen, vierzeiligen Kammstrichfransen, die etwas auf den Bauch
herunterhängen; H. 7,2 cm, Randdm. 5,5 cm, Bodendm. 1,8 cm (Taf. 3, 7).
Do 58/20:2: Einfache, konische, schwärzliche Schale mit schwach gewölbter Wandung, leicht
eingedelltem Boden und einfach ausgelegtem Rand; H. 7,2 cm, Randdm. 16,7 cm,
Bodendm. 6,0 cm (Taf. 3, 4).
Do 58/21:2: Einfache, etwa konische, schwärzliche Schale mit flachem Boden, zunächst konkaver,
dann leicht gewölbter und unter dem wenig ausgelegten Rand wieder kurzein-
ziehender Wand, stark ergänzt (Taf. 3, 2).
Do 58/23:2: Stark (durch Brand?) korrodiertes Fragment eines bronzenen Griffzungenmessers
mit T-förmigem Querschnitt; L. noch 13,8 cm (Taf. 4, 1).
Als Einzelfund 1957 wurde eine bronzene Mohnkopfnadel (Do 57/1) geborgen,
von der nur der Kopfteil erhalten ist (Taf. 4, 2).
Die Einordnung der Keramik in die von E. Vogt1) und W. Kimmig2) herausgearbeiteten
Gruppen der südwestdeutschen Urnenfelderkultur macht keine großen Schwierigkeiten,
stellen die beiden Gräber doch geradezu Musterbeispiele für die von Kimmig betonte
gegenseitige Durchdringung der untermainisch-schwäbischen und der rheinisch-schweize-
rischen Gruppe im Gebiet des Hegaus dar. Wenn Hüfingen auf der Baar auch nicht mehr
zum Hegau gehört, so liegt es doch so unmittelbar benachbart, daß man die erwähnte
Vermischung zweier Formengruppen durchaus noch verstehen kann.
Die Kegelhalsurne aus Grab 1 (Taf. 1, 5) tendiert gerade wegen ihres Kegelhalses zur
untermainisch-schwäbischen Gruppe, während in der Verzierung die Halbbuckel, viel-
leicht auch die Reihe stehender schraffierter Dreiecke auf die rheinisch-schweizerische
Gruppe hindeuten. Ganz eindeutig zur untermainisch-schwäbischen Gruppe dürfte die
Amphore (Taf. 3,1) mit ihren weitreichenden NO-Beziehungen gehören. Auf der andern
Seite lassen sich die kammstrichverzierten Schulterbecher aus Grab 1 (Taf. 1,1.2) zwang-
los der rheinisch-schweizerischen Gruppe zuweisen, der Form nach wohl auch der
kannelurenverzierte Schulterbecher des gleichen Grabes (Taf. 1, 3). Auch die einfachen
Schalen oder Schüsseln mit schwach gewölbter Wandung des Grabes (Taf. 2, 1—5)
gehören dahin, ebenso wohl die flache Deckschale, deren Innenverzierung hier aller-
dings aus Kanneluren besteht (Taf. 1, 4), ein Zug, der ganz ungewöhnlich ist.
Auch die Keramik des Grabes 2 läßt sich ähnlich bewerten, doch ist bei der plumpen
Urne (Taf. 3, 5) kaum zu sagen, wohin man sie setzen soll, zumal der Rand fehlt. Der
kammstrichverzierte und der kannelierte Schulterbecher (Taf. 3, 3. 7) dürften ebenso zur
rheinisch-schweizerischen Gruppe gehören wie die beiden Schalen, die denen aus Grab 1
völlig entsprechen (Taf. 3, 2. 4). Etwas Besonderes stellt das kleine flaschenartige Gefäß
dar (Taf. 3,6), das seinem klaren Aufbau nach vielleicht eher zur untermainisch-
schwäbischen Gruppe zu schlagen wäre, seiner Feinheit nach und wegen der feinen
Kammstrich- und Kannelurverzierung aber zur rheinisch-schweizerischen Gruppe zu
stellen sein dürfte, wo sich ja überhaupt sehr viel feinere Formen finden.
Zusammenfassend darf gesagt werden, daß aufgrund der Keramik eher an Zugehörig-
keit beider Gräber zur rheinisch-schweizerischen Gruppe zu denken wäre, da fast alle
*) E. Vogt, die spätbronzezeitliche Keramik der Schweiz und ihre Chronologie (1930).
2) W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden, Röm. Germ. Forschungen 14 (1940).
11
Do 58/19:2: Kleiner, schwärzlicher Schulterbecher mit sehr kleinem Boden, einfach facettiertem
Rand und einer Verzierung aus vier zweizeiligen Kammstrichgruppen auf der
Schulter und kurzen, vierzeiligen Kammstrichfransen, die etwas auf den Bauch
herunterhängen; H. 7,2 cm, Randdm. 5,5 cm, Bodendm. 1,8 cm (Taf. 3, 7).
Do 58/20:2: Einfache, konische, schwärzliche Schale mit schwach gewölbter Wandung, leicht
eingedelltem Boden und einfach ausgelegtem Rand; H. 7,2 cm, Randdm. 16,7 cm,
Bodendm. 6,0 cm (Taf. 3, 4).
Do 58/21:2: Einfache, etwa konische, schwärzliche Schale mit flachem Boden, zunächst konkaver,
dann leicht gewölbter und unter dem wenig ausgelegten Rand wieder kurzein-
ziehender Wand, stark ergänzt (Taf. 3, 2).
Do 58/23:2: Stark (durch Brand?) korrodiertes Fragment eines bronzenen Griffzungenmessers
mit T-förmigem Querschnitt; L. noch 13,8 cm (Taf. 4, 1).
Als Einzelfund 1957 wurde eine bronzene Mohnkopfnadel (Do 57/1) geborgen,
von der nur der Kopfteil erhalten ist (Taf. 4, 2).
Die Einordnung der Keramik in die von E. Vogt1) und W. Kimmig2) herausgearbeiteten
Gruppen der südwestdeutschen Urnenfelderkultur macht keine großen Schwierigkeiten,
stellen die beiden Gräber doch geradezu Musterbeispiele für die von Kimmig betonte
gegenseitige Durchdringung der untermainisch-schwäbischen und der rheinisch-schweize-
rischen Gruppe im Gebiet des Hegaus dar. Wenn Hüfingen auf der Baar auch nicht mehr
zum Hegau gehört, so liegt es doch so unmittelbar benachbart, daß man die erwähnte
Vermischung zweier Formengruppen durchaus noch verstehen kann.
Die Kegelhalsurne aus Grab 1 (Taf. 1, 5) tendiert gerade wegen ihres Kegelhalses zur
untermainisch-schwäbischen Gruppe, während in der Verzierung die Halbbuckel, viel-
leicht auch die Reihe stehender schraffierter Dreiecke auf die rheinisch-schweizerische
Gruppe hindeuten. Ganz eindeutig zur untermainisch-schwäbischen Gruppe dürfte die
Amphore (Taf. 3,1) mit ihren weitreichenden NO-Beziehungen gehören. Auf der andern
Seite lassen sich die kammstrichverzierten Schulterbecher aus Grab 1 (Taf. 1,1.2) zwang-
los der rheinisch-schweizerischen Gruppe zuweisen, der Form nach wohl auch der
kannelurenverzierte Schulterbecher des gleichen Grabes (Taf. 1, 3). Auch die einfachen
Schalen oder Schüsseln mit schwach gewölbter Wandung des Grabes (Taf. 2, 1—5)
gehören dahin, ebenso wohl die flache Deckschale, deren Innenverzierung hier aller-
dings aus Kanneluren besteht (Taf. 1, 4), ein Zug, der ganz ungewöhnlich ist.
Auch die Keramik des Grabes 2 läßt sich ähnlich bewerten, doch ist bei der plumpen
Urne (Taf. 3, 5) kaum zu sagen, wohin man sie setzen soll, zumal der Rand fehlt. Der
kammstrichverzierte und der kannelierte Schulterbecher (Taf. 3, 3. 7) dürften ebenso zur
rheinisch-schweizerischen Gruppe gehören wie die beiden Schalen, die denen aus Grab 1
völlig entsprechen (Taf. 3, 2. 4). Etwas Besonderes stellt das kleine flaschenartige Gefäß
dar (Taf. 3,6), das seinem klaren Aufbau nach vielleicht eher zur untermainisch-
schwäbischen Gruppe zu schlagen wäre, seiner Feinheit nach und wegen der feinen
Kammstrich- und Kannelurverzierung aber zur rheinisch-schweizerischen Gruppe zu
stellen sein dürfte, wo sich ja überhaupt sehr viel feinere Formen finden.
Zusammenfassend darf gesagt werden, daß aufgrund der Keramik eher an Zugehörig-
keit beider Gräber zur rheinisch-schweizerischen Gruppe zu denken wäre, da fast alle
*) E. Vogt, die spätbronzezeitliche Keramik der Schweiz und ihre Chronologie (1930).
2) W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden, Röm. Germ. Forschungen 14 (1940).