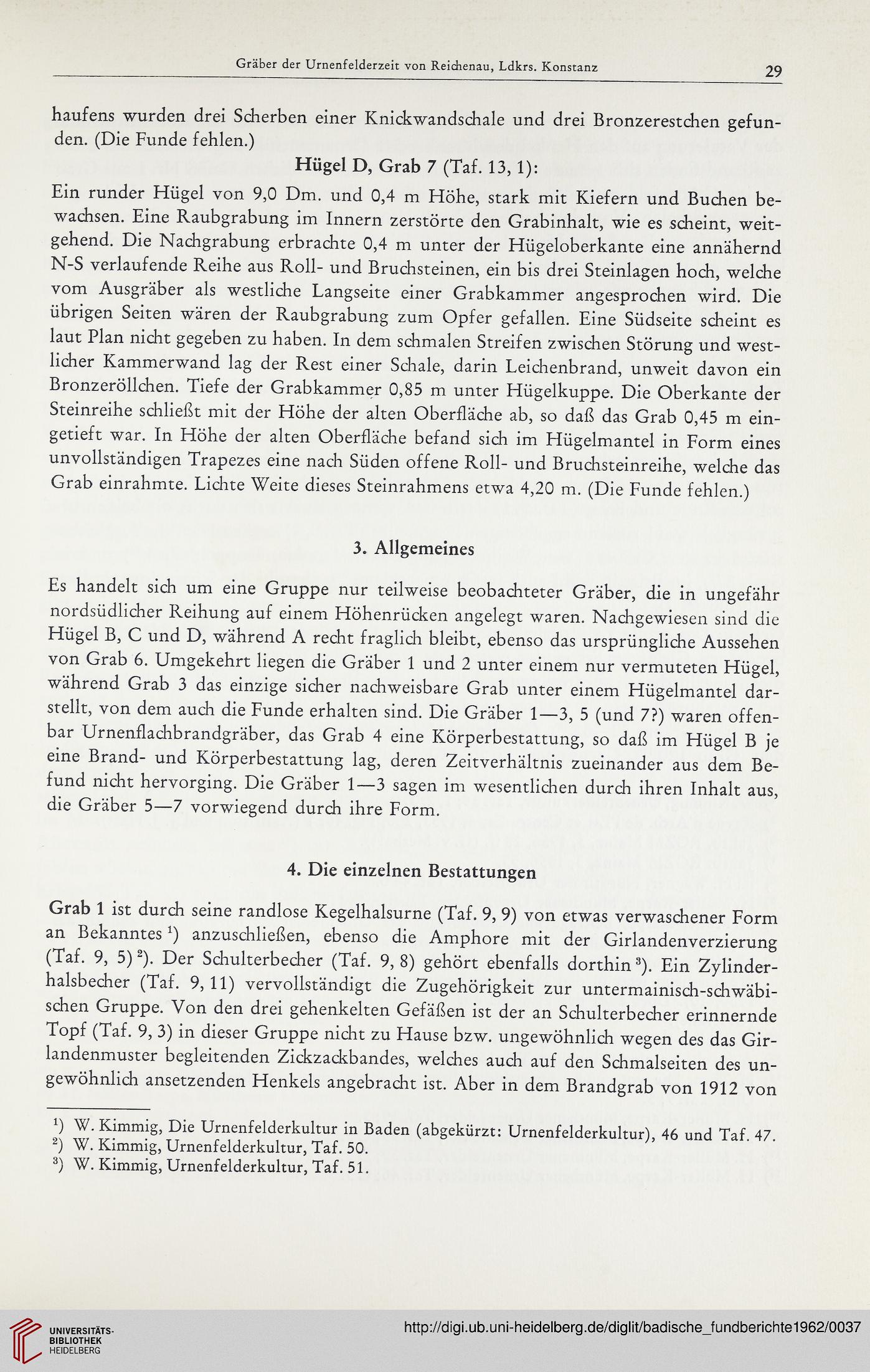Gräber der Urnenfelderzeit von Reichenau, Ldkrs. Konstanz
29
häufens wurden drei Scherben einer Knickwandschale und drei Bronzerestchen gefun-
den. (Die Funde fehlen.)
Hügel D, Grab 7 (Taf. 13, 1):
Ein runder Hügel von 9,0 Dm. und 0,4 m Höhe, stark mit Kiefern und Buchen be-
wachsen. Eine Raubgrabung im Innern zerstörte den Grabinhalt, wie es scheint, weit-
gehend. Die Nachgrabung erbrachte 0,4 m unter der Hügeloberkante eine annähernd
N-S verlaufende Reihe aus Roll- und Bruchsteinen, ein bis drei Steinlagen hoch, welche
vom Ausgräber als westliche Langseite einer Grabkammer angesprochen wird. Die
übrigen Seiten wären der Raubgrabung zum Opfer gefallen. Eine Südseite scheint es
laut Plan nicht gegeben zu haben. In dem schmalen Streifen zwischen Störung und west-
licher Kammerwand lag der Rest einer Schale, darin Leichenbrand, unweit davon ein
Bronzeröllchen. Tiefe der Grabkammer 0,85 m unter Hügelkuppe. Die Oberkante der
Steinreihe schließt mit der Höhe der alten Oberfläche ab, so daß das Grab 0,45 m ein-
getieft war. In Höhe der alten Oberfläche befand sich im Hügelmantel in Form eines
unvollständigen Trapezes eine nach Süden offene Roll- und Bruchsteinreihe, welche das
Grab einrahmte. Lichte Weite dieses Steinrahmens etwa 4,20 m. (Die Funde fehlen.)
3. Allgemeines
Es handelt sich um eine Gruppe nur teilweise beobachteter Gräber, die in ungefähr
nordsüdlicher Reihung auf einem Höhenrücken angelegt waren. Nachgewiesen sind die
Hügel B, C und D, während A recht fraglich bleibt, ebenso das ursprüngliche Aussehen
von Grab 6. Umgekehrt liegen die Gräber 1 und 2 unter einem nur vermuteten Hügel,
während Grab 3 das einzige sicher nachweisbare Grab unter einem Hügelmantel dar-
stellt, von dem auch die Funde erhalten sind. Die Gräber 1—3, 5 (und 7?) waren offen-
bar Urnenflachbrandgräber, das Grab 4 eine Körperbestattung, so daß im Hügel B je
eine Brand- und Körperbestattung lag, deren Zeitverhältnis zueinander aus dem Be-
fund nicht hervorging. Die Gräber 1—3 sagen im wesentlichen durch ihren Inhalt aus,
die Gräber 5—7 vorwiegend durch ihre Form.
4. Die einzelnen Bestattungen
Grab 1 ist durch seine randlose Kegelhalsurne (Taf. 9, 9) von etwas verwaschener Form
an Bekanntes*) anzuschließen, ebenso die Amphore mit der Girlandenverzierung
(Taf. 9, 5)* 2). Der Schulterbecher (Taf. 9, 8) gehört ebenfalls dorthin3). Ein Zylinder-
halsbecher (Taf. 9,11) vervollständigt die Zugehörigkeit zur untermainisch-schwäbi-
schen Gruppe. Von den drei gehenkelten Gefäßen ist der an Schulterbecher erinnernde
Topf (Taf. 9, 3) in dieser Gruppe nicht zu Hause bzw. ungewöhnlich wegen des das Gir-
landenmuster begleitenden Zickzackbandes, welches auch auf den Schmalseiten des un-
gewöhnlich ansetzenden Henkels angebracht ist. Aber in dem Brandgrab von 1912 von
J) W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden (abgekürzt: Urnenfelderkultur), 46 und Taf. 47.
2) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 50.
3) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 51.
29
häufens wurden drei Scherben einer Knickwandschale und drei Bronzerestchen gefun-
den. (Die Funde fehlen.)
Hügel D, Grab 7 (Taf. 13, 1):
Ein runder Hügel von 9,0 Dm. und 0,4 m Höhe, stark mit Kiefern und Buchen be-
wachsen. Eine Raubgrabung im Innern zerstörte den Grabinhalt, wie es scheint, weit-
gehend. Die Nachgrabung erbrachte 0,4 m unter der Hügeloberkante eine annähernd
N-S verlaufende Reihe aus Roll- und Bruchsteinen, ein bis drei Steinlagen hoch, welche
vom Ausgräber als westliche Langseite einer Grabkammer angesprochen wird. Die
übrigen Seiten wären der Raubgrabung zum Opfer gefallen. Eine Südseite scheint es
laut Plan nicht gegeben zu haben. In dem schmalen Streifen zwischen Störung und west-
licher Kammerwand lag der Rest einer Schale, darin Leichenbrand, unweit davon ein
Bronzeröllchen. Tiefe der Grabkammer 0,85 m unter Hügelkuppe. Die Oberkante der
Steinreihe schließt mit der Höhe der alten Oberfläche ab, so daß das Grab 0,45 m ein-
getieft war. In Höhe der alten Oberfläche befand sich im Hügelmantel in Form eines
unvollständigen Trapezes eine nach Süden offene Roll- und Bruchsteinreihe, welche das
Grab einrahmte. Lichte Weite dieses Steinrahmens etwa 4,20 m. (Die Funde fehlen.)
3. Allgemeines
Es handelt sich um eine Gruppe nur teilweise beobachteter Gräber, die in ungefähr
nordsüdlicher Reihung auf einem Höhenrücken angelegt waren. Nachgewiesen sind die
Hügel B, C und D, während A recht fraglich bleibt, ebenso das ursprüngliche Aussehen
von Grab 6. Umgekehrt liegen die Gräber 1 und 2 unter einem nur vermuteten Hügel,
während Grab 3 das einzige sicher nachweisbare Grab unter einem Hügelmantel dar-
stellt, von dem auch die Funde erhalten sind. Die Gräber 1—3, 5 (und 7?) waren offen-
bar Urnenflachbrandgräber, das Grab 4 eine Körperbestattung, so daß im Hügel B je
eine Brand- und Körperbestattung lag, deren Zeitverhältnis zueinander aus dem Be-
fund nicht hervorging. Die Gräber 1—3 sagen im wesentlichen durch ihren Inhalt aus,
die Gräber 5—7 vorwiegend durch ihre Form.
4. Die einzelnen Bestattungen
Grab 1 ist durch seine randlose Kegelhalsurne (Taf. 9, 9) von etwas verwaschener Form
an Bekanntes*) anzuschließen, ebenso die Amphore mit der Girlandenverzierung
(Taf. 9, 5)* 2). Der Schulterbecher (Taf. 9, 8) gehört ebenfalls dorthin3). Ein Zylinder-
halsbecher (Taf. 9,11) vervollständigt die Zugehörigkeit zur untermainisch-schwäbi-
schen Gruppe. Von den drei gehenkelten Gefäßen ist der an Schulterbecher erinnernde
Topf (Taf. 9, 3) in dieser Gruppe nicht zu Hause bzw. ungewöhnlich wegen des das Gir-
landenmuster begleitenden Zickzackbandes, welches auch auf den Schmalseiten des un-
gewöhnlich ansetzenden Henkels angebracht ist. Aber in dem Brandgrab von 1912 von
J) W. Kimmig, Die Urnenfelderkultur in Baden (abgekürzt: Urnenfelderkultur), 46 und Taf. 47.
2) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 50.
3) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 51.