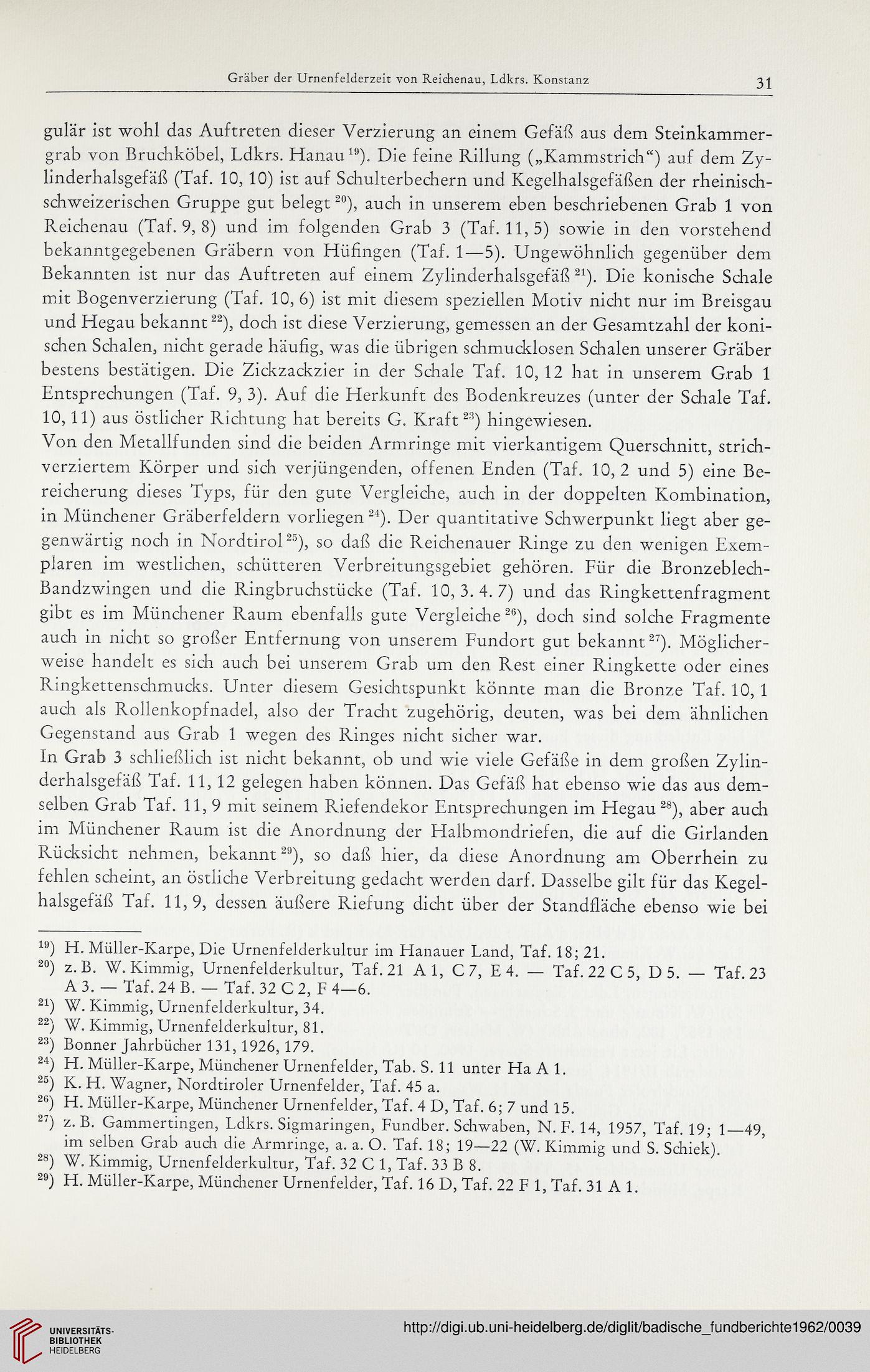Gräber der Urnenfelderzeit von Reichenau, Ldkrs. Konstanz
31
gulär ist wohl das Auftreten dieser Verzierung an einem Gefäß aus dem Steinkammer-
grab von Bruchköbel, Ldkrs. Hanau19). Die feine Rillung („Kammstrich“) auf dem Zy-
linderhalsgefäß (Taf. 10, 10) ist auf Schulterbechern und Kegelhalsgefäßen der rheinisch-
schweizerischen Gruppe gut belegt20), auch in unserem eben beschriebenen Grab 1 von
Reichenau (Taf. 9, 8) und im folgenden Grab 3 (Taf. 11,5) sowie in den vorstehend
bekanntgegebenen Gräbern von Hüfingen (Taf. 1—5). Ungewöhnlich gegenüber dem
Bekannten ist nur das Auftreten auf einem Zylinderhalsgefäß 21). Die konische Schale
mit Bogenverzierung (Taf. 10, 6) ist mit diesem speziellen Motiv nicht nur im Breisgau
und Hegau bekannt22), doch ist diese Verzierung, gemessen an der Gesamtzahl der koni-
schen Schalen, nicht gerade häufig, was die übrigen schmucklosen Schalen unserer Gräber
bestens bestätigen. Die Zickzackzier in der Schale Taf. 10, 12 hat in unserem Grab 1
Entsprechungen (Taf. 9, 3). Auf die Herkunft des Bodenkreuzes (unter der Schale Taf.
10,11) aus östlicher Richtung hat bereits G. Kraft23) hingewiesen.
Von den Metallfunden sind die beiden Armringe mit vierkantigem Querschnitt, strich-
verziertem Körper und sich verjüngenden, offenen Enden (Taf. 10, 2 und 5) eine Be-
reicherung dieses Typs, für den gute Vergleiche, auch in der doppelten Kombination,
in Münchener Gräberfeldern vorliegen 24). Der quantitative Schwerpunkt liegt aber ge-
genwärtig noch in Nordtirol25), so daß die Reichenauer Ringe zu den wenigen Exem-
plaren im westlichen, schütteren Verbreitungsgebiet gehören. Für die Bronzeblech-
Bandzwingen und die Ringbruchstücke (Taf. 10,3.4.7) und das Ringkettenfragment
gibt es im Münchener Raum ebenfalls gute Vergleiche 26), doch sind solche Fragmente
auch in nicht so großer Entfernung von unserem Fundort gut bekannt27). Möglicher-
weise handelt es sich auch bei unserem Grab um den Rest einer Ringkette oder eines
Ringkettenschmucks. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man die Bronze Taf. 10, 1
auch als Rollenkopfnadel, also der Tracht zugehörig, deuten, was bei dem ähnlichen
Gegenstand aus Grab 1 wegen des Ringes nicht sicher war.
In Grab 3 schließlich ist nicht bekannt, ob und wie viele Gefäße in dem großen Zylin-
derhalsgefäß Taf. 11, 12 gelegen haben können. Das Gefäß hat ebenso wie das aus dem-
selben Grab Taf. 11, 9 mit seinem Riefendekor Entsprechungen im Hegau28), aber auch
im Münchener Raum ist die Anordnung der Halbmondriefen, die auf die Girlanden
Rücksicht nehmen, bekannt29), so daß hier, da diese Anordnung am Oberrhein zu
fehlen scheint, an östliche Verbreitung gedacht werden darf. Dasselbe gilt für das Kegel-
halsgefäß Taf. 11,9, dessen äußere Riefung dicht über der Standfläche ebenso wie bei
19) H. Müller-Karpe, Die Urnenfelderkultur im Hanauer Land, Taf. 18; 21.
20) z.B. W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 21 Al, C 7, E 4. — Taf. 22 C 5, D 5. — Taf. 23
A 3. — Taf. 24 B. — Taf. 32 C 2, F 4—6.
21) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, 34.
22) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, 81.
23) Bonner Jahrbücher 131, 1926, 179.
24) H. Müller-Karpe, Münchener Urnenfelder, Tab. S. 11 unter Ha A 1.
25) K. H. Wagner, Nordtiroler Urnenfelder, Taf. 45 a.
26) H. Müller-Karpe, Münchener Urnenfelder, Taf. 4 D, Taf. 6; 7 und 15.
27) z.B. Gammertingen, Ldkrs. Sigmaringen, Fundber. Schwaben, N. F. 14, 1957, Taf. 19; 1—49,
im selben Grab auch die Armringe, a. a. O. Taf. 18; 19—22 (W. Kimmig und S. Schiek).
28) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 32 C 1, Taf. 33 B 8.
29) H. Müller-Karpe, Münchener Urnenfelder, Taf. 16 D, Taf. 22 F 1, Taf. 31 A 1.
31
gulär ist wohl das Auftreten dieser Verzierung an einem Gefäß aus dem Steinkammer-
grab von Bruchköbel, Ldkrs. Hanau19). Die feine Rillung („Kammstrich“) auf dem Zy-
linderhalsgefäß (Taf. 10, 10) ist auf Schulterbechern und Kegelhalsgefäßen der rheinisch-
schweizerischen Gruppe gut belegt20), auch in unserem eben beschriebenen Grab 1 von
Reichenau (Taf. 9, 8) und im folgenden Grab 3 (Taf. 11,5) sowie in den vorstehend
bekanntgegebenen Gräbern von Hüfingen (Taf. 1—5). Ungewöhnlich gegenüber dem
Bekannten ist nur das Auftreten auf einem Zylinderhalsgefäß 21). Die konische Schale
mit Bogenverzierung (Taf. 10, 6) ist mit diesem speziellen Motiv nicht nur im Breisgau
und Hegau bekannt22), doch ist diese Verzierung, gemessen an der Gesamtzahl der koni-
schen Schalen, nicht gerade häufig, was die übrigen schmucklosen Schalen unserer Gräber
bestens bestätigen. Die Zickzackzier in der Schale Taf. 10, 12 hat in unserem Grab 1
Entsprechungen (Taf. 9, 3). Auf die Herkunft des Bodenkreuzes (unter der Schale Taf.
10,11) aus östlicher Richtung hat bereits G. Kraft23) hingewiesen.
Von den Metallfunden sind die beiden Armringe mit vierkantigem Querschnitt, strich-
verziertem Körper und sich verjüngenden, offenen Enden (Taf. 10, 2 und 5) eine Be-
reicherung dieses Typs, für den gute Vergleiche, auch in der doppelten Kombination,
in Münchener Gräberfeldern vorliegen 24). Der quantitative Schwerpunkt liegt aber ge-
genwärtig noch in Nordtirol25), so daß die Reichenauer Ringe zu den wenigen Exem-
plaren im westlichen, schütteren Verbreitungsgebiet gehören. Für die Bronzeblech-
Bandzwingen und die Ringbruchstücke (Taf. 10,3.4.7) und das Ringkettenfragment
gibt es im Münchener Raum ebenfalls gute Vergleiche 26), doch sind solche Fragmente
auch in nicht so großer Entfernung von unserem Fundort gut bekannt27). Möglicher-
weise handelt es sich auch bei unserem Grab um den Rest einer Ringkette oder eines
Ringkettenschmucks. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man die Bronze Taf. 10, 1
auch als Rollenkopfnadel, also der Tracht zugehörig, deuten, was bei dem ähnlichen
Gegenstand aus Grab 1 wegen des Ringes nicht sicher war.
In Grab 3 schließlich ist nicht bekannt, ob und wie viele Gefäße in dem großen Zylin-
derhalsgefäß Taf. 11, 12 gelegen haben können. Das Gefäß hat ebenso wie das aus dem-
selben Grab Taf. 11, 9 mit seinem Riefendekor Entsprechungen im Hegau28), aber auch
im Münchener Raum ist die Anordnung der Halbmondriefen, die auf die Girlanden
Rücksicht nehmen, bekannt29), so daß hier, da diese Anordnung am Oberrhein zu
fehlen scheint, an östliche Verbreitung gedacht werden darf. Dasselbe gilt für das Kegel-
halsgefäß Taf. 11,9, dessen äußere Riefung dicht über der Standfläche ebenso wie bei
19) H. Müller-Karpe, Die Urnenfelderkultur im Hanauer Land, Taf. 18; 21.
20) z.B. W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 21 Al, C 7, E 4. — Taf. 22 C 5, D 5. — Taf. 23
A 3. — Taf. 24 B. — Taf. 32 C 2, F 4—6.
21) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, 34.
22) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, 81.
23) Bonner Jahrbücher 131, 1926, 179.
24) H. Müller-Karpe, Münchener Urnenfelder, Tab. S. 11 unter Ha A 1.
25) K. H. Wagner, Nordtiroler Urnenfelder, Taf. 45 a.
26) H. Müller-Karpe, Münchener Urnenfelder, Taf. 4 D, Taf. 6; 7 und 15.
27) z.B. Gammertingen, Ldkrs. Sigmaringen, Fundber. Schwaben, N. F. 14, 1957, Taf. 19; 1—49,
im selben Grab auch die Armringe, a. a. O. Taf. 18; 19—22 (W. Kimmig und S. Schiek).
28) W. Kimmig, Urnenfelderkultur, Taf. 32 C 1, Taf. 33 B 8.
29) H. Müller-Karpe, Münchener Urnenfelder, Taf. 16 D, Taf. 22 F 1, Taf. 31 A 1.