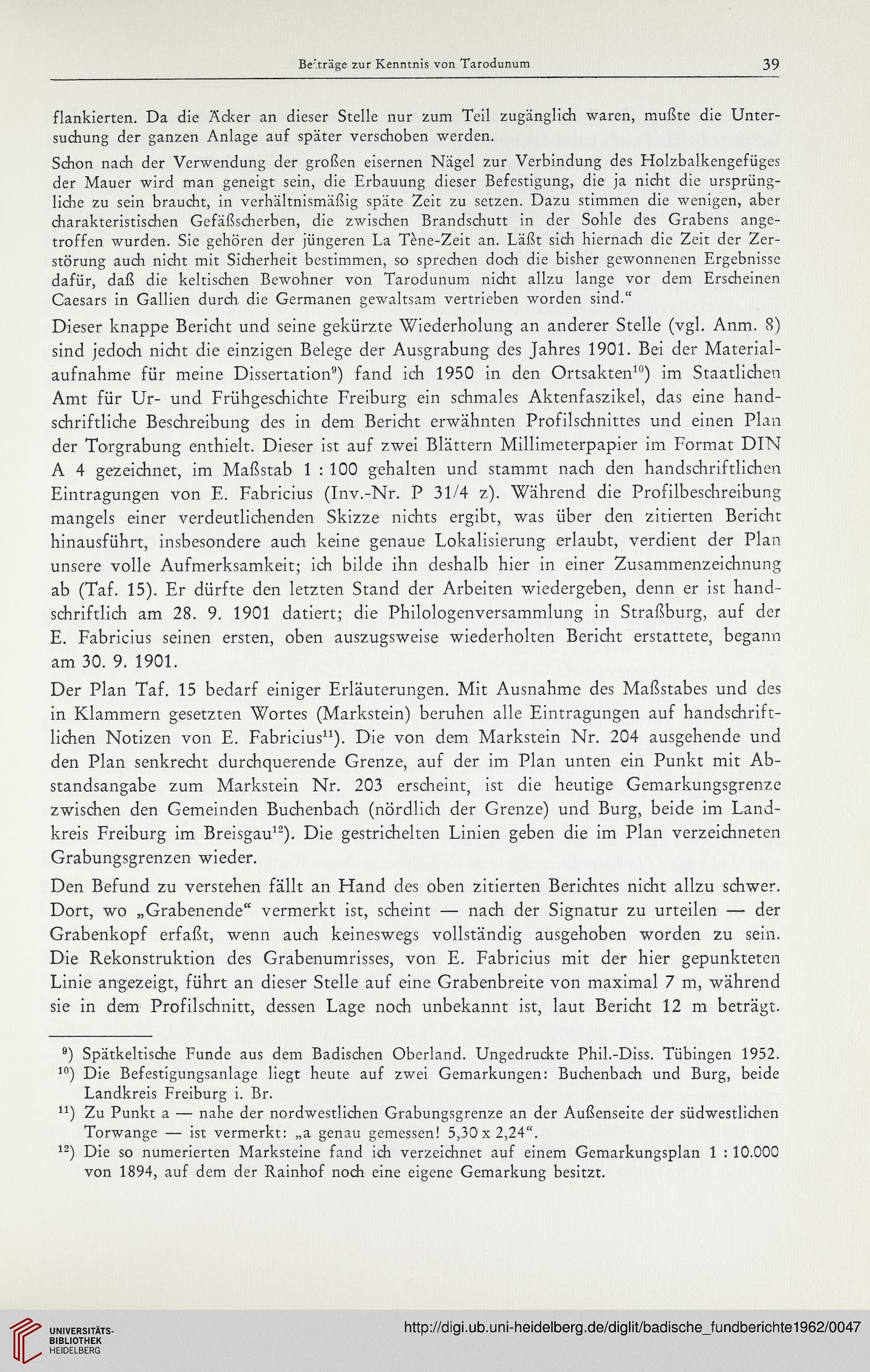Beiträge zur Kenntnis von Tarodunum
39
flankierten. Da die Äcker an dieser Stelle nur zum Teil zugänglich waren, mußte die Unter-
suchung der ganzen Anlage auf später verschoben werden.
Schon nach der Verwendung der großen eisernen Nägel zur Verbindung des Holzbalkengefüges
der Mauer wird man geneigt sein, die Erbauung dieser Befestigung, die ja nicht die ursprüng-
liche zu sein braucht, in verhältnismäßig späte Zeit zu setzen. Dazu stimmen die wenigen, aber
charakteristischen Gefäßscherben, die zwischen Brandschutt in der Sohle des Grabens ange-
troffen wurden. Sie gehören der jüngeren La Tene-Zeit an. Läßt sich hiernach die Zeit der Zer-
störung auch nicht mit Sicherheit bestimmen, so sprechen doch die bisher gewonnenen Ergebnisse
dafür, daß die keltischen Bewohner von Tarodunum nicht allzu lange vor dem Erscheinen
Caesars in Gallien durch die Germanen gewaltsam vertrieben worden sind.“
Dieser knappe Bericht und seine gekürzte Wiederholung an anderer Stelle (vgl. Anm. 8)
sind jedoch nicht die einzigen Belege der Ausgrabung des Jahres 1901. Bei der Material-
aufnahme für meine Dissertation9) fand ich 1950 in den Ortsakten10) im Staatlichen
Amt für Ur- und Frühgeschichte Freiburg ein schmales Aktenfaszikel, das eine hand-
schriftliche Beschreibung des in dem Bericht erwähnten Profilschnittes und einen Plan
der Torgrabung enthielt. Dieser ist auf zwei Blättern Millimeterpapier im Format DIN
A 4 gezeichnet, im Maßstab 1 : 100 gehalten und stammt nach den handschriftlichen
Eintragungen von E. Fabricius (Inv.-Nr. P 31/4 z). Während die Profilbeschreibung
mangels einer verdeutlichenden Skizze nichts ergibt, was über den zitierten Bericht
hinausführt, insbesondere auch keine genaue Lokalisierung erlaubt, verdient der Plan
unsere volle Aufmerksamkeit; ich bilde ihn deshalb hier in einer Zusammenzeichnung
ab (Taf. 15). Er dürfte den letzten Stand der Arbeiten wiedergeben, denn er ist hand-
schriftlich am 28. 9. 1901 datiert; die Philologenversammlung in Straßburg, auf der
E. Fabricius seinen ersten, oben auszugsweise wiederholten Bericht erstattete, begann
am 30. 9. 1901.
Der Plan Taf. 15 bedarf einiger Erläuterungen. Mit Ausnahme des Maßstabes und des
in Klammern gesetzten Wortes (Markstein) beruhen alle Eintragungen auf handschrift-
lichen Notizen von E. Fabricius11). Die von dem Markstein Nr. 204 ausgehende und
den Plan senkrecht durchquerende Grenze, auf der im Plan unten ein Punkt mit Ab-
standsangabe zum Markstein Nr. 203 erscheint, ist die heutige Gemarkungsgrenze
zwischen den Gemeinden Buchenbach (nördlich der Grenze) und Burg, beide im Land-
kreis Freiburg im Breisgau12). Die gestrichelten Linien geben die im Plan verzeichneten
Grabungsgrenzen wieder.
Den Befund zu verstehen fällt an Hand des oben zitierten Berichtes nicht allzu schwer.
Dort, wo „Grabenende“ vermerkt ist, scheint — nach der Signatur zu urteilen — der
Grabenkopf erfaßt, wenn auch keineswegs vollständig ausgehoben worden zu sein.
Die Rekonstruktion des Grabenumrisses, von E. Fabricius mit der hier gepunkteten
Linie angezeigt, führt an dieser Stelle auf eine Grabenbreite von maximal 7 m, während
sie in dem Profilschnitt, dessen Lage noch unbekannt ist, laut Bericht 12 m beträgt.
9) Spätkeltisdie Funde aus dem Badischen Oberland. Ungedruckte Phil.-Diss. Tübingen 1952.
10) Die Befestigungsanlage liegt heute auf zwei Gemarkungen: Buchenbach und Burg, beide
Landkreis Freiburg i. Br.
n) Zu Punkt a — nahe der nordwestlichen Grabungsgrenze an der Außenseite der südwestlichen
Torwange — ist vermerkt: „a genau gemessen! 5,30x 2,24“.
12) Die so numerierten Marksteine fand ich verzeichnet auf einem Gemarkungsplan 1 : 10.000
von 1894, auf dem der Rainhof noch eine eigene Gemarkung besitzt.
39
flankierten. Da die Äcker an dieser Stelle nur zum Teil zugänglich waren, mußte die Unter-
suchung der ganzen Anlage auf später verschoben werden.
Schon nach der Verwendung der großen eisernen Nägel zur Verbindung des Holzbalkengefüges
der Mauer wird man geneigt sein, die Erbauung dieser Befestigung, die ja nicht die ursprüng-
liche zu sein braucht, in verhältnismäßig späte Zeit zu setzen. Dazu stimmen die wenigen, aber
charakteristischen Gefäßscherben, die zwischen Brandschutt in der Sohle des Grabens ange-
troffen wurden. Sie gehören der jüngeren La Tene-Zeit an. Läßt sich hiernach die Zeit der Zer-
störung auch nicht mit Sicherheit bestimmen, so sprechen doch die bisher gewonnenen Ergebnisse
dafür, daß die keltischen Bewohner von Tarodunum nicht allzu lange vor dem Erscheinen
Caesars in Gallien durch die Germanen gewaltsam vertrieben worden sind.“
Dieser knappe Bericht und seine gekürzte Wiederholung an anderer Stelle (vgl. Anm. 8)
sind jedoch nicht die einzigen Belege der Ausgrabung des Jahres 1901. Bei der Material-
aufnahme für meine Dissertation9) fand ich 1950 in den Ortsakten10) im Staatlichen
Amt für Ur- und Frühgeschichte Freiburg ein schmales Aktenfaszikel, das eine hand-
schriftliche Beschreibung des in dem Bericht erwähnten Profilschnittes und einen Plan
der Torgrabung enthielt. Dieser ist auf zwei Blättern Millimeterpapier im Format DIN
A 4 gezeichnet, im Maßstab 1 : 100 gehalten und stammt nach den handschriftlichen
Eintragungen von E. Fabricius (Inv.-Nr. P 31/4 z). Während die Profilbeschreibung
mangels einer verdeutlichenden Skizze nichts ergibt, was über den zitierten Bericht
hinausführt, insbesondere auch keine genaue Lokalisierung erlaubt, verdient der Plan
unsere volle Aufmerksamkeit; ich bilde ihn deshalb hier in einer Zusammenzeichnung
ab (Taf. 15). Er dürfte den letzten Stand der Arbeiten wiedergeben, denn er ist hand-
schriftlich am 28. 9. 1901 datiert; die Philologenversammlung in Straßburg, auf der
E. Fabricius seinen ersten, oben auszugsweise wiederholten Bericht erstattete, begann
am 30. 9. 1901.
Der Plan Taf. 15 bedarf einiger Erläuterungen. Mit Ausnahme des Maßstabes und des
in Klammern gesetzten Wortes (Markstein) beruhen alle Eintragungen auf handschrift-
lichen Notizen von E. Fabricius11). Die von dem Markstein Nr. 204 ausgehende und
den Plan senkrecht durchquerende Grenze, auf der im Plan unten ein Punkt mit Ab-
standsangabe zum Markstein Nr. 203 erscheint, ist die heutige Gemarkungsgrenze
zwischen den Gemeinden Buchenbach (nördlich der Grenze) und Burg, beide im Land-
kreis Freiburg im Breisgau12). Die gestrichelten Linien geben die im Plan verzeichneten
Grabungsgrenzen wieder.
Den Befund zu verstehen fällt an Hand des oben zitierten Berichtes nicht allzu schwer.
Dort, wo „Grabenende“ vermerkt ist, scheint — nach der Signatur zu urteilen — der
Grabenkopf erfaßt, wenn auch keineswegs vollständig ausgehoben worden zu sein.
Die Rekonstruktion des Grabenumrisses, von E. Fabricius mit der hier gepunkteten
Linie angezeigt, führt an dieser Stelle auf eine Grabenbreite von maximal 7 m, während
sie in dem Profilschnitt, dessen Lage noch unbekannt ist, laut Bericht 12 m beträgt.
9) Spätkeltisdie Funde aus dem Badischen Oberland. Ungedruckte Phil.-Diss. Tübingen 1952.
10) Die Befestigungsanlage liegt heute auf zwei Gemarkungen: Buchenbach und Burg, beide
Landkreis Freiburg i. Br.
n) Zu Punkt a — nahe der nordwestlichen Grabungsgrenze an der Außenseite der südwestlichen
Torwange — ist vermerkt: „a genau gemessen! 5,30x 2,24“.
12) Die so numerierten Marksteine fand ich verzeichnet auf einem Gemarkungsplan 1 : 10.000
von 1894, auf dem der Rainhof noch eine eigene Gemarkung besitzt.