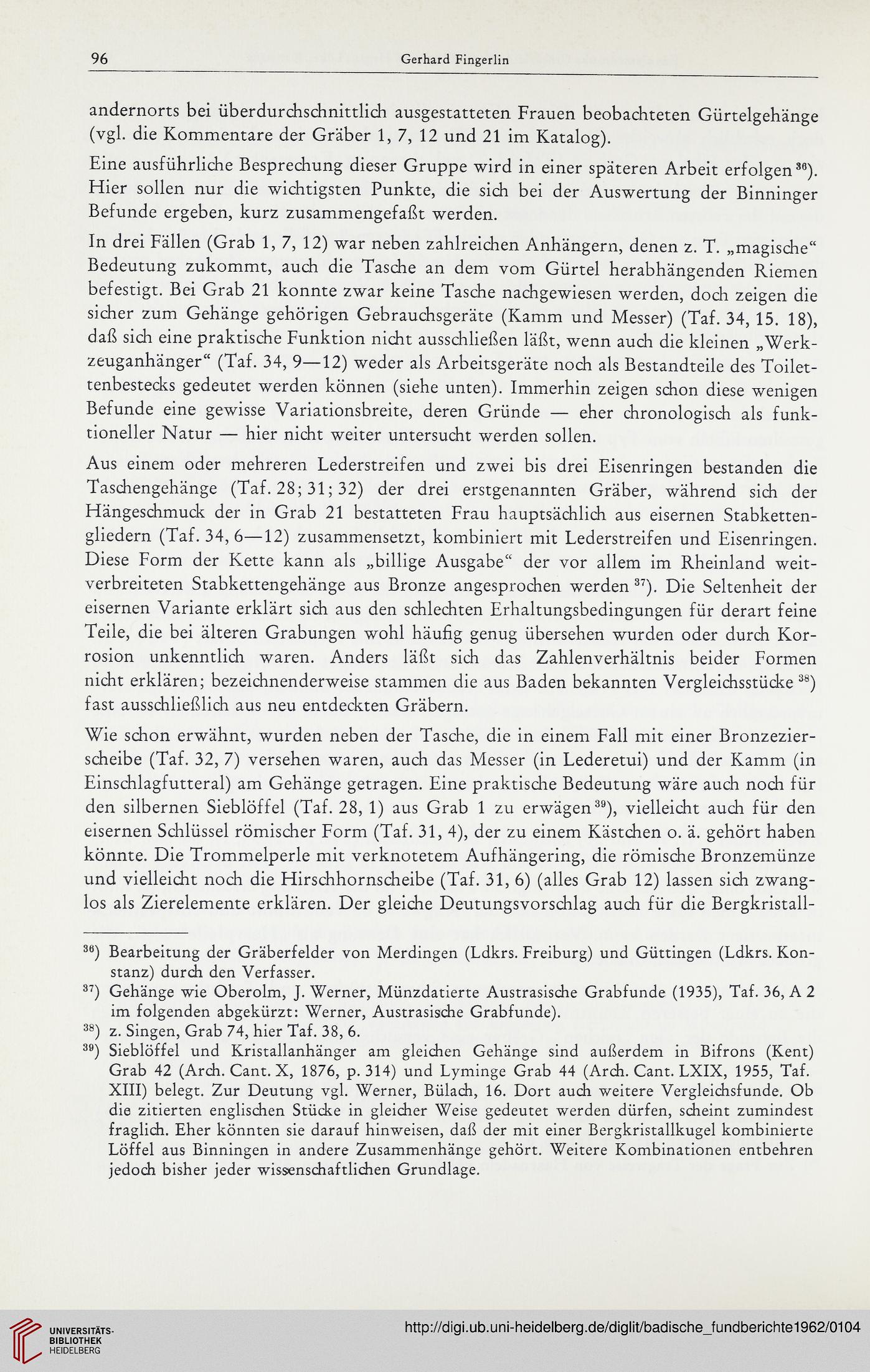96
Gerhard Fingerlin
andernorts bei überdurchschnittlich ausgestatteten Frauen beobachteten Gürtelgehänge
(vgl. die Kommentare der Gräber 1, 7, 12 und 21 im Katalog).
Eine ausführliche Besprechung dieser Gruppe wird in einer späteren Arbeit erfolgen39).
Hier sollen nur die wichtigsten Punkte, die sich bei der Auswertung der Binninger
Befunde ergeben, kurz zusammengefaßt werden.
In drei Fällen (Grab 1, 7, 12) war neben zahlreichen Anhängern, denen z. T. „magische“
Bedeutung zukommt, auch die Tasche an dem vom Gürtel herabhängenden Riemen
befestigt. Bei Grab 21 konnte zwar keine Tasche nachgewiesen werden, doch zeigen die
sicher zum Gehänge gehörigen Gebrauchsgeräte (Kamm und Messer) (Taf. 34, 15. 18),
daß sich eine praktische Funktion nicht ausschließen läßt, wenn auch die kleinen „Werk-
zeuganhänger“ (Taf. 34, 9—12) weder als Arbeitsgeräte noch als Bestandteile des Toilet-
tenbestecks gedeutet werden können (siehe unten). Immerhin zeigen schon diese wenigen
Befunde eine gewisse Variationsbreite, deren Gründe — eher chronologisch als funk-
tioneller Natur — hier nicht weiter untersucht werden sollen.
Aus einem oder mehreren Lederstreifen und zwei bis drei Eisenringen bestanden die
Taschengehänge (Taf. 28; 31; 32) der drei erstgenannten Gräber, während sich der
Hängeschmuck der in Grab 21 bestatteten Frau hauptsächlich aus eisernen Stabketten-
gliedern (Taf. 34, 6—12) zusammensetzt, kombiniert mit Lederstreifen und Eisenringen.
Diese Form der Kette kann als „billige Ausgabe“ der vor allem im Rheinland weit-
verbreiteten Stabkettengehänge aus Bronze angesprochen werden * * * 37). Die Seltenheit der
eisernen Variante erklärt sich aus den schlechten Erhaltungsbedingungen für derart feine
Teile, die bei älteren Grabungen wohl häufig genug übersehen wurden oder durch Kor-
rosion unkenntlich waren. Anders läßt sich das Zahlenverhältnis beider Formen
nicht erklären; bezeichnenderweise stammen die aus Baden bekannten Vergleichsstücke 38)
fast ausschließlich aus neu entdeckten Gräbern.
Wie schon erwähnt, wurden neben der Tasche, die in einem Fall mit einer Bronzezier-
scheibe (Taf. 32, 7) versehen waren, auch das Messer (in Lederetui) und der Kamm (in
Einschlagfutteral) am Gehänge getragen. Eine praktische Bedeutung wäre auch noch für
den silbernen Sieblöffel (Taf. 28, 1) aus Grab 1 zu erwägen39), vielleicht auch für den
eisernen Schlüssel römischer Form (Taf. 31, 4), der zu einem Kästchen o. ä. gehört haben
könnte. Die Trommelperle mit verknotetem Aufhängering, die römische Bronzemünze
und vielleicht noch die Hirschhornscheibe (Taf. 31,6) (alles Grab 12) lassen sich zwang-
los als Zierelemente erklären. Der gleiche Deutungsvorschlag auch für die Bergkristall-
39) Bearbeitung der Gräberfelder von Merdingen (Ldkrs. Freiburg) und Güttingen (Ldkrs. Kon¬
stanz) durch den Verfasser.
87) Gehänge wie Oberolm, J. Werner, Münzdatierte Austrasische Grabfunde (1935), Taf. 36, A 2
im folgenden abgekürzt: Werner, Austrasische Grabfunde).
38) z. Singen, Grab 74, hier Taf. 38, 6.
3fi) Sieblöffel und Kristallanhänger am gleichen Gehänge sind außerdem in Bifrons (Kent)
Grab 42 (Arch. Cant. X, 1876, p. 314) und Lyminge Grab 44 (Arch. Cant. LXIX, 1955, Taf.
XIII) belegt. Zur Deutung vgl. Werner, Bülach, 16. Dort auch weitere Vergleichsfunde. Ob
die zitierten englischen Stücke in gleicher Weise gedeutet werden dürfen, scheint zumindest
fraglich. Eher könnten sie darauf hinweisen, daß der mit einer Bergkristallkugel kombinierte
Löffel aus Binningen in andere Zusammenhänge gehört. Weitere Kombinationen entbehren
jedoch bisher jeder wissenschaftlichen Grundlage.
Gerhard Fingerlin
andernorts bei überdurchschnittlich ausgestatteten Frauen beobachteten Gürtelgehänge
(vgl. die Kommentare der Gräber 1, 7, 12 und 21 im Katalog).
Eine ausführliche Besprechung dieser Gruppe wird in einer späteren Arbeit erfolgen39).
Hier sollen nur die wichtigsten Punkte, die sich bei der Auswertung der Binninger
Befunde ergeben, kurz zusammengefaßt werden.
In drei Fällen (Grab 1, 7, 12) war neben zahlreichen Anhängern, denen z. T. „magische“
Bedeutung zukommt, auch die Tasche an dem vom Gürtel herabhängenden Riemen
befestigt. Bei Grab 21 konnte zwar keine Tasche nachgewiesen werden, doch zeigen die
sicher zum Gehänge gehörigen Gebrauchsgeräte (Kamm und Messer) (Taf. 34, 15. 18),
daß sich eine praktische Funktion nicht ausschließen läßt, wenn auch die kleinen „Werk-
zeuganhänger“ (Taf. 34, 9—12) weder als Arbeitsgeräte noch als Bestandteile des Toilet-
tenbestecks gedeutet werden können (siehe unten). Immerhin zeigen schon diese wenigen
Befunde eine gewisse Variationsbreite, deren Gründe — eher chronologisch als funk-
tioneller Natur — hier nicht weiter untersucht werden sollen.
Aus einem oder mehreren Lederstreifen und zwei bis drei Eisenringen bestanden die
Taschengehänge (Taf. 28; 31; 32) der drei erstgenannten Gräber, während sich der
Hängeschmuck der in Grab 21 bestatteten Frau hauptsächlich aus eisernen Stabketten-
gliedern (Taf. 34, 6—12) zusammensetzt, kombiniert mit Lederstreifen und Eisenringen.
Diese Form der Kette kann als „billige Ausgabe“ der vor allem im Rheinland weit-
verbreiteten Stabkettengehänge aus Bronze angesprochen werden * * * 37). Die Seltenheit der
eisernen Variante erklärt sich aus den schlechten Erhaltungsbedingungen für derart feine
Teile, die bei älteren Grabungen wohl häufig genug übersehen wurden oder durch Kor-
rosion unkenntlich waren. Anders läßt sich das Zahlenverhältnis beider Formen
nicht erklären; bezeichnenderweise stammen die aus Baden bekannten Vergleichsstücke 38)
fast ausschließlich aus neu entdeckten Gräbern.
Wie schon erwähnt, wurden neben der Tasche, die in einem Fall mit einer Bronzezier-
scheibe (Taf. 32, 7) versehen waren, auch das Messer (in Lederetui) und der Kamm (in
Einschlagfutteral) am Gehänge getragen. Eine praktische Bedeutung wäre auch noch für
den silbernen Sieblöffel (Taf. 28, 1) aus Grab 1 zu erwägen39), vielleicht auch für den
eisernen Schlüssel römischer Form (Taf. 31, 4), der zu einem Kästchen o. ä. gehört haben
könnte. Die Trommelperle mit verknotetem Aufhängering, die römische Bronzemünze
und vielleicht noch die Hirschhornscheibe (Taf. 31,6) (alles Grab 12) lassen sich zwang-
los als Zierelemente erklären. Der gleiche Deutungsvorschlag auch für die Bergkristall-
39) Bearbeitung der Gräberfelder von Merdingen (Ldkrs. Freiburg) und Güttingen (Ldkrs. Kon¬
stanz) durch den Verfasser.
87) Gehänge wie Oberolm, J. Werner, Münzdatierte Austrasische Grabfunde (1935), Taf. 36, A 2
im folgenden abgekürzt: Werner, Austrasische Grabfunde).
38) z. Singen, Grab 74, hier Taf. 38, 6.
3fi) Sieblöffel und Kristallanhänger am gleichen Gehänge sind außerdem in Bifrons (Kent)
Grab 42 (Arch. Cant. X, 1876, p. 314) und Lyminge Grab 44 (Arch. Cant. LXIX, 1955, Taf.
XIII) belegt. Zur Deutung vgl. Werner, Bülach, 16. Dort auch weitere Vergleichsfunde. Ob
die zitierten englischen Stücke in gleicher Weise gedeutet werden dürfen, scheint zumindest
fraglich. Eher könnten sie darauf hinweisen, daß der mit einer Bergkristallkugel kombinierte
Löffel aus Binningen in andere Zusammenhänge gehört. Weitere Kombinationen entbehren
jedoch bisher jeder wissenschaftlichen Grundlage.