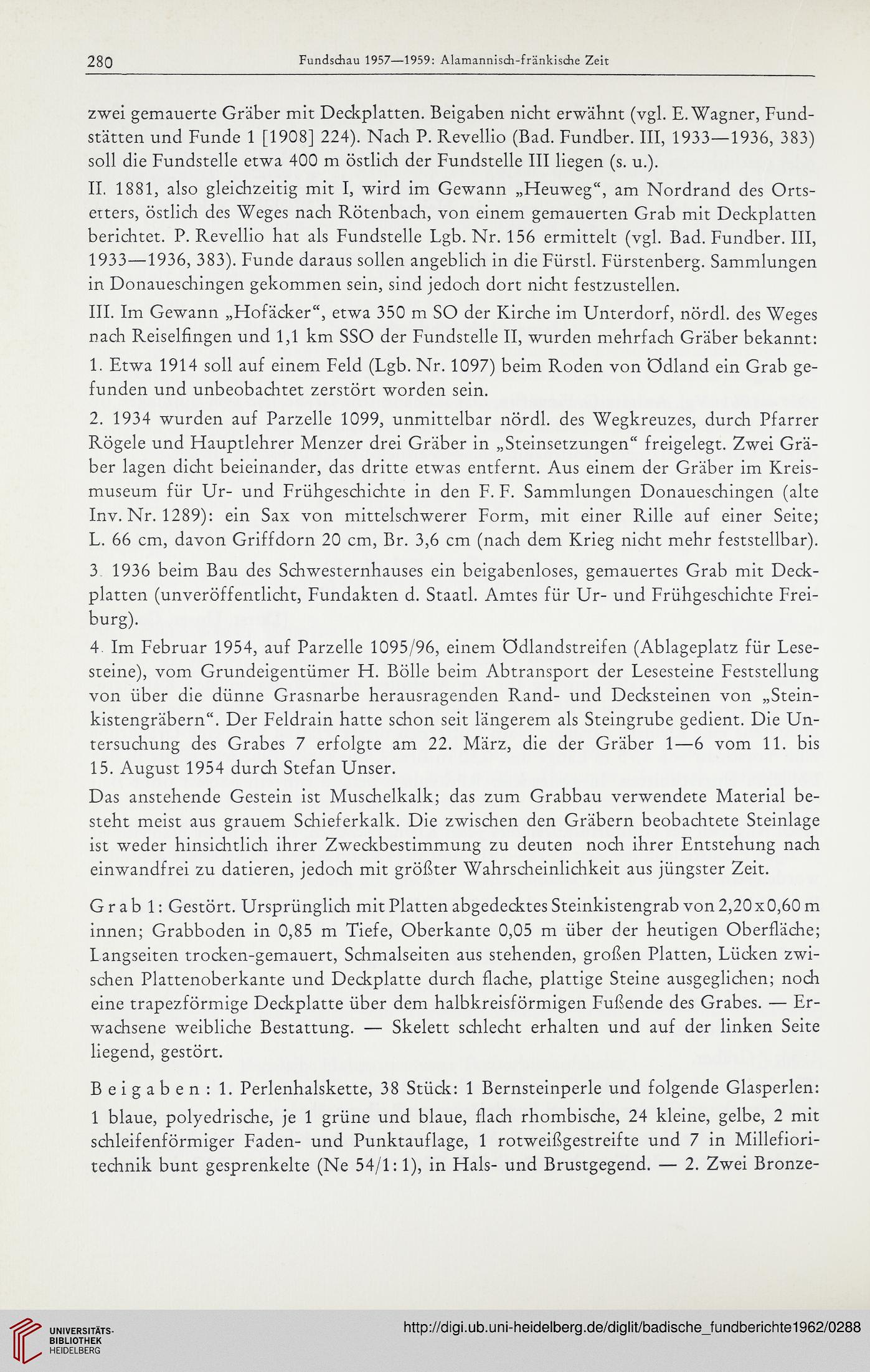280
Fundschau 1957—1959: Alamannisch-fränkische Zeit
zwei gemauerte Gräber mit Deckplatten. Beigaben nicht erwähnt (vgl. E. Wagner, Fund-
stätten und Funde 1 [1908] 224). Nach P. Revellio (Bad. Fundber. III, 1933—1936, 383)
soll die Fundstelle etwa 400 m östlich der Fundstelle III liegen (s. u.).
II. 1881, also gleichzeitig mit I, wird im Gewann „Heuweg“, am Nordrand des Orts-
etters, östlich des Weges nach Rötenbach, von einem gemauerten Grab mit Deckplatten
berichtet. P. Revellio hat als Fundstelle Lgb. Nr. 156 ermittelt (vgl. Bad. Fundber. III,
1933—1936, 383). Funde daraus sollen angeblich in die Fürstl. Fürstenberg. Sammlungen
in Donaueschingen gekommen sein, sind jedoch dort nicht festzustellen.
III. Im Gewann „Hofäcker“, etwa 350 m SO der Kirche im Unterdorf, nördl. des Weges
nach Reiselfingen und 1,1 km SSO der Fundstelle II, wurden mehrfach Gräber bekannt:
1. Etwa 1914 soll auf einem Feld (Lgb. Nr. 1097) beim Roden von Ödland ein Grab ge-
funden und unbeobachtet zerstört worden sein.
2. 1934 wurden auf Parzelle 1099, unmittelbar nördl. des Wegkreuzes, durch Pfarrer
Rögele und Hauptlehrer Menzer drei Gräber in „Steinsetzungen“ freigelegt. Zwei Grä-
ber lagen dicht beieinander, das dritte etwas entfernt. Aus einem der Gräber im Kreis-
museum für Ur- und Frühgeschichte in den F. F. Sammlungen Donaueschingen (alte
Inv. Nr. 1289): ein Sax von mittelschwerer Form, mit einer Rille auf einer Seite;
L. 66 cm, davon Griffdorn 20 cm, Br. 3,6 cm (nach dem Krieg nicht mehr feststellbar).
3 1936 beim Bau des Schwesternhauses ein beigabenloses, gemauertes Grab mit Deck-
platten (unveröffentlicht, Fundakten d. Staatl. Amtes für Ur- und Frühgeschichte Frei-
burg).
4. Im Februar 1954, auf Parzelle 1095/96, einem Ödlandstreifen (Ablageplatz für Lese-
steine), vom Grundeigentümer H. Bolle beim Abtransport der Lesesteine Feststellung
von über die dünne Grasnarbe herausragenden Rand- und Decksteinen von „Stein-
kistengräbern“. Der Feldrain hatte schon seit längerem als Steingrube gedient. Die Un-
tersuchung des Grabes 7 erfolgte am 22. März, die der Gräber 1—6 vom 11. bis
15. August 1954 durch Stefan Unser.
Das anstehende Gestein ist Muschelkalk; das zum Grabbau verwendete Material be-
steht meist aus grauem Schieferkalk. Die zwischen den Gräbern beobachtete Steinlage
ist weder hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung zu deuten noch ihrer Entstehung nach
einwandfrei zu datieren, jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit aus jüngster Zeit.
Grab 1: Gestört. Ursprünglich mit Platten abgedecktes Steinkistengrab von 2,20x0,60 m
innen; Grabboden in 0,85 m Tiefe, Oberkante 0,05 m über der heutigen Oberfläche;
Langseiten trocken-gemauert, Schmalseiten aus stehenden, großen Platten, Lücken zwi-
schen Plattenoberkante und Deckplatte durch flache, plattige Steine ausgeglichen; noch
eine trapezförmige Deckplatte über dem halbkreisförmigen Fußende des Grabes. — Er-
wachsene weibliche Bestattung. — Skelett schlecht erhalten und auf der linken Seite
liegend, gestört.
Beigaben: 1. Perlenhalskette, 38 Stück: 1 Bernsteinperle und folgende Glasperlen:
1 blaue, polyedrische, je 1 grüne und blaue, flach rhombische, 24 kleine, gelbe, 2 mit
schleifenförmiger Faden- und Punktauflage, 1 rotweißgestreifte und 7 in Millefiori-
technik bunt gesprenkelte (Ne 54/1:1), in Hals- und Brustgegend. — 2. Zwei Bronze-
Fundschau 1957—1959: Alamannisch-fränkische Zeit
zwei gemauerte Gräber mit Deckplatten. Beigaben nicht erwähnt (vgl. E. Wagner, Fund-
stätten und Funde 1 [1908] 224). Nach P. Revellio (Bad. Fundber. III, 1933—1936, 383)
soll die Fundstelle etwa 400 m östlich der Fundstelle III liegen (s. u.).
II. 1881, also gleichzeitig mit I, wird im Gewann „Heuweg“, am Nordrand des Orts-
etters, östlich des Weges nach Rötenbach, von einem gemauerten Grab mit Deckplatten
berichtet. P. Revellio hat als Fundstelle Lgb. Nr. 156 ermittelt (vgl. Bad. Fundber. III,
1933—1936, 383). Funde daraus sollen angeblich in die Fürstl. Fürstenberg. Sammlungen
in Donaueschingen gekommen sein, sind jedoch dort nicht festzustellen.
III. Im Gewann „Hofäcker“, etwa 350 m SO der Kirche im Unterdorf, nördl. des Weges
nach Reiselfingen und 1,1 km SSO der Fundstelle II, wurden mehrfach Gräber bekannt:
1. Etwa 1914 soll auf einem Feld (Lgb. Nr. 1097) beim Roden von Ödland ein Grab ge-
funden und unbeobachtet zerstört worden sein.
2. 1934 wurden auf Parzelle 1099, unmittelbar nördl. des Wegkreuzes, durch Pfarrer
Rögele und Hauptlehrer Menzer drei Gräber in „Steinsetzungen“ freigelegt. Zwei Grä-
ber lagen dicht beieinander, das dritte etwas entfernt. Aus einem der Gräber im Kreis-
museum für Ur- und Frühgeschichte in den F. F. Sammlungen Donaueschingen (alte
Inv. Nr. 1289): ein Sax von mittelschwerer Form, mit einer Rille auf einer Seite;
L. 66 cm, davon Griffdorn 20 cm, Br. 3,6 cm (nach dem Krieg nicht mehr feststellbar).
3 1936 beim Bau des Schwesternhauses ein beigabenloses, gemauertes Grab mit Deck-
platten (unveröffentlicht, Fundakten d. Staatl. Amtes für Ur- und Frühgeschichte Frei-
burg).
4. Im Februar 1954, auf Parzelle 1095/96, einem Ödlandstreifen (Ablageplatz für Lese-
steine), vom Grundeigentümer H. Bolle beim Abtransport der Lesesteine Feststellung
von über die dünne Grasnarbe herausragenden Rand- und Decksteinen von „Stein-
kistengräbern“. Der Feldrain hatte schon seit längerem als Steingrube gedient. Die Un-
tersuchung des Grabes 7 erfolgte am 22. März, die der Gräber 1—6 vom 11. bis
15. August 1954 durch Stefan Unser.
Das anstehende Gestein ist Muschelkalk; das zum Grabbau verwendete Material be-
steht meist aus grauem Schieferkalk. Die zwischen den Gräbern beobachtete Steinlage
ist weder hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung zu deuten noch ihrer Entstehung nach
einwandfrei zu datieren, jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit aus jüngster Zeit.
Grab 1: Gestört. Ursprünglich mit Platten abgedecktes Steinkistengrab von 2,20x0,60 m
innen; Grabboden in 0,85 m Tiefe, Oberkante 0,05 m über der heutigen Oberfläche;
Langseiten trocken-gemauert, Schmalseiten aus stehenden, großen Platten, Lücken zwi-
schen Plattenoberkante und Deckplatte durch flache, plattige Steine ausgeglichen; noch
eine trapezförmige Deckplatte über dem halbkreisförmigen Fußende des Grabes. — Er-
wachsene weibliche Bestattung. — Skelett schlecht erhalten und auf der linken Seite
liegend, gestört.
Beigaben: 1. Perlenhalskette, 38 Stück: 1 Bernsteinperle und folgende Glasperlen:
1 blaue, polyedrische, je 1 grüne und blaue, flach rhombische, 24 kleine, gelbe, 2 mit
schleifenförmiger Faden- und Punktauflage, 1 rotweißgestreifte und 7 in Millefiori-
technik bunt gesprenkelte (Ne 54/1:1), in Hals- und Brustgegend. — 2. Zwei Bronze-