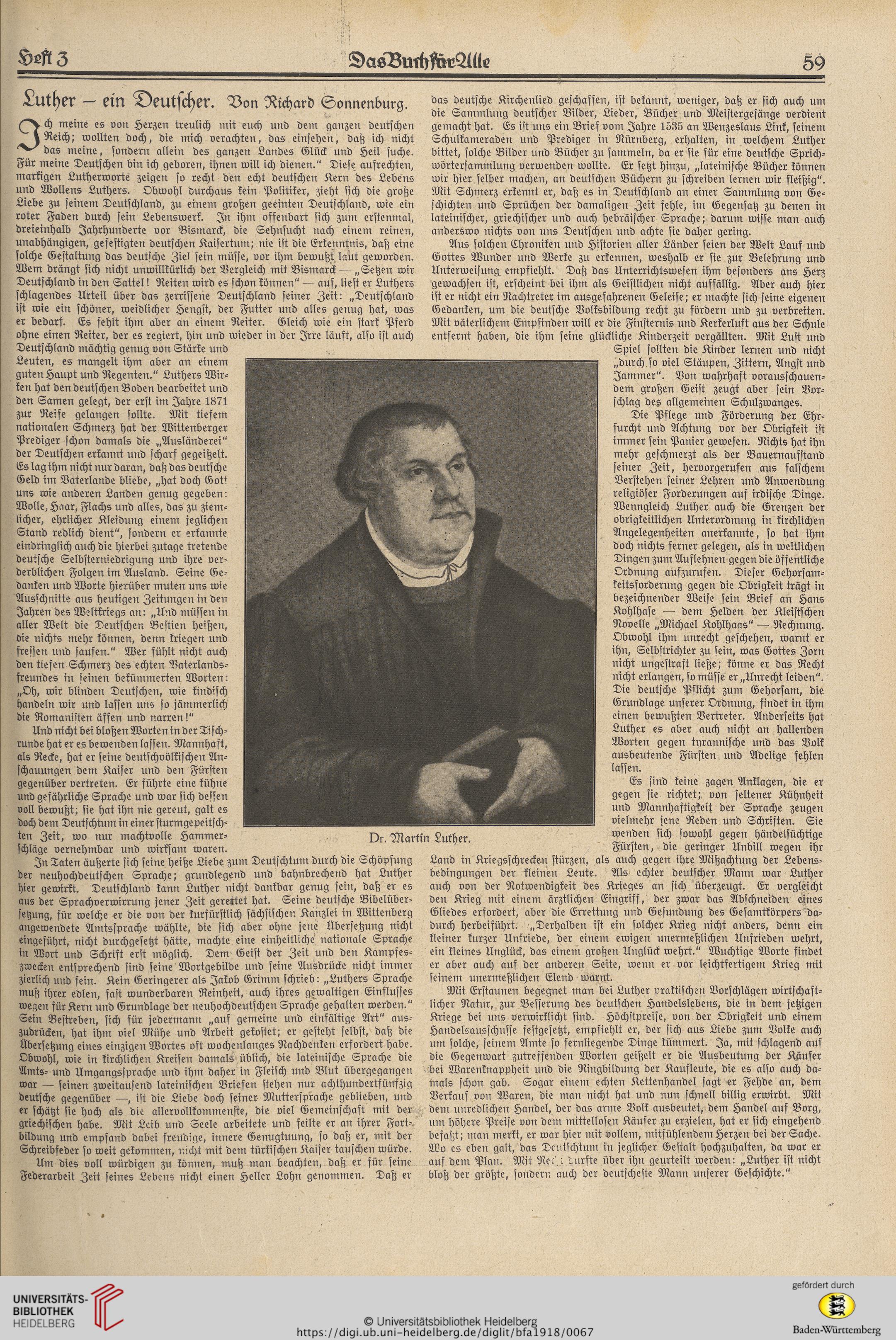59
DasBuihMiAtte
§ul!)er — ein Deutler. Von Nichard Sonnenburg.
ch meine es von Herzen treulich mit euch und dem ganzen deutschen
Reich; wollten doch, die mich verachten, das einsehen, daß ich nicht
das meine, sondern allein des ganzen Landes Glück und Heil suche.
Für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen will ich dienen." Diese aufrechten,
markigen Lutherworte zeigen so recht den echt deutschen Kern des Lebens
und Wollens Luthers. Obwohl durchaus kein Politiker, zieht sich die große
Liebe zu seinem Deutschland, zu einem großen geeinten Deutschland, wie ein
roter Faden durch sein Lebenswerk. In ihm offenbart sich zum erstenmal,
dreieinhalb Jahrhunderte vor Bismarck, die Sehnsucht nach einem reinen,
unabhängigen, gefestigten deutschen Kaisertum; nie ist die Erkenntnis, daß eine
solche Gestaltung das deutsche Ziel sein müsse, vor ihm bewußt laut geworden.
Wem drängt sich nicht unwillkürlich der Vergleich mit Bismarck — „Setzen wir
Deutschland in den Sattel! Reiten wird es schon können" — auf, liest er Luthers
schlagendes Urteil über das zerrissene Deutschland seiner Zeit: „Deutschland
ist wie ein schöner, weiblicher Hengst, der Futter und alles genug hat, was
er bedarf. Es fehlt ihm aber an einem Reiter. Gleich wie ein stark Pferd
ohne einen Reiter, der es regiert, hin und wieder in der Irre läuft, also ist auch
Deutschland mächtig genug von Stärke und
Leuten, es mangelt ihm aber an einem
guten Haupt und Regenten." Luthers Wir-
ken hat den deutschen Boden bearbeitet und
den Samen gelegt, der erst im Jahre 1871
zur Reife gelangen sollte. Mit tiefem
nationalen Schmerz hat der Wittenberger
Prediger schon damals die „Ausländerei"
der Deutschen erkannt und scharf gegeißelt.
Es lag ihm nicht nur daran, daß das deutsche
Geld im Vaterlande bliebe, „hat doch Gott
uns wie anderen Landen genug gegeben:
Wolle, Haar, Flachs und alles, das zu ziem¬
licher, ehrlicher Kleidung einem jeglichen
Stand redlich dient", sondern er erkannte
eindringlich auch die hierbei zutage tretende
deutsche Selbsterniedrigung und ihre ver-
derblichen Folgen im Ausland. Seine Ge-
danken und Worte hierüber muten uns wie
Ausschnitts aus heutigen Zeitungen in den
Jahren des Weltkriegs an: „Und müssen in
aller Welt die Deutschen Bestien heißen,
die nichts mehr können, denn kriegen und
fressen und saufen." Wer fühlt nicht auch
den tiefen Schmerz des echten Vaterlands-
freundes in seinen bekümmerten Worten:
„Oh, wir blinden Deutschen, wie kindisch
handeln wir und lassen uns so jämmerlich
die Romanisten äffen und narren!"
Und nicht bei bloßen Worten in der Tisch-
runde hat er es bewenden lassen. Mannhaft,
als Recke, hat er seine deutschvölkischen An-
schauungen dem Kaiser und den Fürsten
gegenüber vertreten. Er führte eine kühne
und gefährliche Sprache und war sich dessen
voll bewußt; sie hat ihn nie gereut, galt es
doch dem Deutschtum in einer sturmgepeitsch¬
ten Zeit, wo nur machtvolle Hammer¬
schläge vernehmbar und wirksam waren.
In Taten äußerte sich seine heiße Liebe zum Deutschtum durch die Schöpfung
der neuhochdeutschen Sprache; grundlegend und bahnbrechend hat Luther
hier gewirkt. Deutschland kann Luther nicht dankbar genug sein, daß er es
aus der Sprachverwirrung jener Zeit gerettet hat. Seine deutsche Bibelüber-
setzung, für welche er die von der kurfürstlich sächsischen Kanzlei in Wittenberg
angewendete Amtssprache wählte, die sich aber ohne jene Übersetzung nicht
eingeführt, nicht durchgesetzt hätte, machte eine einheitliche nationale Sprache
in Wort und Schrift erst möglich. Dem Geist der Zeit und den Kampfes-
zwecken entsprechend sind seine Wortgebilde und seine Ausdrücke nicht immer
zierlich und fein. Kein Geringerer als Jakob Grimm schrieb: „Luthers Sprache
muß ihrer edlen, fast wunderbaren Reinheit, auch ihres gewaltigen Einflusses
wegen für Kern und Grundlage der neuhochdeutschen Sprache gehalten werden."
Sein Bestreben, sich für jedermann „aus gemeine und einfältige Art" aus-
zudrücken, hat ihm viel Mühe und Arbeit gekostet; er gesteht selbst, daß die
Übersetzung eines einzigen Wortes oft wochenlanges Nachdenken erfordert habe.
Obwohl, wie in kirchlichen Kreisen damals üblich, die lateinische Sprache die
Amts- und Umgangssprache und ihm daher in Fleisch und Blut übergegangen
war — seinen zweitausend lateinischen Briefen stehen nur achthundertfünfzig
deutsche gegenüber —, ist die Liebe doch seiner Muttersprache geblieben, und
er schätzt sie hoch als die allervollkommenste, die viel Gemeinschaft mit der
griechischen habe. Mit Leib und Seele arbeitete und feilte er an ihrer Fort-
bildung und empfand dabei freudige, innere Genugtuung, so daß er, mit der
Schreibfeder so weit gekommen, nicht mit dem türkischen Kaiser tauschen würde.
Um dies voll würdigen zu können, muß man beachten, daß er für seine
Federarbeit Zeit seines Lebens nicht einen Heller Lohn genommen. Daß er
das deutsche Kirchenlied geschaffen, ist bekannt, weniger, daß er sich auch um
die Sammlung deutscher Bilder, Lieder, Bücher und Meistergesänge verdient
gemacht hat. Es ist uns ein Brief vom Jahre 1835 an Wenzeslaus Link, seinem
Schulkameraden und Prediger in Nürnberg, erhalten, in welchem Luther
bittet, solche Bilder und Bücher zu sammeln, da er sie für eine deutsche Sprich-
wörtersammlung verwenden wollte. Er setzt hinzu, „lateinische Bücher können
wir hier selber machen, an deutschen Büchern zu schreiben lernen wir fleißig".
Mit Schmerz erkennt er, daß es in Deutschland an einer Sammlung von Ge-
schichten und Sprüchen der damaligen Zeit fehle, im Gegensatz zu denen in
lateinischer, griechischer und auch hebräischer Sprache; darum wisse man auch
anderswo nichts von uns Deutschen und achte sie daher gering.
Aus solchen Chroniken und Historien aller Länder seien der Welt Lauf und
Gottes Wunder und Werke zu erkennen, weshalb er sie zur Belehrung und
Unterweisung empfiehlt. Daß das Unterrichtswesen ihm besonders ans Herz
gewachsen ist, erscheint bei ihm als Geistlichen nicht auffällig. Aber auch hier
ist er nicht ein Nachtreter im ausgefahrenen Geleise; er machte sich seine eigenen
Gedanken, um die deutsche Volksbildung recht zu fördern und zu verbreiten.
Mit väterlichem Empfinden will er die Finsternis und Kerkerluft aus der Schule
entfernt haben, die ihm seine glückliche Kinderzeit vergällten. Mit Lust und
Spiel sollten die Kinder lernen und nicht
„durch so viel Stäupen, Zittern, Angst und
Jammer". Von wahrhaft vorausschauen-
dem großen Geist zeugt aber sein Vor-
schlag des allgemeinen Schulzwanges.
Die Pflege und Förderung der Ehr-
furcht und Achtung vor der Obrigkeit ist
immer sein Panier gewesen. Nichts hat ihn
mehr geschmerzt als der Bauernaufstand
seiner Zeit, hervorgerufen aus falschem
Verstehen seiner Lehren und Anwendung
religiöser Forderungen auf irdische Dinge.
Wenngleich Luther auch die Grenzen der
obrigkeitlichen Unterordnung in kirchlichen
Angelegenheiten anerkannte, so hat ihm
doch nichts ferner gelegen, als in weltlichen
Dingen zum Auflehnen gegen die öffentliche
Ordnung aufzurufen. Dieser Gehorsam-
keitsforderung gegen die Obrigkeit trägt in
bezeichnender Weise sein Brief an Hans
Kohlhase — dem Helden der Kleistschen
Novelle „Michael Kohlhaas" — Rechnung.
Obwohl ihm unrecht geschehen, warnt er
ihn, Selbstrichter zu sein, was Gottes Zorn
nicht ungestraft ließe; könne er das Recht
nicht erlangen, so müsse er „Unrecht leiden".
Die deutsche Pflicht zum Gehorsam, die
Grundlage unserer Ordnung, findet in ihm
einen bewußten Vertreter. Anderseits hat
Luther es aber auch nicht an hallenden
Worten gegen tyrannische und das Volk
ausbeutende Fürsten und Adelige fehlen
lassen.
Es sind keine zagen Anklagen, die er
gegen sie richtet;, von seltener Kühnheit
und Mannhaftigkeit der Sprache zeugen
vielmehr jene Reden und Schriften. Sie
wenden sich sowohl gegen händelsüchtige
Fürsten, die geringer Unbill wegen ihr
Land in Kriegsschrecken stürzen, als auch gegen ihre Mißachtung der Lebens-
bedingungen der kleinen Leute. Als echter deutscher Mann war Luther
auch von der Notwendigkeit des Krieges an sich überzeugt. Er vergleicht
den Krieg mit einem ärztlichen Eingriff, der zwar das Abschneiden eines
Gliedes erfordert, aber die Errettung und Gesundung des Gesamtkörpers da-
durch herbeiführt. „Derhalben ist ein solcher Krieg nicht anders, denn ein
kleiner kurzer Unfriede, der einem ewigen unermeßlichen Unfrieden wehrt,
ein kleines Unglück, das einem großen Unglück wehrt." Wuchtige Worte findet
er aber auch auf der anderen Seite, wenn er vor leichtfertigem Krieg mit
seinem unermeßlichen Elend warnt.
Mit Erstaunen begegnet man bei Luther praktischen Vorschlägen wirtschaft-
licher Natur, zur Besserung des deutschen Handelslebens, die in dem jetzigen
Kriege bei uns verwirklicht sind. Höchstpreise, von der Obrigkeit und einem
Handelsausschusse festgesetzt, empfiehlt er, der sich aus Liebe zum Volke auch
um solche, seinem Amte so fernliegende Dinge kümmert. Ja, mit schlagend auf
die Gegenwart zutreffenden Worten geißelt er die Ausbeutung der Käufer
bei Warenknappheit und die Ringbildung der Kaufleute, die es also auch da-
mals schon gab. Sogar einem echten Kettenhandel sagt er Fehde an, dem
Verkauf von Waren, die man nicht hat und nun schnell billig erwirbt. Mit
dem unredlichen Handel, der das arme Volk ausbeutet, dem Handel auf Borg,
um höhere Preise von dem mittellosen Käufer zu erzielen, hat er sich eingehend
befaßt; man merkt, er war hier mit vollem, mitfühlendem Herzen bei der Sache.
Wo cs eben galt, das Deutschtum in jeglicher Gestalt hochzuhalten, da war er
auf dem Plan. Mit Red i durfte über ihn geurteilt werden: „Luther ist nicht
bloß der größte, sondern auch der deutscheste Mann unserer Geschichte."
Or. Martin Luther.