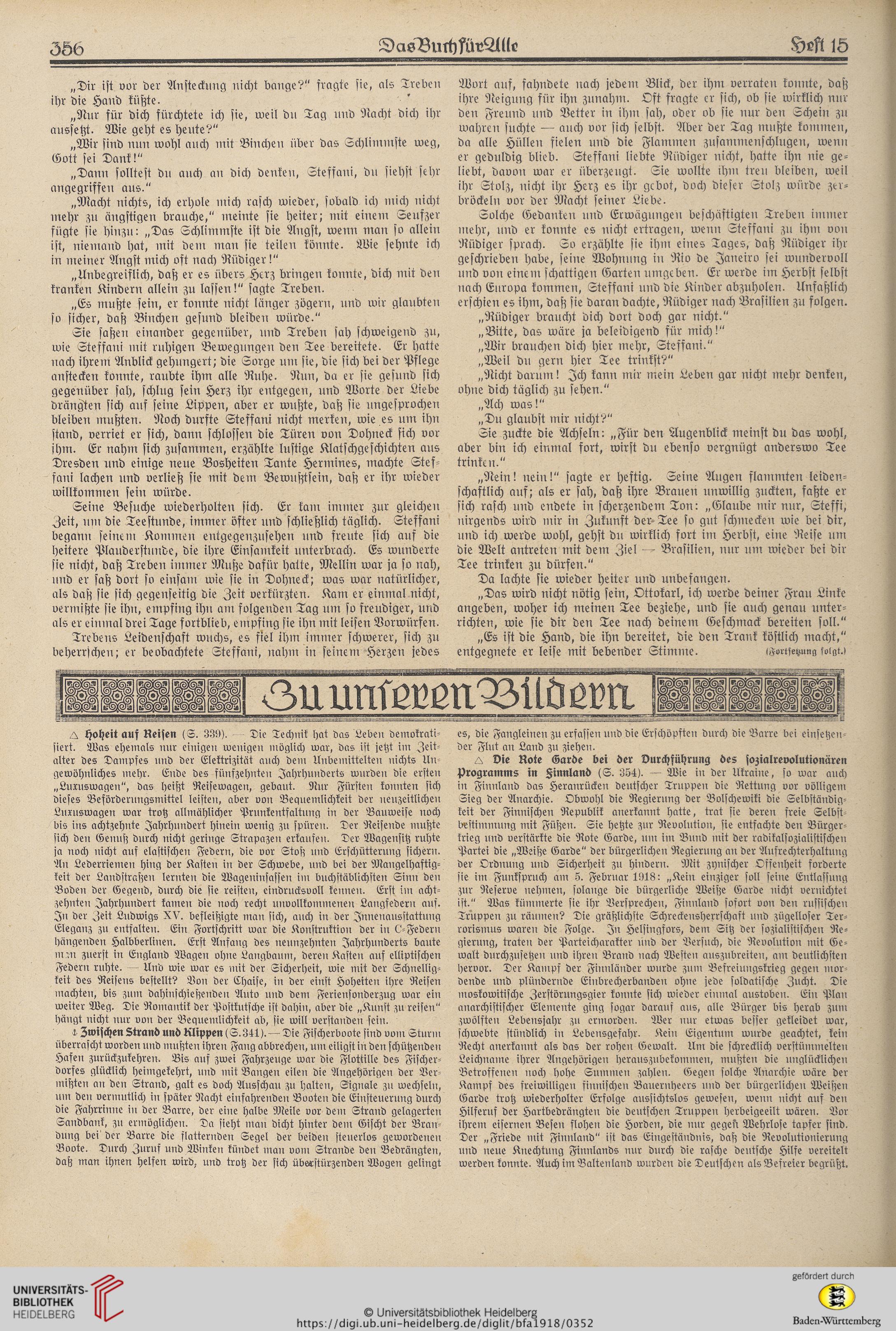DasBuchfüvSüb
„Dir ist vor der Ansteckung nicht bange?" fragte sie, als Treben
ihr die Hand küßte.
„Nur für dich fürchtete ich sie, weil du Tag und Nacht dich ihr
ausseht. Wie geht es heute?"
„Wir sind nun wohl auch init Binchen über das Schlimmste weg,
Gott sei Dank!"
„Dann solltest du auch an dich denken, Stefsani, du siehst sehl-
angegriffen aus."
„Macht nichts, ich erhole mich rasch wieder, sobald ich mich nicht
mehr zit ängstigen brauche," meinte sie heiter; mit einem Seufzer
fügte sie hinzu: „Das Schlimmste ist die Angst, wenn man so allein
ist, niemand hat, init dein man sie teilen könnte. Wie sehnte ich
in meiner Angst mich oft nach Rüdiger!"
„Unbegreiflich, daß er es übers Herz bringen konnte, dich mit den
kranken Kindern allein zu lassen!" sagte Treben.
„Es mußte sein, er konnte nicht länger zögern, und wir glaubten
so sicher, daß Binchen gesund bleibeit würde."
Sie saßen einander gegenüber, und Treben sah schweigend zu,
wie Steffani mit ruhigen Bewegungen den Tee bereitete. Er hatte
nach ihrem Anblick gehungert; die Sorge um sie, die sich bei der Pflege
anstecken konnte, raubte ihm alle Ruhe. Nun, da er sie gesund sich
gegenüber sah, schlug sein Herz ihr entgegen, und Worte der Liebe
drängten sich auf seine Lippen, aber er wußte, daß sie ungesprochen
bleiben mußten. Noch durfte Steffani nicht merken, wie es um ihn
stand, verriet er sich, dann schlossen die Türen von Dohneck sich vor
ihm. Er nahm sich zusammen, erzählte lustige Klatschgeschichten aus
Dresden und einige neue Bosheiten Tante Hermines, machte Stef-
fani lachen und verließ sie mit dem Bewußtsein, daß er ihr wieder-
willkommen sein würde.
Seine Besuche wiederholten sich. Er tarn immer zur gleichen
Zeit, um die Teestunde, immer öfter und schließlich täglich. Steffani
begann seinen. Kommen entgegenzusehen und freute sich auf die
heitere Plauderstunde, die ihre Einsamkeit unterbrach. Es wunderte
sie nicht, daß Treber, immer Muße dafür hatte, Mellin war ja so nah,
und er saß dort so einsam wie sie in Dohneck; was war natürlicher,
als daß sie sich gegenseitig die Zeit verkürzten. Kam er einmal nicht,
vermißte sie ihn, empfing ihn am folgenden Tag um so freudiger, und
als er einmal drei Tage fortblieb, empfing sie ihn mit leisen Vorwürfen.
Trebens Leidenschaft wuchs, es fiel ihm immer schwerer, sich zu
beherrschen; er beobachtete Steffani, nahm in seinem Herzen jedes
Wort auf, fahndete nach jedem Blick, der ihm verraten konnte, daß
ihre Neigung für ihn zunahm. Oft fragte er sich, ob sie wirklich mü-
den Freund und Vetter in ihm sah, oder ob sie nur den Schein zu
wahren suchte — auch vor sich selbst. Aber der Tag mußte kommen,
da alle Hüllen fielen und die Flammen zusammenschlugen, wenn
er geduldig blieb. Steffani liebte Rüdiger nicht, hatte ihn nie ge-
liebt, davon war er überzeugt. Sie wollte ihm treu bleiben, weil
ihr Stolz, nicht ihr Herz es ihr gebot, doch dieser Stolz würde zer-
bröckeln vor der Macht seiner Liebe.
Solche Gedanken und Erwägungen beschäftigten Treben immer
mehr, und er konnte es nicht ertragen, wem, Steffani zu ihn, von
Rüdiger sprach. Sv erzählte sie ihn, eines Tages, daß Rüdiger Un-
geschrieben habe, seine Wohnung in Rio de Janeiro sei wundervoll
und von einen, schattigen Garten umgeben. Er werde im Herbst selbst
nach Europa kommen, Steffani und die Kinder abzuholen. Unsaßlich
erschien es ihm, daß sie daran dachte, Rüdiger nach Brasilien zu folgen.
„Rüdiger braucht dich dort doch gar nicht."
„Bitte, das wäre ja beleidigend für mich!"
„Wir brauchen dich hier mehr, Steffani."
„Weil du gern hier Tee trinkst?"
„Nicht darum! Zch kann mir mein Leben gar nicht mehr denken,
ohne dich täglich zu sehen."
„Ach was!"
„Du glaubst mir nicht?"
Sie zuckte die Achseln: „Für den Augenblick meinst du das wohl,
aber bin ich einmal fort, wirst du ebenso vergnügt anderswo Tee
trinken."
„Nein! nein!" sagte er heftig. Seine Augen flammten leiden-
schaftlich auf; als er sah, daß ihre Brauen unwillig zuckten, faßte er
sich rasch und endete in scherzendem Ton: „Glaube mir nur, Steffi,
nirgends wird nur in Zukunft der Tee so gut schmecken wie bei dir,
und ich werde wohl, gehst du wirklich fort in, Herbst, eine Reise um
die Welt antreten mit dem Ziel — Brasilien, nur um wieder bei dir
Tee trinken zu dürfen."
Da lachte sie wieder heiter und unbefangen.
„Das wird nicht nötig sein, Ottokarl, ich werde deiner Frau Linke
angeben, woher ich meinen Tee beziehe, und sie auch genau unter-
richten, wie sie dir den Tee nach deinem Geschmack bereiten soll."
„Es ist die Hand, die ihn bereitet, die den Trank köstlich macht,"
entgegnete er leise mit bebender Stimme. «Fortsetzung folgt.»
/X Hoheit auf Reisen (S. 3M). Die Technik hat das Leden demokrati-
siert. Was ehemals nur einigen wenigen möglich war, das ist jetzt im Zeit-
alter des Dampfes und der Elektrizität auch dem Unbemittelten nichts Un-
gewöhnliches mehr. Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wurden die ersten
„Luxuswagen", das heißt Reisewagen, gebaut. Nur Fürsten konnten sich
dieses Beförderungsmittel leisten, aber von Bequemlichkeit der neuzeitlichen
Luxuswagen war trotz allmählicher Prunkentfaltung in der Bauweise noch
bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein wenig zu spüren. Der Reisende mußte
sich den Genuß durch nicht geringe Strapazen erkaufen. Der Wagensitz ruhte
ja noch nicht auf elastischen Federn, die vor Stoß und Erschütterung sichern.
An Lederriemen hing der Kasten in der Schwebe, und bei der Mangelhaftig-
keit der Landstraßen lernten die Wageninsassen im buchstäblichsten Sinn den
Boden der Gegend, durch die sie reisten, eindrucksvoll keimen. Erst im acht-
zehnten Jahrhundert kamen die noch recht unvollkommenen Langfedern auf.
In der Zeit Ludwigs XV. befleißigte man sich, auch in der Innenausstattung
Eleganz zu entfalten. Ein Fortschritt war die Konstruktion der in ('-Federn
hängenden Halbberlinen. Erst Anfang des neunzehnten Jahrhunderts baute
m m zuerst in England Wagen ohne Langbaum, deren Kasten auf elliptischen
Federn ruhte. Und wie war es mit der Sicherheit, wie mit der Schnellig-
keit des Reisens bestellt? Von der Chaise, in der einst Hoheiten ihre Reisen
machten, bis zum dahinschießenden Auto und den, Feriensonderzug war ein
weiter Weg. Die Romantik der Postkutsche ist dahin, aber die „Kunst zu reisen"
hängt nicht nur von der Bequemlichkeit ab, sie will verstanden sein.
r Zwischen Strand und Klippen (S. 341). — Die Fischerboote sind vom Sturm
überrascht worden und mußten ihren Fang abbrechen, um eiligst in den schützenden
Hafen zurückzukehren. Bis auf zwei Fahrzeuge war die Flottille des Fischer-
dorfes glücklich heimgekehrt, und nut Bangen eilen die Angehörigen der Ver-
mißten an den Strand, galt es doch Ausschau zu halten, Signale zu wechseln,
um den vermutlich in später Nacht einfahrenden Booten die Einsteuerung durch
die Fahrrinne in der Barre, der eine halbe Meile vor dein Strand gelagerten
Sandbank, zu ermöglichen. Da sieht man dicht hinter dem Gischt der Bran-
dung bei der Barre die flatternden Segel der beiden steuerlos gewordenen
Boote. Durch Zuruf und Winken kündet man vom Strande den Bedrängten,
daß man ihnen helfen wird, und trotz der sich überstürzenden Wogen gelingt
es, die Fangleinen zu erfassen und die Erschöpften durch die Barre bei einsetzen-
der Flut an Land zu ziehen.
ex Vie Rote Garde bei der Durchführung des sozialrevolutionären
Programms in Sinnland (S. 354). — Wie in der Ukraine, so war auch
in Finnland das Heranrücken deutscher Truppen die Rettung vor völligem
Sieg der Anarchie. Obwohl die Regierung der Bolschewiki die Selbständig-
keit der Finnischen Republik anerkannt hatte, trat sie deren freie Selbst-
bestimmung mit Füßen. Sie hetzte zur Revolution, sie entfachte den Bürger-
krieg und verstärkte die Rote Garde, um im Bund init der radikalsozialistischen
Partei die „Weiße Garde" der bürgerlichen Regierung an der Aufrechterhaltung
der Ordnung und Sicherheit zu hindern. Rät zynischer Offenheit forderte
sie im Funkspruch am 5. Februar 1918: „Kein einziger soll seine Entlassung
zur Reserve nehmen, solange die bürgerliche Weiße Garde nicht vernichtet
ist." Was kümmerte sie ihr Versprechen, Finnland sofort von den russischen
Truppen zu räumen? Die gräßlichste Schreckensherrschaft und zügelloser Ter-
rorismus waren die Folge. In Helsingfors, dem Sitz der sozialistischen Re-
gierung, traten der Parteicharakter und der Versuch, die Revolution mit Ge-
walt durchzusetzen und ihren Brand nach Westen nuszubreiten, am deutlichsten
hervor. Der Kampf der Finnländer wurde zum Befreiungskrieg gegen mor-
dende und plündernde Einbrecherbanden ohne jede soldatische Zucht. Die
moskowitische Zerstörungsgier konnte sich wieder einmal austoben. Ein Plan
anarchistischer Elemente ging sogar darauf aus, alle Bürger bis herab zum
zwölften Lebensjahr zu ermorden. Wer nur etwas besser gekleidet war,
schwebte stündlich in Lebensgefahr. Kein Eigentum wurde geachtet, kein
Recht anerkannt als das der rohen Gewalt. Um die schrecklich verstümmelten
Leichname ihrer Angehörige«: herauszubekommen, mußten die unglücklichen
Betroffenen noch hohe Summen zahle«:. Gegen solche Anarchie wäre der
Kainpf des freiwillige«: filmische«: Bauernheers und der bürgerliche«: Weiße«:
Garde trotz wiederholter Erfolge aussichtslos gewesen, wein: nicht auf de«:
Hilferuf der Hartbedrängtei: die deutsche«: Truppe«: herbeigeeilt wären. Vor
ihre««: eiserne«: Besen flohen die Horden, die nur gegelt Wehrlose tapfer sind.
Der „Friede mit Finnland" ist das Eingeständnis, daß die Revolutionierung
und neue Knechtuug Finnlands nur durch die rasche deutsche Hilfe vereitelt
werden konnte. Auch im Baltenland wurde«: die Deutschen als Befreier begrüßt.
„Dir ist vor der Ansteckung nicht bange?" fragte sie, als Treben
ihr die Hand küßte.
„Nur für dich fürchtete ich sie, weil du Tag und Nacht dich ihr
ausseht. Wie geht es heute?"
„Wir sind nun wohl auch init Binchen über das Schlimmste weg,
Gott sei Dank!"
„Dann solltest du auch an dich denken, Stefsani, du siehst sehl-
angegriffen aus."
„Macht nichts, ich erhole mich rasch wieder, sobald ich mich nicht
mehr zit ängstigen brauche," meinte sie heiter; mit einem Seufzer
fügte sie hinzu: „Das Schlimmste ist die Angst, wenn man so allein
ist, niemand hat, init dein man sie teilen könnte. Wie sehnte ich
in meiner Angst mich oft nach Rüdiger!"
„Unbegreiflich, daß er es übers Herz bringen konnte, dich mit den
kranken Kindern allein zu lassen!" sagte Treben.
„Es mußte sein, er konnte nicht länger zögern, und wir glaubten
so sicher, daß Binchen gesund bleibeit würde."
Sie saßen einander gegenüber, und Treben sah schweigend zu,
wie Steffani mit ruhigen Bewegungen den Tee bereitete. Er hatte
nach ihrem Anblick gehungert; die Sorge um sie, die sich bei der Pflege
anstecken konnte, raubte ihm alle Ruhe. Nun, da er sie gesund sich
gegenüber sah, schlug sein Herz ihr entgegen, und Worte der Liebe
drängten sich auf seine Lippen, aber er wußte, daß sie ungesprochen
bleiben mußten. Noch durfte Steffani nicht merken, wie es um ihn
stand, verriet er sich, dann schlossen die Türen von Dohneck sich vor
ihm. Er nahm sich zusammen, erzählte lustige Klatschgeschichten aus
Dresden und einige neue Bosheiten Tante Hermines, machte Stef-
fani lachen und verließ sie mit dem Bewußtsein, daß er ihr wieder-
willkommen sein würde.
Seine Besuche wiederholten sich. Er tarn immer zur gleichen
Zeit, um die Teestunde, immer öfter und schließlich täglich. Steffani
begann seinen. Kommen entgegenzusehen und freute sich auf die
heitere Plauderstunde, die ihre Einsamkeit unterbrach. Es wunderte
sie nicht, daß Treber, immer Muße dafür hatte, Mellin war ja so nah,
und er saß dort so einsam wie sie in Dohneck; was war natürlicher,
als daß sie sich gegenseitig die Zeit verkürzten. Kam er einmal nicht,
vermißte sie ihn, empfing ihn am folgenden Tag um so freudiger, und
als er einmal drei Tage fortblieb, empfing sie ihn mit leisen Vorwürfen.
Trebens Leidenschaft wuchs, es fiel ihm immer schwerer, sich zu
beherrschen; er beobachtete Steffani, nahm in seinem Herzen jedes
Wort auf, fahndete nach jedem Blick, der ihm verraten konnte, daß
ihre Neigung für ihn zunahm. Oft fragte er sich, ob sie wirklich mü-
den Freund und Vetter in ihm sah, oder ob sie nur den Schein zu
wahren suchte — auch vor sich selbst. Aber der Tag mußte kommen,
da alle Hüllen fielen und die Flammen zusammenschlugen, wenn
er geduldig blieb. Steffani liebte Rüdiger nicht, hatte ihn nie ge-
liebt, davon war er überzeugt. Sie wollte ihm treu bleiben, weil
ihr Stolz, nicht ihr Herz es ihr gebot, doch dieser Stolz würde zer-
bröckeln vor der Macht seiner Liebe.
Solche Gedanken und Erwägungen beschäftigten Treben immer
mehr, und er konnte es nicht ertragen, wem, Steffani zu ihn, von
Rüdiger sprach. Sv erzählte sie ihn, eines Tages, daß Rüdiger Un-
geschrieben habe, seine Wohnung in Rio de Janeiro sei wundervoll
und von einen, schattigen Garten umgeben. Er werde im Herbst selbst
nach Europa kommen, Steffani und die Kinder abzuholen. Unsaßlich
erschien es ihm, daß sie daran dachte, Rüdiger nach Brasilien zu folgen.
„Rüdiger braucht dich dort doch gar nicht."
„Bitte, das wäre ja beleidigend für mich!"
„Wir brauchen dich hier mehr, Steffani."
„Weil du gern hier Tee trinkst?"
„Nicht darum! Zch kann mir mein Leben gar nicht mehr denken,
ohne dich täglich zu sehen."
„Ach was!"
„Du glaubst mir nicht?"
Sie zuckte die Achseln: „Für den Augenblick meinst du das wohl,
aber bin ich einmal fort, wirst du ebenso vergnügt anderswo Tee
trinken."
„Nein! nein!" sagte er heftig. Seine Augen flammten leiden-
schaftlich auf; als er sah, daß ihre Brauen unwillig zuckten, faßte er
sich rasch und endete in scherzendem Ton: „Glaube mir nur, Steffi,
nirgends wird nur in Zukunft der Tee so gut schmecken wie bei dir,
und ich werde wohl, gehst du wirklich fort in, Herbst, eine Reise um
die Welt antreten mit dem Ziel — Brasilien, nur um wieder bei dir
Tee trinken zu dürfen."
Da lachte sie wieder heiter und unbefangen.
„Das wird nicht nötig sein, Ottokarl, ich werde deiner Frau Linke
angeben, woher ich meinen Tee beziehe, und sie auch genau unter-
richten, wie sie dir den Tee nach deinem Geschmack bereiten soll."
„Es ist die Hand, die ihn bereitet, die den Trank köstlich macht,"
entgegnete er leise mit bebender Stimme. «Fortsetzung folgt.»
/X Hoheit auf Reisen (S. 3M). Die Technik hat das Leden demokrati-
siert. Was ehemals nur einigen wenigen möglich war, das ist jetzt im Zeit-
alter des Dampfes und der Elektrizität auch dem Unbemittelten nichts Un-
gewöhnliches mehr. Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wurden die ersten
„Luxuswagen", das heißt Reisewagen, gebaut. Nur Fürsten konnten sich
dieses Beförderungsmittel leisten, aber von Bequemlichkeit der neuzeitlichen
Luxuswagen war trotz allmählicher Prunkentfaltung in der Bauweise noch
bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein wenig zu spüren. Der Reisende mußte
sich den Genuß durch nicht geringe Strapazen erkaufen. Der Wagensitz ruhte
ja noch nicht auf elastischen Federn, die vor Stoß und Erschütterung sichern.
An Lederriemen hing der Kasten in der Schwebe, und bei der Mangelhaftig-
keit der Landstraßen lernten die Wageninsassen im buchstäblichsten Sinn den
Boden der Gegend, durch die sie reisten, eindrucksvoll keimen. Erst im acht-
zehnten Jahrhundert kamen die noch recht unvollkommenen Langfedern auf.
In der Zeit Ludwigs XV. befleißigte man sich, auch in der Innenausstattung
Eleganz zu entfalten. Ein Fortschritt war die Konstruktion der in ('-Federn
hängenden Halbberlinen. Erst Anfang des neunzehnten Jahrhunderts baute
m m zuerst in England Wagen ohne Langbaum, deren Kasten auf elliptischen
Federn ruhte. Und wie war es mit der Sicherheit, wie mit der Schnellig-
keit des Reisens bestellt? Von der Chaise, in der einst Hoheiten ihre Reisen
machten, bis zum dahinschießenden Auto und den, Feriensonderzug war ein
weiter Weg. Die Romantik der Postkutsche ist dahin, aber die „Kunst zu reisen"
hängt nicht nur von der Bequemlichkeit ab, sie will verstanden sein.
r Zwischen Strand und Klippen (S. 341). — Die Fischerboote sind vom Sturm
überrascht worden und mußten ihren Fang abbrechen, um eiligst in den schützenden
Hafen zurückzukehren. Bis auf zwei Fahrzeuge war die Flottille des Fischer-
dorfes glücklich heimgekehrt, und nut Bangen eilen die Angehörigen der Ver-
mißten an den Strand, galt es doch Ausschau zu halten, Signale zu wechseln,
um den vermutlich in später Nacht einfahrenden Booten die Einsteuerung durch
die Fahrrinne in der Barre, der eine halbe Meile vor dein Strand gelagerten
Sandbank, zu ermöglichen. Da sieht man dicht hinter dem Gischt der Bran-
dung bei der Barre die flatternden Segel der beiden steuerlos gewordenen
Boote. Durch Zuruf und Winken kündet man vom Strande den Bedrängten,
daß man ihnen helfen wird, und trotz der sich überstürzenden Wogen gelingt
es, die Fangleinen zu erfassen und die Erschöpften durch die Barre bei einsetzen-
der Flut an Land zu ziehen.
ex Vie Rote Garde bei der Durchführung des sozialrevolutionären
Programms in Sinnland (S. 354). — Wie in der Ukraine, so war auch
in Finnland das Heranrücken deutscher Truppen die Rettung vor völligem
Sieg der Anarchie. Obwohl die Regierung der Bolschewiki die Selbständig-
keit der Finnischen Republik anerkannt hatte, trat sie deren freie Selbst-
bestimmung mit Füßen. Sie hetzte zur Revolution, sie entfachte den Bürger-
krieg und verstärkte die Rote Garde, um im Bund init der radikalsozialistischen
Partei die „Weiße Garde" der bürgerlichen Regierung an der Aufrechterhaltung
der Ordnung und Sicherheit zu hindern. Rät zynischer Offenheit forderte
sie im Funkspruch am 5. Februar 1918: „Kein einziger soll seine Entlassung
zur Reserve nehmen, solange die bürgerliche Weiße Garde nicht vernichtet
ist." Was kümmerte sie ihr Versprechen, Finnland sofort von den russischen
Truppen zu räumen? Die gräßlichste Schreckensherrschaft und zügelloser Ter-
rorismus waren die Folge. In Helsingfors, dem Sitz der sozialistischen Re-
gierung, traten der Parteicharakter und der Versuch, die Revolution mit Ge-
walt durchzusetzen und ihren Brand nach Westen nuszubreiten, am deutlichsten
hervor. Der Kampf der Finnländer wurde zum Befreiungskrieg gegen mor-
dende und plündernde Einbrecherbanden ohne jede soldatische Zucht. Die
moskowitische Zerstörungsgier konnte sich wieder einmal austoben. Ein Plan
anarchistischer Elemente ging sogar darauf aus, alle Bürger bis herab zum
zwölften Lebensjahr zu ermorden. Wer nur etwas besser gekleidet war,
schwebte stündlich in Lebensgefahr. Kein Eigentum wurde geachtet, kein
Recht anerkannt als das der rohen Gewalt. Um die schrecklich verstümmelten
Leichname ihrer Angehörige«: herauszubekommen, mußten die unglücklichen
Betroffenen noch hohe Summen zahle«:. Gegen solche Anarchie wäre der
Kainpf des freiwillige«: filmische«: Bauernheers und der bürgerliche«: Weiße«:
Garde trotz wiederholter Erfolge aussichtslos gewesen, wein: nicht auf de«:
Hilferuf der Hartbedrängtei: die deutsche«: Truppe«: herbeigeeilt wären. Vor
ihre««: eiserne«: Besen flohen die Horden, die nur gegelt Wehrlose tapfer sind.
Der „Friede mit Finnland" ist das Eingeständnis, daß die Revolutionierung
und neue Knechtuug Finnlands nur durch die rasche deutsche Hilfe vereitelt
werden konnte. Auch im Baltenland wurde«: die Deutschen als Befreier begrüßt.