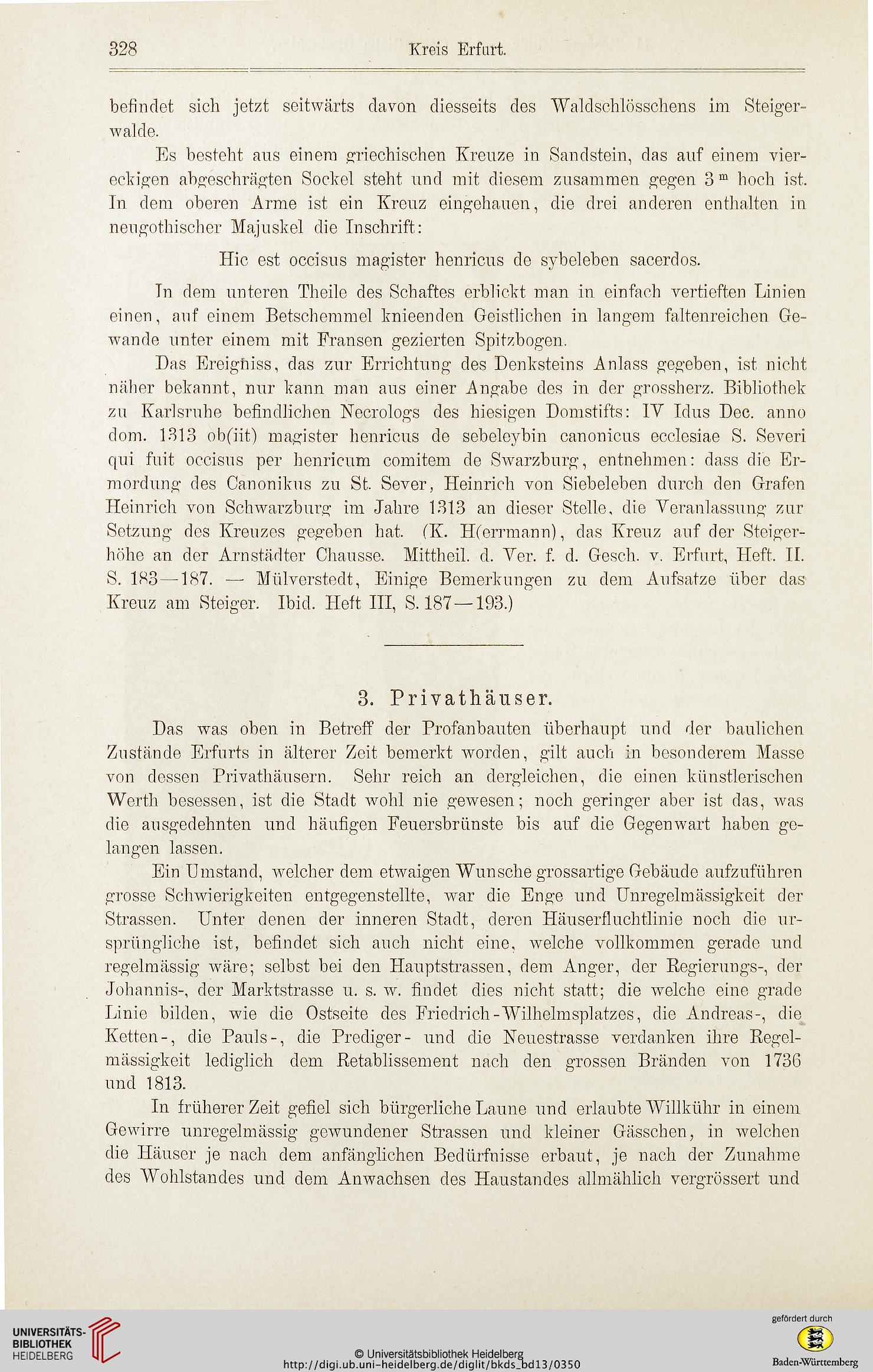Kreis Erfurt.
328
befindet sich jetzt seitwärts davon diesseits des Waldschlösschens im Steiger-
walde.
Es besteht ans einem griechischen Kreuze in Sandstein, das auf einem vier-
eckigen abgeschrägten Sockel steht und mit diesem zusammen gegen 3m hoch ist.
In dem oberen Arme ist ein Kreuz eingehauen, die drei anderen enthalten in
neugothischer Majuskel die Inschrift:
Hie est occisus magister henricus de sybeleben sacerdos.
In dem unteren Theile des Schaftes erblickt man in einfach vertieften Linien
einen, auf einem Betschemmel knieenden Geistlichen in langem faltenreichen Ge-
wände unter einem mit Fransen gezierten Spitzbogen.
Das Ereighiss, das zur Errichtung des Denksteins Anlass gegeben, ist nicht
näher bekannt, nur kann man aus einer Angabe des in der grossherz. Bibliothek
zu Karlsruhe befindlichen Necrologs des hiesigen Domstifts: IV Idus Dec. anno
dom. 1313 ob(iit) magister henricus de sebeleybin canonicus ecclesiae S. Severi
qui fuit occisus per henricum comitem de Swarzburg, entnehmen: dass die Er-
mordung des Cänonikus zu St. Sever, Heinrich von Siebeleben durch den Grafen
Heinrich von Schwarzburg im Jahre 1313 an dieser Stelle, die Veranlassung zur
Setzung des Kreuzes gegeben hat. (K. H(errmann), das Kreuz auf der Steiger-
höhe an der Arnstädter Chausse. Mittheil. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt, Heft. II.
S. 183 —187. — Mülverstedt, Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze über das
Kreuz am Steiger. Ibid. Heft III, S. 187 —193.)
3. Privathänser.
Das was oben in Betreff der Profanbauten überhaupt und der baulichen
Zustände Erfurts in älterer Zeit bemerkt worden, gilt auch in besonderem Masse
von dessen Privathäusern. Sehr reich an dergleichen, die einen künstlerischen
Werth besessen, ist die Stadt wohl nie gewesen; noch geringer aber ist das, Avas
die ausgedehnten und häufigen Feuersbrünste bis auf die Gegenwart haben ge-
langen lassen.
Ein Umstand, welcher dem etwaigen Wunsche grossartige Gebäude aufzuführen
grosse Schwierigkeiten entgegenstellte, war die Enge und Unregelmässigkeit der
Strassen. Unter denen der inneren Stadt, deren Häuserfluchtlinie noch die ur-
sprüngliche ist, befindet sich auch nicht eine, welche vollkommen gerade und
regelmässig wäre; selbst bei den Hauptstrassen, dem Anger, der Regierungs-, der
Johannis-, der Marktstrasse u. s. w. findet dies nicht statt; die welche eine grade
Linie bilden, wie die Ostseite des Friedrich-Wilhelmsplatzes, die Andreas-, die
Ketten-, die Pauls-, die Prediger- und die Neuestrasse verdanken ihre Regel-
mässigkeit lediglich dem Retablissement nach den grossen Bränden von 1736
und 1813.
In früherer Zeit gefiel sich bürgerliche Laune und erlaubte Willkühr in einem
Gewirre unregelmässig gewundener Strassen und kleiner Gässchen, in welchen
die Häuser je nach dem anfänglichen Bedürfnisse erbaut, je nach der Zunahme
des Wohlstandes und dem Anwachsen des Haustandes allmählich vergrössert und
328
befindet sich jetzt seitwärts davon diesseits des Waldschlösschens im Steiger-
walde.
Es besteht ans einem griechischen Kreuze in Sandstein, das auf einem vier-
eckigen abgeschrägten Sockel steht und mit diesem zusammen gegen 3m hoch ist.
In dem oberen Arme ist ein Kreuz eingehauen, die drei anderen enthalten in
neugothischer Majuskel die Inschrift:
Hie est occisus magister henricus de sybeleben sacerdos.
In dem unteren Theile des Schaftes erblickt man in einfach vertieften Linien
einen, auf einem Betschemmel knieenden Geistlichen in langem faltenreichen Ge-
wände unter einem mit Fransen gezierten Spitzbogen.
Das Ereighiss, das zur Errichtung des Denksteins Anlass gegeben, ist nicht
näher bekannt, nur kann man aus einer Angabe des in der grossherz. Bibliothek
zu Karlsruhe befindlichen Necrologs des hiesigen Domstifts: IV Idus Dec. anno
dom. 1313 ob(iit) magister henricus de sebeleybin canonicus ecclesiae S. Severi
qui fuit occisus per henricum comitem de Swarzburg, entnehmen: dass die Er-
mordung des Cänonikus zu St. Sever, Heinrich von Siebeleben durch den Grafen
Heinrich von Schwarzburg im Jahre 1313 an dieser Stelle, die Veranlassung zur
Setzung des Kreuzes gegeben hat. (K. H(errmann), das Kreuz auf der Steiger-
höhe an der Arnstädter Chausse. Mittheil. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt, Heft. II.
S. 183 —187. — Mülverstedt, Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze über das
Kreuz am Steiger. Ibid. Heft III, S. 187 —193.)
3. Privathänser.
Das was oben in Betreff der Profanbauten überhaupt und der baulichen
Zustände Erfurts in älterer Zeit bemerkt worden, gilt auch in besonderem Masse
von dessen Privathäusern. Sehr reich an dergleichen, die einen künstlerischen
Werth besessen, ist die Stadt wohl nie gewesen; noch geringer aber ist das, Avas
die ausgedehnten und häufigen Feuersbrünste bis auf die Gegenwart haben ge-
langen lassen.
Ein Umstand, welcher dem etwaigen Wunsche grossartige Gebäude aufzuführen
grosse Schwierigkeiten entgegenstellte, war die Enge und Unregelmässigkeit der
Strassen. Unter denen der inneren Stadt, deren Häuserfluchtlinie noch die ur-
sprüngliche ist, befindet sich auch nicht eine, welche vollkommen gerade und
regelmässig wäre; selbst bei den Hauptstrassen, dem Anger, der Regierungs-, der
Johannis-, der Marktstrasse u. s. w. findet dies nicht statt; die welche eine grade
Linie bilden, wie die Ostseite des Friedrich-Wilhelmsplatzes, die Andreas-, die
Ketten-, die Pauls-, die Prediger- und die Neuestrasse verdanken ihre Regel-
mässigkeit lediglich dem Retablissement nach den grossen Bränden von 1736
und 1813.
In früherer Zeit gefiel sich bürgerliche Laune und erlaubte Willkühr in einem
Gewirre unregelmässig gewundener Strassen und kleiner Gässchen, in welchen
die Häuser je nach dem anfänglichen Bedürfnisse erbaut, je nach der Zunahme
des Wohlstandes und dem Anwachsen des Haustandes allmählich vergrössert und