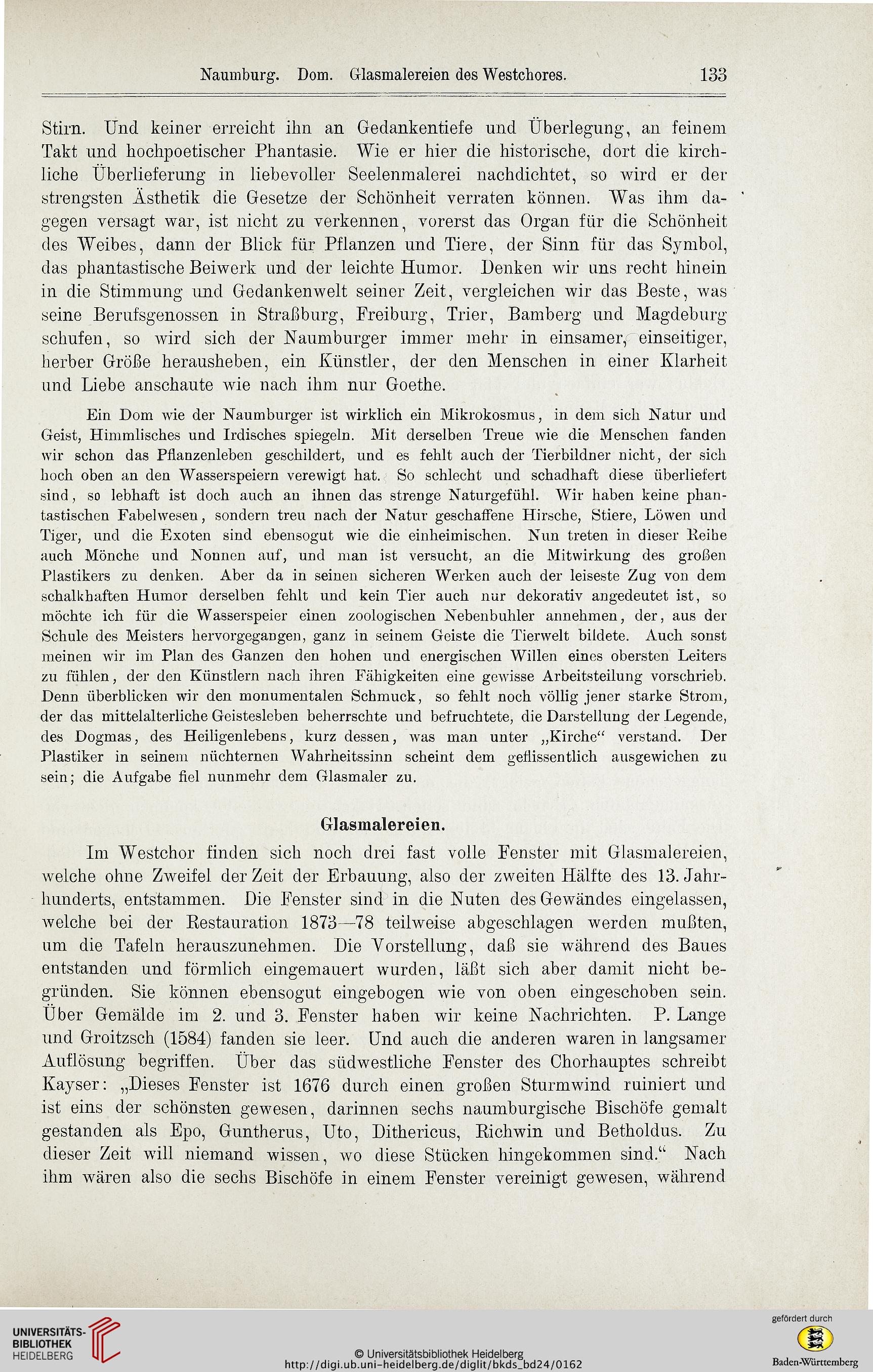Naumburg. Dom. Glasmalereien des Westchores.
133
Stirn. Und. keiner erreicht ihn an Gedankentiefe und Überlegung, an feinem
Takt und hochpoetischer Phantasie. Wie er hier die historische, dort die kirch-
liche Überlieferung in liebevoller Seelenmalerei nachdichtet, so wird er der
strengsten Ästhetik die Gesetze der Schönheit verraten können. Was ihm da-
gegen versagt war, ist nicht zu verkennen, vorerst das Organ für die Schönheit
des Weibes, dann der Blick für Pflanzen und Tiere, der Sinn für das Symbol,
das phantastische Beiwerk und der leichte Humor. Denken wir uns recht hinein
in die Stimmung und Gedankenwelt seiner Zeit, vergleichen wir das Beste, was
seine Berufsgenossen in Straßburg, Freiburg, Trier, Bamberg und Magdeburg
schufen, so wird sich der Naumburger immer mehr in einsamer, einseitiger,
herber Größe herausheben, ein Künstler, der den Menschen in einer Klarheit
und Liebe anschaute wie nach ihm nur Goethe.
Ein Dom wie der Naumburger ist wirklich ein Mikrokosmus, in dem sich Natur und
Geist, Himmlisches und Irdisches spiegeln. Mit derselben Treue wie die Menschen fanden
wir schon das Pflanzenleben geschildert, und es fehlt auch der Tierbildner nicht, der sich
hoch oben an den Wasserspeiern verewigt hat. So schlecht und schadhaft diese überliefert
sind, so lebhaft ist doch auch au ihnen das strenge Naturgefühl. Wir haben keine phan-
tastischen Fabelwesen, sondern treu nach der Natur geschaffene Hirsche, Stiere, Löwen und
Tiger, und die Exoten sind ebensogut wie die einheimischen. Nun treten in dieser Reihe
auch Mönche und Nonnen auf, und man ist versucht, an die Mitwirkung des großen
Plastikers zu denken. Aber da in seinen sicheren Werken auch der leiseste Zug von dem
schalkhaften Humor derselben fehlt und kein Tier auch nur dekorativ angedeutet ist, so
möchte ich für die Wasserspeier einen zoologischen Nebenbuhler annehmen, der, aus der
Schule des Meisters hervorgegangen, ganz in seinem Geiste die Tierwelt bildete. Auch sonst
meinen wir im Plan des Ganzen den hohen und energischen Willen eines obersten Leiters
zu fühlen, der den Künstlern nach ihren Fähigkeiten eine gewisse Arbeitsteilung vorschrieb.
Denn überblicken wir den monumentalen Schmuck, so fehlt noch völlig jener starke Strom,
der das mittelalterliche Geistesleben beherrschte und befruchtete, die Darstellung der Legende,
des Dogmas, des Heiligenlebens, kurz dessen, was man unter „Kirche“ verstand. Der
Plastiker in seinem nüchternen Wahrheitssinn scheint dem geflissentlich ausgewichen zu
sein; die Aufgabe fiel nunmehr dem Glasmaler zu.
Glasmalereien.
Im Westchor finden sich noch drei fast volle Fenster mit Glasmalereien,
welche ohne Zweifel derZeit. der Erbauung, also der zweiten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts, entstammen. Die Fenster sind in die Nuten des Gewändes eingelassen,
welche bei der Restauration 1873—78 teilweise abgeschlagen werden mußten,
um die Tafeln herauszunehmen. Die Vorstellung, daß sie während des Baues
entstanden und förmlich eingemauert wurden, läßt sich aber damit nicht be-
gründen. Sie können ebensogut eingebogen wie von oben eingeschoben sein.
Über Gemälde im 2. und 3. Fenster haben wir keine Nachrichten. P. Lange
und Groitzsch (1584) fanden sie leer. Und auch die anderen waren in langsamer
Auflösung begriffen. Über das südwestliche Fenster des Chorhauptes schreibt
Kayser: „Dieses Fenster ist 1676 durch einen großen Sturmwind ruiniert und
ist eins der schönsten gewesen, darinnen sechs naumburgische Bischöfe gemalt
gestanden als Epo, Guntherus, Uto, Dithericus, Richwin und Betholdus. Zu
dieser Zeit will niemand wissen, wo diese Stücken hingekommen sind.“ Nach
ihm wären also die sechs Bischöfe in einem Fenster vereinigt gewesen, während
133
Stirn. Und. keiner erreicht ihn an Gedankentiefe und Überlegung, an feinem
Takt und hochpoetischer Phantasie. Wie er hier die historische, dort die kirch-
liche Überlieferung in liebevoller Seelenmalerei nachdichtet, so wird er der
strengsten Ästhetik die Gesetze der Schönheit verraten können. Was ihm da-
gegen versagt war, ist nicht zu verkennen, vorerst das Organ für die Schönheit
des Weibes, dann der Blick für Pflanzen und Tiere, der Sinn für das Symbol,
das phantastische Beiwerk und der leichte Humor. Denken wir uns recht hinein
in die Stimmung und Gedankenwelt seiner Zeit, vergleichen wir das Beste, was
seine Berufsgenossen in Straßburg, Freiburg, Trier, Bamberg und Magdeburg
schufen, so wird sich der Naumburger immer mehr in einsamer, einseitiger,
herber Größe herausheben, ein Künstler, der den Menschen in einer Klarheit
und Liebe anschaute wie nach ihm nur Goethe.
Ein Dom wie der Naumburger ist wirklich ein Mikrokosmus, in dem sich Natur und
Geist, Himmlisches und Irdisches spiegeln. Mit derselben Treue wie die Menschen fanden
wir schon das Pflanzenleben geschildert, und es fehlt auch der Tierbildner nicht, der sich
hoch oben an den Wasserspeiern verewigt hat. So schlecht und schadhaft diese überliefert
sind, so lebhaft ist doch auch au ihnen das strenge Naturgefühl. Wir haben keine phan-
tastischen Fabelwesen, sondern treu nach der Natur geschaffene Hirsche, Stiere, Löwen und
Tiger, und die Exoten sind ebensogut wie die einheimischen. Nun treten in dieser Reihe
auch Mönche und Nonnen auf, und man ist versucht, an die Mitwirkung des großen
Plastikers zu denken. Aber da in seinen sicheren Werken auch der leiseste Zug von dem
schalkhaften Humor derselben fehlt und kein Tier auch nur dekorativ angedeutet ist, so
möchte ich für die Wasserspeier einen zoologischen Nebenbuhler annehmen, der, aus der
Schule des Meisters hervorgegangen, ganz in seinem Geiste die Tierwelt bildete. Auch sonst
meinen wir im Plan des Ganzen den hohen und energischen Willen eines obersten Leiters
zu fühlen, der den Künstlern nach ihren Fähigkeiten eine gewisse Arbeitsteilung vorschrieb.
Denn überblicken wir den monumentalen Schmuck, so fehlt noch völlig jener starke Strom,
der das mittelalterliche Geistesleben beherrschte und befruchtete, die Darstellung der Legende,
des Dogmas, des Heiligenlebens, kurz dessen, was man unter „Kirche“ verstand. Der
Plastiker in seinem nüchternen Wahrheitssinn scheint dem geflissentlich ausgewichen zu
sein; die Aufgabe fiel nunmehr dem Glasmaler zu.
Glasmalereien.
Im Westchor finden sich noch drei fast volle Fenster mit Glasmalereien,
welche ohne Zweifel derZeit. der Erbauung, also der zweiten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts, entstammen. Die Fenster sind in die Nuten des Gewändes eingelassen,
welche bei der Restauration 1873—78 teilweise abgeschlagen werden mußten,
um die Tafeln herauszunehmen. Die Vorstellung, daß sie während des Baues
entstanden und förmlich eingemauert wurden, läßt sich aber damit nicht be-
gründen. Sie können ebensogut eingebogen wie von oben eingeschoben sein.
Über Gemälde im 2. und 3. Fenster haben wir keine Nachrichten. P. Lange
und Groitzsch (1584) fanden sie leer. Und auch die anderen waren in langsamer
Auflösung begriffen. Über das südwestliche Fenster des Chorhauptes schreibt
Kayser: „Dieses Fenster ist 1676 durch einen großen Sturmwind ruiniert und
ist eins der schönsten gewesen, darinnen sechs naumburgische Bischöfe gemalt
gestanden als Epo, Guntherus, Uto, Dithericus, Richwin und Betholdus. Zu
dieser Zeit will niemand wissen, wo diese Stücken hingekommen sind.“ Nach
ihm wären also die sechs Bischöfe in einem Fenster vereinigt gewesen, während