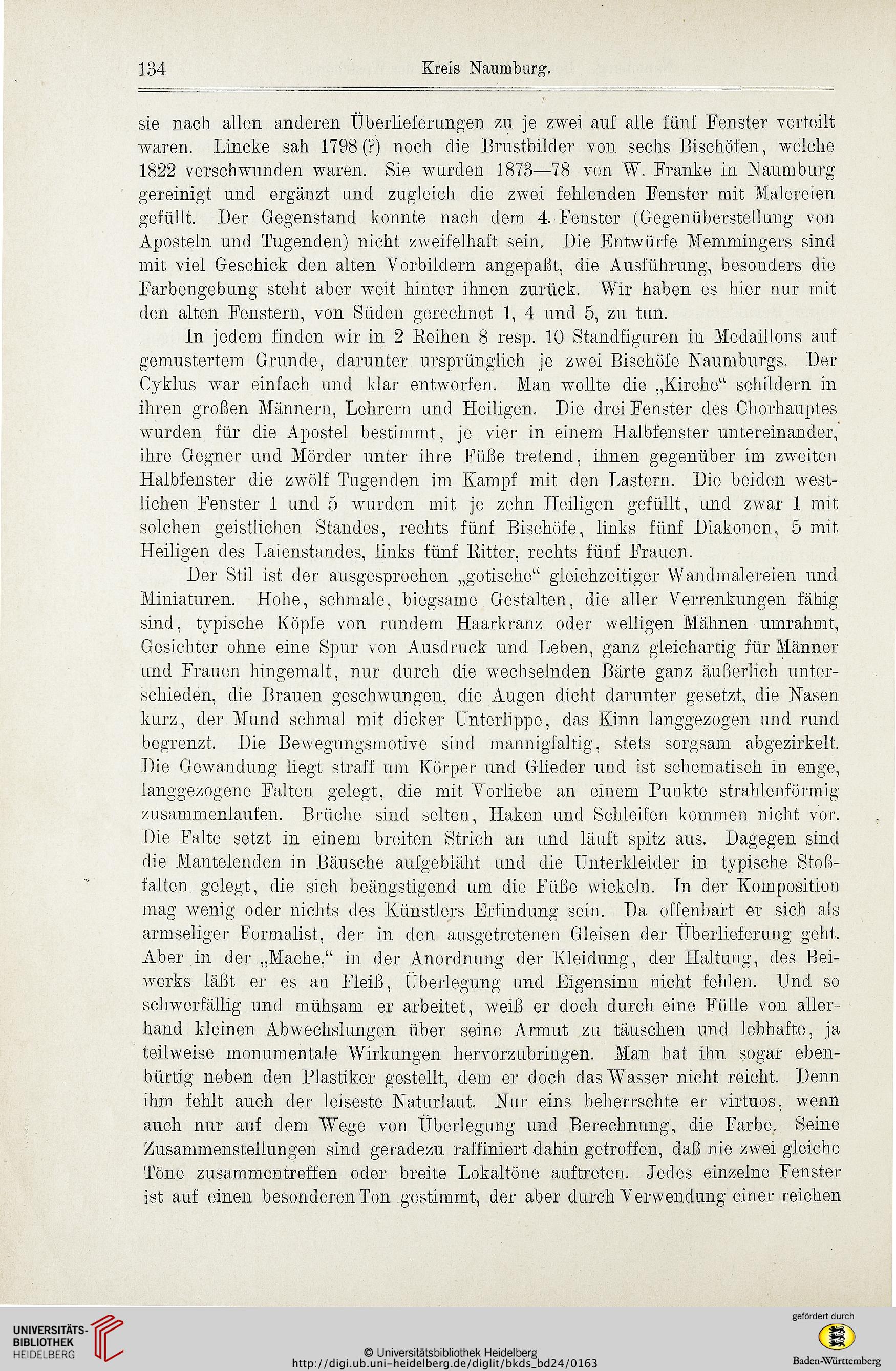134
Kreis Naumburg.
sie nach allen anderen Überlieferungen zu je zwei auf alle fünf Fenster verteilt
waren. Lincke sah 1798 (?) noch die Brustbilder von sechs Bischöfen, welche
1822 verschwunden waren. Sie wurden 1873—78 von W. Franke in Naumburg
gereinigt und ergänzt und zugleich die zwei fehlenden Fenster mit Malereien
gefüllt. Der Gegenstand konnte nach dem 4. Fenster (Gegenüberstellung von
Aposteln und Tugenden) nicht zweifelhaft sein.. Die Entwürfe Memmingers sind
mit viel Geschick den alten Vorbildern angepaßt, die Ausführung, besonders die
Farbengebung steht aber weit hinter ihnen zurück. Wir haben es hier nur mit
den alten Fenstern, von Süden gerechnet 1, 4 und 5, zu tun.
In jedem finden wir in 2 Reihen 8 resp. 10 Standfiguren in Medaillons auf
gemustertem Grunde, darunter ursprünglich je zwei Bischöfe Naumburgs. Der
Cyklus war einfach und klar entworfen. Man wollte die „Kirche“ schildern in
ihren großen Männern, Lehrern und Heiligen. Die drei Fenster des Chorhauptes
wurden für die Apostel bestimmt, je vier in einem Halbfenster untereinander,
ihre Gegner und Mörder unter ihre Füße tretend, ihnen gegenüber im zweiten
Halbfenster die zwölf Tugenden im Kampf mit den Lastern. Die beiden west-
lichen Fenster 1 und 5 wurden mit je zehn Heiligen gefüllt, und zwar 1 mit
solchen geistlichen Standes, rechts fünf Bischöfe, links fünf Diakonen, 5 mit
Heiligen des Laienstandes, links fünf Ritter, rechts fünf Frauen.
Der Stil ist der ausgesprochen „gotische“ gleichzeitiger Wandmalereien und
Miniaturen. Hohe, schmale, biegsame Gestalten, die aller Verrenkungen fähig
sind, typische Köpfe von rundem Haarkranz oder welligen Mähnen umrahmt,
Gesichter ohne eine Spur von Ausdruck und Leben, ganz gleichartig für Männer
und Frauen hingemalt, nur durch die wechselnden Bärte ganz äußerlich unter-
schieden, die Brauen geschwungen, die Augen dicht darunter gesetzt, die Nasen
kurz, der Mund schmal mit dicker Unterlippe, das Kinn langgezogen und rund
begrenzt. Die Bewegungsmotive sind mannigfaltig, stets sorgsam abgezirkelt.
Die Gewandung liegt straff um Körper und Glieder und ist schematisch in enge,
langgezogene Falten gelegt, die mit Vorliebe an einem Punkte strahlenförmig
zusammenlaufen. Brüche sind selten, Haken und Schleifen kommen nicht vor.
Die Falte setzt in einem breiten Strich an und läuft spitz aus. Dagegen sind
die Mantelenden in Bäusche aufgebläht und die Unterkleider in typische Stoß-
falten gelegt, die sich beängstigend um die Füße wickeln, ln der Komposition
mag wenig oder nichts des Künstlers Erfindung sein. Da offenbart er sich als
armseliger Formalist, der in den ausgetretenen Gleisen der Überlieferung geht.
Aber in der „Mache,“ in der Anordnung der Kleidung, der Haltung, des Bei-
werks läßt er es an Fleiß, Überlegung und Eigensinn nicht fehlen. Und so
schwerfällig und mühsam er arbeitet, weiß er doch durch eine Fülle von aller-
hand kleinen Abwechslungen über seine Armut zu täuschen und lebhafte, ja
teilweise monumentale Wirkungen hervorzubringen. Man hat ihn sogar eben-
bürtig neben den Plastiker gestellt, dem er doch das Wasser nicht reicht. Denn
ihm fehlt auch der leiseste Naturlaut. Nur eins beherrschte er virtuos, wenn
auch nur auf dem Wege von Überlegung und Berechnung, die Farbe. Seine
Zusammenstellungen sind geradezu raffiniert dahin getroffen, daß nie zwei gleiche
Töne Zusammentreffen oder breite Lokaltöne auftreten. Jedes einzelne Fenster
ist auf einen besonderen Ton gestimmt, der aber durch Verwendung einer reichen
Kreis Naumburg.
sie nach allen anderen Überlieferungen zu je zwei auf alle fünf Fenster verteilt
waren. Lincke sah 1798 (?) noch die Brustbilder von sechs Bischöfen, welche
1822 verschwunden waren. Sie wurden 1873—78 von W. Franke in Naumburg
gereinigt und ergänzt und zugleich die zwei fehlenden Fenster mit Malereien
gefüllt. Der Gegenstand konnte nach dem 4. Fenster (Gegenüberstellung von
Aposteln und Tugenden) nicht zweifelhaft sein.. Die Entwürfe Memmingers sind
mit viel Geschick den alten Vorbildern angepaßt, die Ausführung, besonders die
Farbengebung steht aber weit hinter ihnen zurück. Wir haben es hier nur mit
den alten Fenstern, von Süden gerechnet 1, 4 und 5, zu tun.
In jedem finden wir in 2 Reihen 8 resp. 10 Standfiguren in Medaillons auf
gemustertem Grunde, darunter ursprünglich je zwei Bischöfe Naumburgs. Der
Cyklus war einfach und klar entworfen. Man wollte die „Kirche“ schildern in
ihren großen Männern, Lehrern und Heiligen. Die drei Fenster des Chorhauptes
wurden für die Apostel bestimmt, je vier in einem Halbfenster untereinander,
ihre Gegner und Mörder unter ihre Füße tretend, ihnen gegenüber im zweiten
Halbfenster die zwölf Tugenden im Kampf mit den Lastern. Die beiden west-
lichen Fenster 1 und 5 wurden mit je zehn Heiligen gefüllt, und zwar 1 mit
solchen geistlichen Standes, rechts fünf Bischöfe, links fünf Diakonen, 5 mit
Heiligen des Laienstandes, links fünf Ritter, rechts fünf Frauen.
Der Stil ist der ausgesprochen „gotische“ gleichzeitiger Wandmalereien und
Miniaturen. Hohe, schmale, biegsame Gestalten, die aller Verrenkungen fähig
sind, typische Köpfe von rundem Haarkranz oder welligen Mähnen umrahmt,
Gesichter ohne eine Spur von Ausdruck und Leben, ganz gleichartig für Männer
und Frauen hingemalt, nur durch die wechselnden Bärte ganz äußerlich unter-
schieden, die Brauen geschwungen, die Augen dicht darunter gesetzt, die Nasen
kurz, der Mund schmal mit dicker Unterlippe, das Kinn langgezogen und rund
begrenzt. Die Bewegungsmotive sind mannigfaltig, stets sorgsam abgezirkelt.
Die Gewandung liegt straff um Körper und Glieder und ist schematisch in enge,
langgezogene Falten gelegt, die mit Vorliebe an einem Punkte strahlenförmig
zusammenlaufen. Brüche sind selten, Haken und Schleifen kommen nicht vor.
Die Falte setzt in einem breiten Strich an und läuft spitz aus. Dagegen sind
die Mantelenden in Bäusche aufgebläht und die Unterkleider in typische Stoß-
falten gelegt, die sich beängstigend um die Füße wickeln, ln der Komposition
mag wenig oder nichts des Künstlers Erfindung sein. Da offenbart er sich als
armseliger Formalist, der in den ausgetretenen Gleisen der Überlieferung geht.
Aber in der „Mache,“ in der Anordnung der Kleidung, der Haltung, des Bei-
werks läßt er es an Fleiß, Überlegung und Eigensinn nicht fehlen. Und so
schwerfällig und mühsam er arbeitet, weiß er doch durch eine Fülle von aller-
hand kleinen Abwechslungen über seine Armut zu täuschen und lebhafte, ja
teilweise monumentale Wirkungen hervorzubringen. Man hat ihn sogar eben-
bürtig neben den Plastiker gestellt, dem er doch das Wasser nicht reicht. Denn
ihm fehlt auch der leiseste Naturlaut. Nur eins beherrschte er virtuos, wenn
auch nur auf dem Wege von Überlegung und Berechnung, die Farbe. Seine
Zusammenstellungen sind geradezu raffiniert dahin getroffen, daß nie zwei gleiche
Töne Zusammentreffen oder breite Lokaltöne auftreten. Jedes einzelne Fenster
ist auf einen besonderen Ton gestimmt, der aber durch Verwendung einer reichen