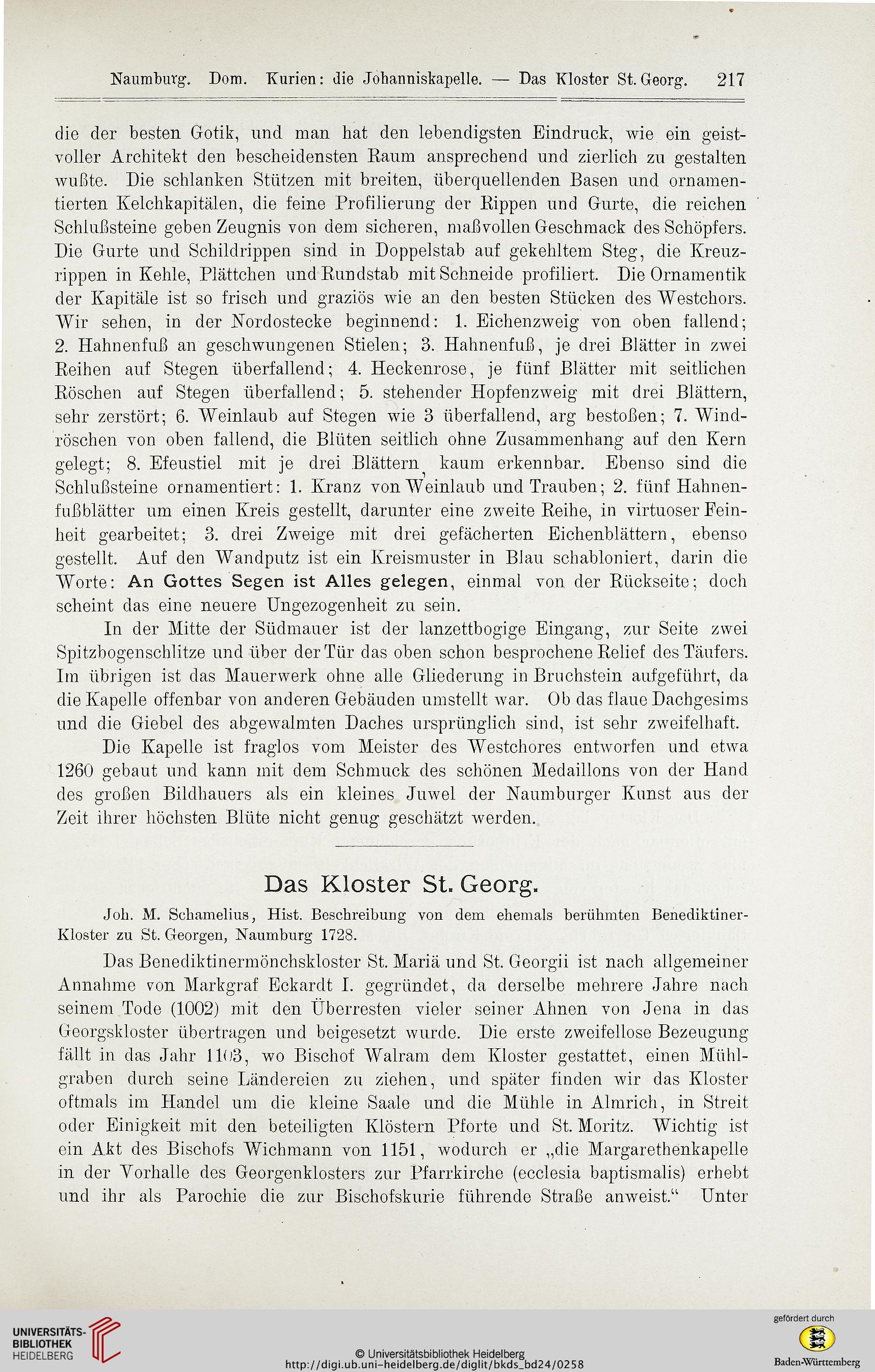Naumburg. Dom. Kurien: die Johanniskapelle. — Das Kloster St. Georg.
217
die der besten Gotik, und man hat den lebendigsten Eindruck, wie ein geist-
voller Architekt den bescheidensten Raum ansprechend und zierlich zu gestalten
wußte. Die schlanken Stützen mit breiten, überquellenden Basen und ornamen-
tierten Kelchkapitälen, die feine Profilierung der Rippen und Gurte, die reichen
Schlußsteine geben Zeugnis von dem sicheren, maßvollen Geschmack des Schöpfers.
Die Gurte und Schildrippen sind in Doppelstab auf gekehltem Steg, die Kreuz-
rippen in Kehle, Plättchen und Rundstab mit Schneide profiliert. Die Ornamentik
der Kapitale ist so frisch und graziös wie an den besten Stücken des Westchors.
Wir sehen, in der Nordostecke beginnend: 1. Eichenzweig von oben fallend;
2. Hahnenfuß an geschwungenen Stielen; 3. Hahnenfuß, je drei Blätter in zwei
Reihen auf Stegen überfallend; 4. Heckenrose, je fünf Blätter mit seitlichen
Röschen auf Stegen überfallend; 5. stehender Hopfenzweig mit drei Blättern,
sehr zerstört; 6. Weinlaub auf Stegen wie 3 überfallend, arg bestoßen; 7. Wind-
röschen von oben fallend, die Blüten seitlich ohne Zusammenhang auf den Kern
gelegt; 8. Efeustiel mit je drei Blättern kaum erkennbar. Ebenso sind die
Schlußsteine ornamentiert: 1. Kranz von Weinlaub und Trauben; 2. fünf Hahnen-
fußblätter um einen Kreis gestellt, darunter eine zweite Reihe, in virtuoser Fein-
heit gearbeitet; 3. drei Zweige mit drei gefächerten Eichenblättern, ebenso
gestellt. Auf den Wandputz ist ein Kreismuster in Blau schabloniert, darin die
Worte: An Gottes Segen ist Alles gelegen, einmal von der Rückseite; doch
scheint das eine neuere Ungezogenheit zu sein.
In der Mitte der Südmauer ist der lanzettbogige Eingang, zur Seite zwei
Spitzbogenschlitze und über der Tür das oben schon besprochene Relief des Täufers.
Im übrigen ist das Mauerwerk ohne alle Gliederung in Bruchstein aufgeführt, da
die Kapelle offenbar von anderen Gebäuden umstellt wrar. Ob das flaue Dachgesims
und die Giebel des abgewmlmten Daches ursprünglich sind, ist sehr zweifelhaft.
Die Kapelle ist fraglos vom Meister des Westchores entworfen und etwa
1260 gebaut und kann mit dem Schmuck des schönen Medaillons von der Hand
des großen Bildhauers als ein kleines Juwel der Kaumburger Kunst aus der
Zeit ihrer höchsten Blüte nicht genug geschätzt werden.
Das Kloster St. Georg.
Job. M. Schamelms, Hist. Beschreibung von dem ehemals berühmten Benediktiner-
Kloster zu St. Georgen, Naumburg 1728.
Das Benediktinermönchskloster St. Mariä und St. Georgii ist nach allgemeiner
Annahme von Markgraf Eckardt I. gegründet, da derselbe mehrere Jahre nach
seinem Tode (1002) mit den Überresten vieler seiner Ahnen von Jena in das
Georgskloster übertragen und beigesetzt wurde. Die erste zweifellose Bezeugung
fällt in das Jahr 1103, wo Bischof Walram dem Kloster gestattet, einen Mühl-
graben durch seine Ländereien zu ziehen, und später finden wir das Kloster
oftmals im Handel um die kleine Saale und die Mühle in Almrich, in Streit
oder Einigkeit mit den beteiligten Klöstern Pforte und St. Moritz. AVichtig ist
ein Akt des Bischofs Wichmann von 1151, wodurch er „die Margarethenkapelle
in der Vorhalle des Georgenklosters zur Pfarrkirche (ecclesia baptismalis) erhebt
und ihr als Parochie die zur Bischofskurie führende Straße anweist.“ Unter
217
die der besten Gotik, und man hat den lebendigsten Eindruck, wie ein geist-
voller Architekt den bescheidensten Raum ansprechend und zierlich zu gestalten
wußte. Die schlanken Stützen mit breiten, überquellenden Basen und ornamen-
tierten Kelchkapitälen, die feine Profilierung der Rippen und Gurte, die reichen
Schlußsteine geben Zeugnis von dem sicheren, maßvollen Geschmack des Schöpfers.
Die Gurte und Schildrippen sind in Doppelstab auf gekehltem Steg, die Kreuz-
rippen in Kehle, Plättchen und Rundstab mit Schneide profiliert. Die Ornamentik
der Kapitale ist so frisch und graziös wie an den besten Stücken des Westchors.
Wir sehen, in der Nordostecke beginnend: 1. Eichenzweig von oben fallend;
2. Hahnenfuß an geschwungenen Stielen; 3. Hahnenfuß, je drei Blätter in zwei
Reihen auf Stegen überfallend; 4. Heckenrose, je fünf Blätter mit seitlichen
Röschen auf Stegen überfallend; 5. stehender Hopfenzweig mit drei Blättern,
sehr zerstört; 6. Weinlaub auf Stegen wie 3 überfallend, arg bestoßen; 7. Wind-
röschen von oben fallend, die Blüten seitlich ohne Zusammenhang auf den Kern
gelegt; 8. Efeustiel mit je drei Blättern kaum erkennbar. Ebenso sind die
Schlußsteine ornamentiert: 1. Kranz von Weinlaub und Trauben; 2. fünf Hahnen-
fußblätter um einen Kreis gestellt, darunter eine zweite Reihe, in virtuoser Fein-
heit gearbeitet; 3. drei Zweige mit drei gefächerten Eichenblättern, ebenso
gestellt. Auf den Wandputz ist ein Kreismuster in Blau schabloniert, darin die
Worte: An Gottes Segen ist Alles gelegen, einmal von der Rückseite; doch
scheint das eine neuere Ungezogenheit zu sein.
In der Mitte der Südmauer ist der lanzettbogige Eingang, zur Seite zwei
Spitzbogenschlitze und über der Tür das oben schon besprochene Relief des Täufers.
Im übrigen ist das Mauerwerk ohne alle Gliederung in Bruchstein aufgeführt, da
die Kapelle offenbar von anderen Gebäuden umstellt wrar. Ob das flaue Dachgesims
und die Giebel des abgewmlmten Daches ursprünglich sind, ist sehr zweifelhaft.
Die Kapelle ist fraglos vom Meister des Westchores entworfen und etwa
1260 gebaut und kann mit dem Schmuck des schönen Medaillons von der Hand
des großen Bildhauers als ein kleines Juwel der Kaumburger Kunst aus der
Zeit ihrer höchsten Blüte nicht genug geschätzt werden.
Das Kloster St. Georg.
Job. M. Schamelms, Hist. Beschreibung von dem ehemals berühmten Benediktiner-
Kloster zu St. Georgen, Naumburg 1728.
Das Benediktinermönchskloster St. Mariä und St. Georgii ist nach allgemeiner
Annahme von Markgraf Eckardt I. gegründet, da derselbe mehrere Jahre nach
seinem Tode (1002) mit den Überresten vieler seiner Ahnen von Jena in das
Georgskloster übertragen und beigesetzt wurde. Die erste zweifellose Bezeugung
fällt in das Jahr 1103, wo Bischof Walram dem Kloster gestattet, einen Mühl-
graben durch seine Ländereien zu ziehen, und später finden wir das Kloster
oftmals im Handel um die kleine Saale und die Mühle in Almrich, in Streit
oder Einigkeit mit den beteiligten Klöstern Pforte und St. Moritz. AVichtig ist
ein Akt des Bischofs Wichmann von 1151, wodurch er „die Margarethenkapelle
in der Vorhalle des Georgenklosters zur Pfarrkirche (ecclesia baptismalis) erhebt
und ihr als Parochie die zur Bischofskurie führende Straße anweist.“ Unter