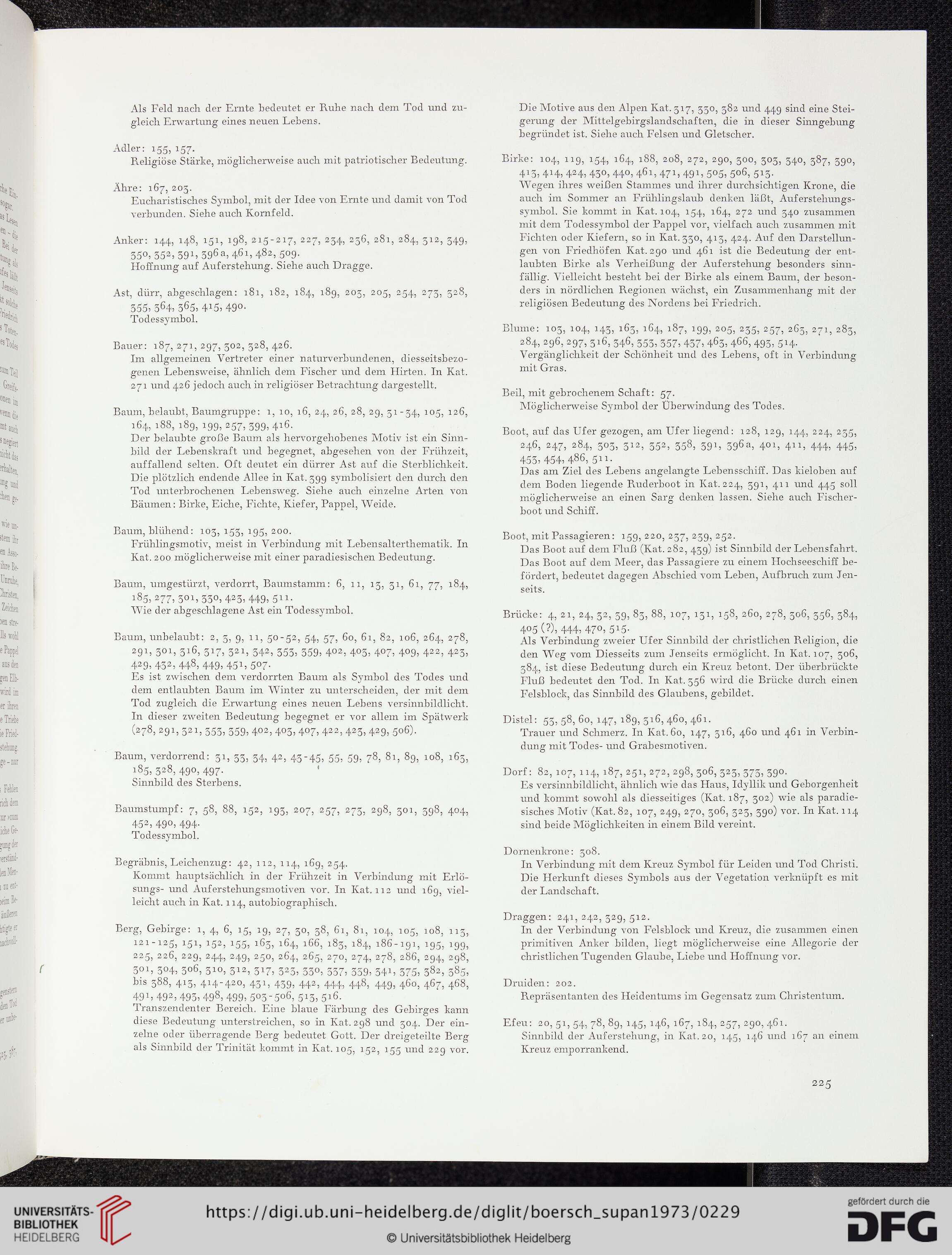Als Feld nach, der Ernte bedeutet er Ruhe nach dem Tod und zu-
gleich Erwartung eines neuen Lebens.
Adler: 155, 157.
Religiöse Stärke, möglicherweise auch mit patriotischer Bedeutung.
Ähre: 167, 205.
Eucharistisches Symbol, mit der Idee von Ernte und damit von Tod
verbunden. Siehe auch Kornfeld.
Anker: 144, 148, 151, 198, 215-217, 227, 234, 236, 281, 284, 312, 349,
35°, 352, 391, 396a, 461, 482, 5°9-
Hoffnung auf Auferstehung. Siehe auch Dragge.
Ast, dürr, abgeschlagen: 181, 182, 184, 189, 203, 205, 254, 273, 328,
355, 364, 365, 4*5, 49°-
Todessymbol.
Bauer: 187, 271, 297, 302, 328, 426.
Im allgemeinen Vertreter einer naturverbundenen, diesseitsbezo-
genen Lebensweise, ähnlich dem Fischer und dem Hirten. In Kat.
271 und 426 jedoch auch in religiöser Betrachtung dargestellt.
Baum, belaubt, Baumgruppe: 1, 10, 16, 24, 26, 28, 29, 31-34, 105, 126,
164, 188, 189, 199, 257, 399, 416.
Der belaubte große Baum als hervorgehobenes Motiv ist ein Sinn-
bild der Lebenskraft und begegnet, abgesehen von der Frühzeit,
auffallend selten. Oft deutet ein dürrer Ast auf die Sterblichkeit.
Die plötzlich endende Allee in Kat. 399 symbolisiert den durch den
Tod unterbrochenen Lebensweg. Siehe auch einzelne Arten von
Bäumen: Birke, Eiche, Fichte, Kiefer, Pappel, Weide.
Baum, blühend: 103, 153, 195, 200.
Frühlingsmotiv, meist in Verbindung mit Lebensalterthematik. In
Kat. 200 möglicherweise mit einer paradiesischen Bedeutung.
Baum, umgestürzt, verdorrt, Baumstamm: 6, 11, 13, 31, 61, 77, 184,
185, 277, 301, 33°, 423, 449, 511-
Wie der abgeschlagene Ast ein Todessymbol.
Baum, unbelaubt: 2, 3, 9, 11, 50-52, 54, 57, 60, 61, 82, 106, 264, 278,
29L 301, 316, 3Z7, 521, 342, 353, 359, 402, 4°3, 4°7, 4°9, 422, 423,
429, 432,448, 449, 451,507.
Es ist zwischen dem verdorrten Baum als Symbol des Todes und
dem entlaubten Baum im Winter zu unterscheiden, der mit dem
Tod zugleich die Erwartung eines neuen Lebens versinnbildlicht.
In dieser zweiten Bedeutung begegnet er vor allem im Spätwerk
(278, 291, 321, 353, 359, 402,4°3,4°7, 422, 423,429, 5°6)-
Baum, verdorrend: 31, 33, 34, 42, 43-45, 55, 59, 78, 81, 89, 108, 163,
185, 328, 490, 497.
Sinnbild des Sterbens.
Baumstumpf: 7, 58, 88, 152, 193, 207, 257, 273, 298, 301, 398, 404,
452, 49°, 494-
Todessymbol.
Begräbnis, Leichenzug: 42, 112, 114, 169, 254.
Kommt hauptsächlich in der Frühzeit in Verbindung mit Erlö-
sungs- und Auferstehungsmotiven vor. In Kat. 112 und 169, viel-
leicht auch in Kat. 114, autobiographisch.
Berg, Gebirge: 1, 4, 6, 15, 19, 27, 30, 38, 61, 81, 104, 105, 108, 113,
121-125, 151, 152, 155, 183, 184, 166, 183, 184, 186-191, 195, 199,
225, 226, 229, 244, 249, 250, 264, 265, 270, 274, 278, 286, 294, 298,
301, 304, 306, 310, 312, 317, 323, 330, 337, 339, 341, 375, 382, 385,
bis 388, 413, 414-420, 431, 439, 442, 444, 448, 449, 460, 467, 468,
491, 492, 493, 498, 499, 5°3-5°6, 5^3» 516-
Transzendenter Bereich. Eine blaue Färbung des Gebirges kann
diese Bedeutung unterstreichen, so in Kat. 298 und 304. Der ein-
zelne oder überragende Berg bedeutet Gott. Der dreigeteilte Berg
als Sinnbild der Trinität kommt in Kat. 105, 152, 155 und 229 vor.
Die Motive aus den Alpen Kat. 317, 330, 382 und 449 sind eine Stei-
gerung der Mittelgebirgslandschaften, die in dieser Sinngebung
begründet ist. Siehe auch Felsen und Gletscher.
Birke: 104, 119, 154, 164, 188, 208, 272, 290, 300, 303, 340, 387, 390,
413, 414, 424, 430, 440, 461, 471, 491, 505, 506, 513.
Wegen ihres weißen Stammes und ihrer durchsichtigen Krone, die
auch im Sommer an Frühlingslaub denken läßt, Auferstehungs-
symbol. Sie kommt in Kat. 104, 154, 164, 272 und 340 zusammen
mit dem Todessymbol der Pappel vor, vielfach auch zusammen mit
Fichten oder Kiefern, so in Kat. 330, 413, 424. Auf den Darstellun-
gen von Friedhöfen Kat. 290 und 461 ist die Bedeutung der ent-
laubten Birke als Verheißung der Auferstehung besonders sinn-
fällig. Vielleicht besteht bei der Birke als einem Baum, der beson-
ders in nördlichen Regionen wächst, ein Zusammenhang mit der
religiösen Bedeutung des Nordens bei Friedrich.
Blume: 103, 104, 143, 163, 164, 187, 199, 205, 235, 257, 263, 271, 283,
284, 296, 297, 316, 346, 353, 357, 437, 463, 466, 493, 514.
Vergänglichkeit der Schönheit und des Lebens, oft in Verbindung
mit Gras.
Beil, mit gebrochenem Schaft: 57.
Möglicherweise Symbol der Überwindung des Todes.
Boot, auf das Ufer gezogen, am Ufer liegend: 128, 129, 144, 224, 235,
246, 247, 284, 303, 312, 352, 358, 391, 396 a, 401, 411, 444, 445,
453, 454, 486, 511-
Das am Ziel des Lebens angelangte Lebensschiff. Das kieloben auf
dem Boden liegende Ruderboot in Kat. 224, 391, 411 und 445 soll
möglicherweise an einen Sarg denken lassen. Siehe auch Fischer-
boot und Schiff.
Boot, mit Passagieren: 159, 220, 237, 239, 252.
Das Boot auf dem Fluß (Kat. 282, 439) ist Sinnbild der Lebensfahrt.
Das Boot auf dem Meer, das Passagiere zu einem Hochseeschiff be-
fördert, bedeutet dagegen Abschied vom Leben, Aufbruch zum Jen-
seits.
Brücke: 4, 21, 24, 32, 39, 83, 88, 107, 131, 158, 260, 278, 306, 356, 384,
405 (?), 444, 47°, 515.
Als Verbindung zweier Ufer Sinnbild der christlichen Religion, die
den Weg vom Diesseits zum Jenseits ermöglicht. In Kat. 107, 306,
384, ist diese Bedeutung durch ein Kreuz betont. Der überbrückte
Fluß bedeutet den Tod. In Kat. 356 wird die Brücke durch einen
Felsblock, das Sinnbild des Glaubens, gebildet.
Distel: 53, 58, 60, 147, 189, 316, 460, 461.
Trauer und Schmerz. In Kat. 60, 147, 316, 460 und 461 in Verbin-
dung mit Todes- und Grabesmotiven.
Dorf: 82, 107, 114, 187, 251, 272, 298, 306, 323, 373, 390.
Es versinnbildlicht, ähnlich wie das Haus, Idyllik und Geborgenheit
und kommt sowohl als diesseitiges (Kat. 187, 302) wie als paradie-
sisches Motiv (Kat. 82, 107, 249, 270, 306, 323, 390) vor. In Kat. 114
sind beide Möglichkeiten in einem Bild vereint.
Dornenkrone: 308.
In Verbindung mit dem Kreuz Symbol für Leiden und Tod Christi.
Die Herkunft dieses Symbols aus der Vegetation verknüpft es mit
der Landschaft.
Draggen: 241,242,329,512.
In der Verbindung von Felsblock und Kreuz, die zusammen einen
primitiven Anker bilden, liegt möglicherweise eine Allegorie der
christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung vor.
Druiden: 202.
Repräsentanten des Heidentums im Gegensatz zum Christentum.
Efeu: 20, 51, 54, 78, 89, 145, 146, 167, 184, 257, 290, 461.
Sinnbild der Auferstehung, in Kat. 20, 145, 146 und 167 an einem
Kreuz emporrankend.
gleich Erwartung eines neuen Lebens.
Adler: 155, 157.
Religiöse Stärke, möglicherweise auch mit patriotischer Bedeutung.
Ähre: 167, 205.
Eucharistisches Symbol, mit der Idee von Ernte und damit von Tod
verbunden. Siehe auch Kornfeld.
Anker: 144, 148, 151, 198, 215-217, 227, 234, 236, 281, 284, 312, 349,
35°, 352, 391, 396a, 461, 482, 5°9-
Hoffnung auf Auferstehung. Siehe auch Dragge.
Ast, dürr, abgeschlagen: 181, 182, 184, 189, 203, 205, 254, 273, 328,
355, 364, 365, 4*5, 49°-
Todessymbol.
Bauer: 187, 271, 297, 302, 328, 426.
Im allgemeinen Vertreter einer naturverbundenen, diesseitsbezo-
genen Lebensweise, ähnlich dem Fischer und dem Hirten. In Kat.
271 und 426 jedoch auch in religiöser Betrachtung dargestellt.
Baum, belaubt, Baumgruppe: 1, 10, 16, 24, 26, 28, 29, 31-34, 105, 126,
164, 188, 189, 199, 257, 399, 416.
Der belaubte große Baum als hervorgehobenes Motiv ist ein Sinn-
bild der Lebenskraft und begegnet, abgesehen von der Frühzeit,
auffallend selten. Oft deutet ein dürrer Ast auf die Sterblichkeit.
Die plötzlich endende Allee in Kat. 399 symbolisiert den durch den
Tod unterbrochenen Lebensweg. Siehe auch einzelne Arten von
Bäumen: Birke, Eiche, Fichte, Kiefer, Pappel, Weide.
Baum, blühend: 103, 153, 195, 200.
Frühlingsmotiv, meist in Verbindung mit Lebensalterthematik. In
Kat. 200 möglicherweise mit einer paradiesischen Bedeutung.
Baum, umgestürzt, verdorrt, Baumstamm: 6, 11, 13, 31, 61, 77, 184,
185, 277, 301, 33°, 423, 449, 511-
Wie der abgeschlagene Ast ein Todessymbol.
Baum, unbelaubt: 2, 3, 9, 11, 50-52, 54, 57, 60, 61, 82, 106, 264, 278,
29L 301, 316, 3Z7, 521, 342, 353, 359, 402, 4°3, 4°7, 4°9, 422, 423,
429, 432,448, 449, 451,507.
Es ist zwischen dem verdorrten Baum als Symbol des Todes und
dem entlaubten Baum im Winter zu unterscheiden, der mit dem
Tod zugleich die Erwartung eines neuen Lebens versinnbildlicht.
In dieser zweiten Bedeutung begegnet er vor allem im Spätwerk
(278, 291, 321, 353, 359, 402,4°3,4°7, 422, 423,429, 5°6)-
Baum, verdorrend: 31, 33, 34, 42, 43-45, 55, 59, 78, 81, 89, 108, 163,
185, 328, 490, 497.
Sinnbild des Sterbens.
Baumstumpf: 7, 58, 88, 152, 193, 207, 257, 273, 298, 301, 398, 404,
452, 49°, 494-
Todessymbol.
Begräbnis, Leichenzug: 42, 112, 114, 169, 254.
Kommt hauptsächlich in der Frühzeit in Verbindung mit Erlö-
sungs- und Auferstehungsmotiven vor. In Kat. 112 und 169, viel-
leicht auch in Kat. 114, autobiographisch.
Berg, Gebirge: 1, 4, 6, 15, 19, 27, 30, 38, 61, 81, 104, 105, 108, 113,
121-125, 151, 152, 155, 183, 184, 166, 183, 184, 186-191, 195, 199,
225, 226, 229, 244, 249, 250, 264, 265, 270, 274, 278, 286, 294, 298,
301, 304, 306, 310, 312, 317, 323, 330, 337, 339, 341, 375, 382, 385,
bis 388, 413, 414-420, 431, 439, 442, 444, 448, 449, 460, 467, 468,
491, 492, 493, 498, 499, 5°3-5°6, 5^3» 516-
Transzendenter Bereich. Eine blaue Färbung des Gebirges kann
diese Bedeutung unterstreichen, so in Kat. 298 und 304. Der ein-
zelne oder überragende Berg bedeutet Gott. Der dreigeteilte Berg
als Sinnbild der Trinität kommt in Kat. 105, 152, 155 und 229 vor.
Die Motive aus den Alpen Kat. 317, 330, 382 und 449 sind eine Stei-
gerung der Mittelgebirgslandschaften, die in dieser Sinngebung
begründet ist. Siehe auch Felsen und Gletscher.
Birke: 104, 119, 154, 164, 188, 208, 272, 290, 300, 303, 340, 387, 390,
413, 414, 424, 430, 440, 461, 471, 491, 505, 506, 513.
Wegen ihres weißen Stammes und ihrer durchsichtigen Krone, die
auch im Sommer an Frühlingslaub denken läßt, Auferstehungs-
symbol. Sie kommt in Kat. 104, 154, 164, 272 und 340 zusammen
mit dem Todessymbol der Pappel vor, vielfach auch zusammen mit
Fichten oder Kiefern, so in Kat. 330, 413, 424. Auf den Darstellun-
gen von Friedhöfen Kat. 290 und 461 ist die Bedeutung der ent-
laubten Birke als Verheißung der Auferstehung besonders sinn-
fällig. Vielleicht besteht bei der Birke als einem Baum, der beson-
ders in nördlichen Regionen wächst, ein Zusammenhang mit der
religiösen Bedeutung des Nordens bei Friedrich.
Blume: 103, 104, 143, 163, 164, 187, 199, 205, 235, 257, 263, 271, 283,
284, 296, 297, 316, 346, 353, 357, 437, 463, 466, 493, 514.
Vergänglichkeit der Schönheit und des Lebens, oft in Verbindung
mit Gras.
Beil, mit gebrochenem Schaft: 57.
Möglicherweise Symbol der Überwindung des Todes.
Boot, auf das Ufer gezogen, am Ufer liegend: 128, 129, 144, 224, 235,
246, 247, 284, 303, 312, 352, 358, 391, 396 a, 401, 411, 444, 445,
453, 454, 486, 511-
Das am Ziel des Lebens angelangte Lebensschiff. Das kieloben auf
dem Boden liegende Ruderboot in Kat. 224, 391, 411 und 445 soll
möglicherweise an einen Sarg denken lassen. Siehe auch Fischer-
boot und Schiff.
Boot, mit Passagieren: 159, 220, 237, 239, 252.
Das Boot auf dem Fluß (Kat. 282, 439) ist Sinnbild der Lebensfahrt.
Das Boot auf dem Meer, das Passagiere zu einem Hochseeschiff be-
fördert, bedeutet dagegen Abschied vom Leben, Aufbruch zum Jen-
seits.
Brücke: 4, 21, 24, 32, 39, 83, 88, 107, 131, 158, 260, 278, 306, 356, 384,
405 (?), 444, 47°, 515.
Als Verbindung zweier Ufer Sinnbild der christlichen Religion, die
den Weg vom Diesseits zum Jenseits ermöglicht. In Kat. 107, 306,
384, ist diese Bedeutung durch ein Kreuz betont. Der überbrückte
Fluß bedeutet den Tod. In Kat. 356 wird die Brücke durch einen
Felsblock, das Sinnbild des Glaubens, gebildet.
Distel: 53, 58, 60, 147, 189, 316, 460, 461.
Trauer und Schmerz. In Kat. 60, 147, 316, 460 und 461 in Verbin-
dung mit Todes- und Grabesmotiven.
Dorf: 82, 107, 114, 187, 251, 272, 298, 306, 323, 373, 390.
Es versinnbildlicht, ähnlich wie das Haus, Idyllik und Geborgenheit
und kommt sowohl als diesseitiges (Kat. 187, 302) wie als paradie-
sisches Motiv (Kat. 82, 107, 249, 270, 306, 323, 390) vor. In Kat. 114
sind beide Möglichkeiten in einem Bild vereint.
Dornenkrone: 308.
In Verbindung mit dem Kreuz Symbol für Leiden und Tod Christi.
Die Herkunft dieses Symbols aus der Vegetation verknüpft es mit
der Landschaft.
Draggen: 241,242,329,512.
In der Verbindung von Felsblock und Kreuz, die zusammen einen
primitiven Anker bilden, liegt möglicherweise eine Allegorie der
christlichen Tugenden Glaube, Liebe und Hoffnung vor.
Druiden: 202.
Repräsentanten des Heidentums im Gegensatz zum Christentum.
Efeu: 20, 51, 54, 78, 89, 145, 146, 167, 184, 257, 290, 461.
Sinnbild der Auferstehung, in Kat. 20, 145, 146 und 167 an einem
Kreuz emporrankend.