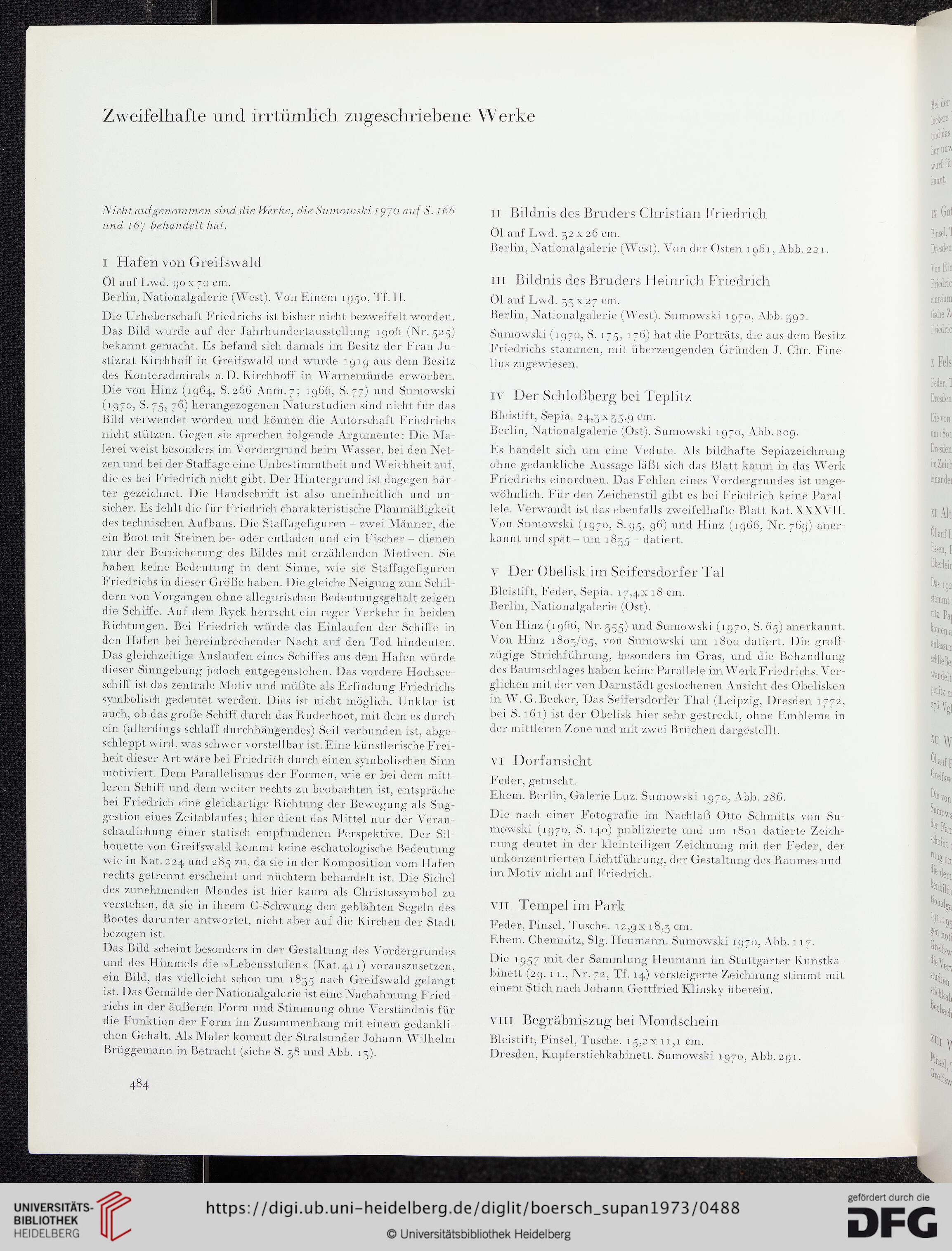Zweifelhafte und irrtümlich zugeschriebene Werke
Nicht auf genommen sind die Werke, die Sumowski I<)]0 auf S. 166
und l6y behandelt hat.
I Hafen von Greifswald
Öl auf Lwd. 90x70 cm.
Berlin, Nationalgalerie (West). Von Einem 1950, Tf. II.
Die Urheberschaft Friedrichs ist bisher nicht bezweifelt worden.
Das Bild wurde auf der Jahrhundertausstellung 1906 (Nr. 525)
bekannt gemacht. Es befand sich damals im Besitz der Frau Ju-
stizrat Kirchhoff in Greifswald und wurde 1919 aus dem Besitz
des Konteradmirals a. D. Kirchhoff in Warnemünde erworben.
Die von Hinz (1964, S. 266 Anm. 7; 1966, S. 77) un(l Sumowski
(1970, S. 75, 76) herangezogenen Naturstudien sind nicht für das
Bild verwendet worden und können die Autorschaft Friedrichs
nicht stützen. Gegen sie sprechen folgende Argumente: Die Ma-
lerei weist besonders im Vordergrund beim Wasser, bei den Net-
zen und bei der Staffage eine Unbestimmtheit und Weichheit auf,
die es bei Friedrich nicht gibt. Der Hintergrund ist dagegen här-
ter gezeichnet. Die Handschrift ist also uneinheitlich und un-
sicher. Es fehlt die für Friedrich charakteristische Planmäßigkeit
des technischen Aufbaus. Die Staffagefiguren - zwei Männer, die
ein Boot mit Steinen be- oder entladen und ein Fischer - dienen
nur der Bereicherung des Bildes mit erzählenden Motiven. Sie
haben keine Bedeutung in dem Sinne, wie sie Staffagefiguren
Friedrichs in dieser Größe haben. Die gleiche Neigung zum Schil-
dern von Vorgängen ohne allegorischen Bedeutungsgehalt zeigen
die Schiffe. Auf dem Eyck herrscht ein reger Verkehr in beiden
Richtungen. Bei Friedrich würde das Einlaufen der Schiffe in
den Hafen bei hereinbrechender Nacht auf den Tod hindeuten.
Das gleichzeitige Auslaufen eines Schiffes aus dem Hafen würde
dieser Sinngebung jedoch entgegenstehen. Das vordere Hochsee-
schiff ist das zentrale Motiv und müßte als Erfindung Friedrichs
symbolisch gedeutet werden. Dies ist nicht möglich. Unklar ist
auch, ob das große Schiff durch das Ruderboot, mit dem es durch
ein (allerdings schlaff durchhängendes) Seil verbunden ist, abge-
schleppt wird, was schwer vorstellbar ist. Eine künstlerische Frei-
heit dieser Art wäre bei Friedrich durch einen symbolischen Sinn
motiviert. Dem Parallelismus der Formen, wie er bei dem mitt-
leren Schiff und dem weiter rechts zu beobachten ist, entspräche
bei Friedrich eine gleichartige Richtung der Bewegung als Sug-
gestion eines Zeitablaufes; hier dient das Mittel nur der Veran-
schaulichung einer statisch empfundenen Perspektive. Der Sil-
houette von Greifswald kommt keine eschatologische Bedeutung
wie in Kat. 224 und 285 zu, da sie in der Komposition vom Hafen
rechts getrennt erscheint und nüchtern behandelt ist. Die Sichel
des zunehmenden Mondes ist hier kaum als Christussymbol zu
verstehen, da sie in ihrem C-Schwung den geblähten Segeln des
Bootes darunter antwortet, nicht aber auf die Kirchen der Stadt
bezogen ist.
Das Bild scheint besonders in der Gestaltung des Vordergrundes
und des Himmels die »Lebensstufen« (Kat. 411) vorauszusetzen,
ein Bild, das vielleicht schon um 1835 nach Greifswald gelangt
ist. Das Gemälde der Nationalgalerie ist eine Nachahmung Fried-
richs in der äußeren Form und Stimmung ohne Verständnis für
die Funktion der Form im Zusammenhang mit einem gedankli-
chen Gehalt. Als Maler kommt der Stralsunder Johann Wilhelm
Brüggemann in Betracht (siehe S. 38 und Abb. 13).
II Bildnis des Bruders Christian Friedrich
Öl auf Lwd. 32x26 cm.
Berlin, Nationalgalerie (West). Von der Osten 1961, Abb. 221.
hi Bildnis des Bruders Heinrich Friedrich
Öl auf Lwd. 33x27 cm.
Berlin, Nationalgalerie (West). Sumowski 1970, Abb. 392.
Sumowski (1970, S. 175, 176) hat die Porträts, die aus dem Besitz
Friedrichs stammen, mit überzeugenden Gründen J. Chr. Fine-
lius zugewiesen.
iv Der Schloßberg bei Teplitz
Bleistift, Sepia. 24,3x35,9 cm.
Berlin, Nationalgalerie (Ost). Sumowski 1970, Abb. 209.
Es handelt sich um eine Vedute. Als bildhafte Sepiazeichnung
ohne gedankliche Aussage läßt sich das Blatt kaum in das Werk
Friedrichs einordnen. Das Fehlen eines Vordergrundes ist unge-
wöhnlich. Für den Zeichenstil gibt es bei Friedrich keine Paral-
lele. Verwandt ist das ebenfalls zweifelhafte Blatt Kat. XXXVII.
Von Sumowski (1970, S. 95, 96) und Hinz (1966, Nr. 769) aner-
kannt und spät - um 1835 - datiert.
v Der Obelisk im Seifersdorfer Tal
Bleistift, Feder, Sepia. i7,4x 18 cm.
Berlin, Nationalgalerie (Ost).
Von Hinz (1966, Nr. 355) und Sumowski (1970, S. 65) anerkannt.
Von Hinz 1803/05, von Sumowski um 1800 datiert. Die groß-
zügige Strichführung, besonders im Gras, und die Behandlung
des Baumschlages haben keine Parallele im Werk Friedrichs. Ver-
glichen mit der von Darnstädt gestochenen Ansicht des Obelisken
in W.G. Becker, Das Seifersdorfer Thal (Leipzig, Dresden 1772,
bei S. 161) ist der Obelisk hier sehr gestreckt, ohne Embleme in
der mittleren Zone und mit zwei Brüchen dargestellt.
vi Dorfansicht
Feder, getuscht.
Ehern. Berlin, Galerie Luz. Sumowski 1970, Abb. 286.
Die nach einer Fotografie im Nachlaß Otto Schmitts von Su-
mowski (1970, S. 140) publizierte und um 1801 datierte Zeich-
nung deutet in der kleinteiligen Zeichnung mit der Feder, der
unkonzentrierten Lichtführung, der Gestaltung des Raumes und
im Motiv nicht auf Friedrich.
VII Tempel im Park
Feder, Pinsel, Tusche. i2,px 18,3 cm.
Ehern. Chemnitz, Slg. Heumann. Sumowski 1970, Abb. 117.
Die 1957 mit der Sammlung Heumann im Stuttgarter Kunstka-
binett (29. 11., Nr. 72, Tf. 14) versteigerte Zeichnung stimmt mit
einem Stich nach Johann Gottfried Klinsky überein.
viii Begräbniszug bei Mondschein
Bleistift, Pinsel, Tusche. i5,2x 11,1 cm.
Dresden, Kupferstichkabinett. Sumowski 1970, Abb. 291.
484
Nicht auf genommen sind die Werke, die Sumowski I<)]0 auf S. 166
und l6y behandelt hat.
I Hafen von Greifswald
Öl auf Lwd. 90x70 cm.
Berlin, Nationalgalerie (West). Von Einem 1950, Tf. II.
Die Urheberschaft Friedrichs ist bisher nicht bezweifelt worden.
Das Bild wurde auf der Jahrhundertausstellung 1906 (Nr. 525)
bekannt gemacht. Es befand sich damals im Besitz der Frau Ju-
stizrat Kirchhoff in Greifswald und wurde 1919 aus dem Besitz
des Konteradmirals a. D. Kirchhoff in Warnemünde erworben.
Die von Hinz (1964, S. 266 Anm. 7; 1966, S. 77) un(l Sumowski
(1970, S. 75, 76) herangezogenen Naturstudien sind nicht für das
Bild verwendet worden und können die Autorschaft Friedrichs
nicht stützen. Gegen sie sprechen folgende Argumente: Die Ma-
lerei weist besonders im Vordergrund beim Wasser, bei den Net-
zen und bei der Staffage eine Unbestimmtheit und Weichheit auf,
die es bei Friedrich nicht gibt. Der Hintergrund ist dagegen här-
ter gezeichnet. Die Handschrift ist also uneinheitlich und un-
sicher. Es fehlt die für Friedrich charakteristische Planmäßigkeit
des technischen Aufbaus. Die Staffagefiguren - zwei Männer, die
ein Boot mit Steinen be- oder entladen und ein Fischer - dienen
nur der Bereicherung des Bildes mit erzählenden Motiven. Sie
haben keine Bedeutung in dem Sinne, wie sie Staffagefiguren
Friedrichs in dieser Größe haben. Die gleiche Neigung zum Schil-
dern von Vorgängen ohne allegorischen Bedeutungsgehalt zeigen
die Schiffe. Auf dem Eyck herrscht ein reger Verkehr in beiden
Richtungen. Bei Friedrich würde das Einlaufen der Schiffe in
den Hafen bei hereinbrechender Nacht auf den Tod hindeuten.
Das gleichzeitige Auslaufen eines Schiffes aus dem Hafen würde
dieser Sinngebung jedoch entgegenstehen. Das vordere Hochsee-
schiff ist das zentrale Motiv und müßte als Erfindung Friedrichs
symbolisch gedeutet werden. Dies ist nicht möglich. Unklar ist
auch, ob das große Schiff durch das Ruderboot, mit dem es durch
ein (allerdings schlaff durchhängendes) Seil verbunden ist, abge-
schleppt wird, was schwer vorstellbar ist. Eine künstlerische Frei-
heit dieser Art wäre bei Friedrich durch einen symbolischen Sinn
motiviert. Dem Parallelismus der Formen, wie er bei dem mitt-
leren Schiff und dem weiter rechts zu beobachten ist, entspräche
bei Friedrich eine gleichartige Richtung der Bewegung als Sug-
gestion eines Zeitablaufes; hier dient das Mittel nur der Veran-
schaulichung einer statisch empfundenen Perspektive. Der Sil-
houette von Greifswald kommt keine eschatologische Bedeutung
wie in Kat. 224 und 285 zu, da sie in der Komposition vom Hafen
rechts getrennt erscheint und nüchtern behandelt ist. Die Sichel
des zunehmenden Mondes ist hier kaum als Christussymbol zu
verstehen, da sie in ihrem C-Schwung den geblähten Segeln des
Bootes darunter antwortet, nicht aber auf die Kirchen der Stadt
bezogen ist.
Das Bild scheint besonders in der Gestaltung des Vordergrundes
und des Himmels die »Lebensstufen« (Kat. 411) vorauszusetzen,
ein Bild, das vielleicht schon um 1835 nach Greifswald gelangt
ist. Das Gemälde der Nationalgalerie ist eine Nachahmung Fried-
richs in der äußeren Form und Stimmung ohne Verständnis für
die Funktion der Form im Zusammenhang mit einem gedankli-
chen Gehalt. Als Maler kommt der Stralsunder Johann Wilhelm
Brüggemann in Betracht (siehe S. 38 und Abb. 13).
II Bildnis des Bruders Christian Friedrich
Öl auf Lwd. 32x26 cm.
Berlin, Nationalgalerie (West). Von der Osten 1961, Abb. 221.
hi Bildnis des Bruders Heinrich Friedrich
Öl auf Lwd. 33x27 cm.
Berlin, Nationalgalerie (West). Sumowski 1970, Abb. 392.
Sumowski (1970, S. 175, 176) hat die Porträts, die aus dem Besitz
Friedrichs stammen, mit überzeugenden Gründen J. Chr. Fine-
lius zugewiesen.
iv Der Schloßberg bei Teplitz
Bleistift, Sepia. 24,3x35,9 cm.
Berlin, Nationalgalerie (Ost). Sumowski 1970, Abb. 209.
Es handelt sich um eine Vedute. Als bildhafte Sepiazeichnung
ohne gedankliche Aussage läßt sich das Blatt kaum in das Werk
Friedrichs einordnen. Das Fehlen eines Vordergrundes ist unge-
wöhnlich. Für den Zeichenstil gibt es bei Friedrich keine Paral-
lele. Verwandt ist das ebenfalls zweifelhafte Blatt Kat. XXXVII.
Von Sumowski (1970, S. 95, 96) und Hinz (1966, Nr. 769) aner-
kannt und spät - um 1835 - datiert.
v Der Obelisk im Seifersdorfer Tal
Bleistift, Feder, Sepia. i7,4x 18 cm.
Berlin, Nationalgalerie (Ost).
Von Hinz (1966, Nr. 355) und Sumowski (1970, S. 65) anerkannt.
Von Hinz 1803/05, von Sumowski um 1800 datiert. Die groß-
zügige Strichführung, besonders im Gras, und die Behandlung
des Baumschlages haben keine Parallele im Werk Friedrichs. Ver-
glichen mit der von Darnstädt gestochenen Ansicht des Obelisken
in W.G. Becker, Das Seifersdorfer Thal (Leipzig, Dresden 1772,
bei S. 161) ist der Obelisk hier sehr gestreckt, ohne Embleme in
der mittleren Zone und mit zwei Brüchen dargestellt.
vi Dorfansicht
Feder, getuscht.
Ehern. Berlin, Galerie Luz. Sumowski 1970, Abb. 286.
Die nach einer Fotografie im Nachlaß Otto Schmitts von Su-
mowski (1970, S. 140) publizierte und um 1801 datierte Zeich-
nung deutet in der kleinteiligen Zeichnung mit der Feder, der
unkonzentrierten Lichtführung, der Gestaltung des Raumes und
im Motiv nicht auf Friedrich.
VII Tempel im Park
Feder, Pinsel, Tusche. i2,px 18,3 cm.
Ehern. Chemnitz, Slg. Heumann. Sumowski 1970, Abb. 117.
Die 1957 mit der Sammlung Heumann im Stuttgarter Kunstka-
binett (29. 11., Nr. 72, Tf. 14) versteigerte Zeichnung stimmt mit
einem Stich nach Johann Gottfried Klinsky überein.
viii Begräbniszug bei Mondschein
Bleistift, Pinsel, Tusche. i5,2x 11,1 cm.
Dresden, Kupferstichkabinett. Sumowski 1970, Abb. 291.
484