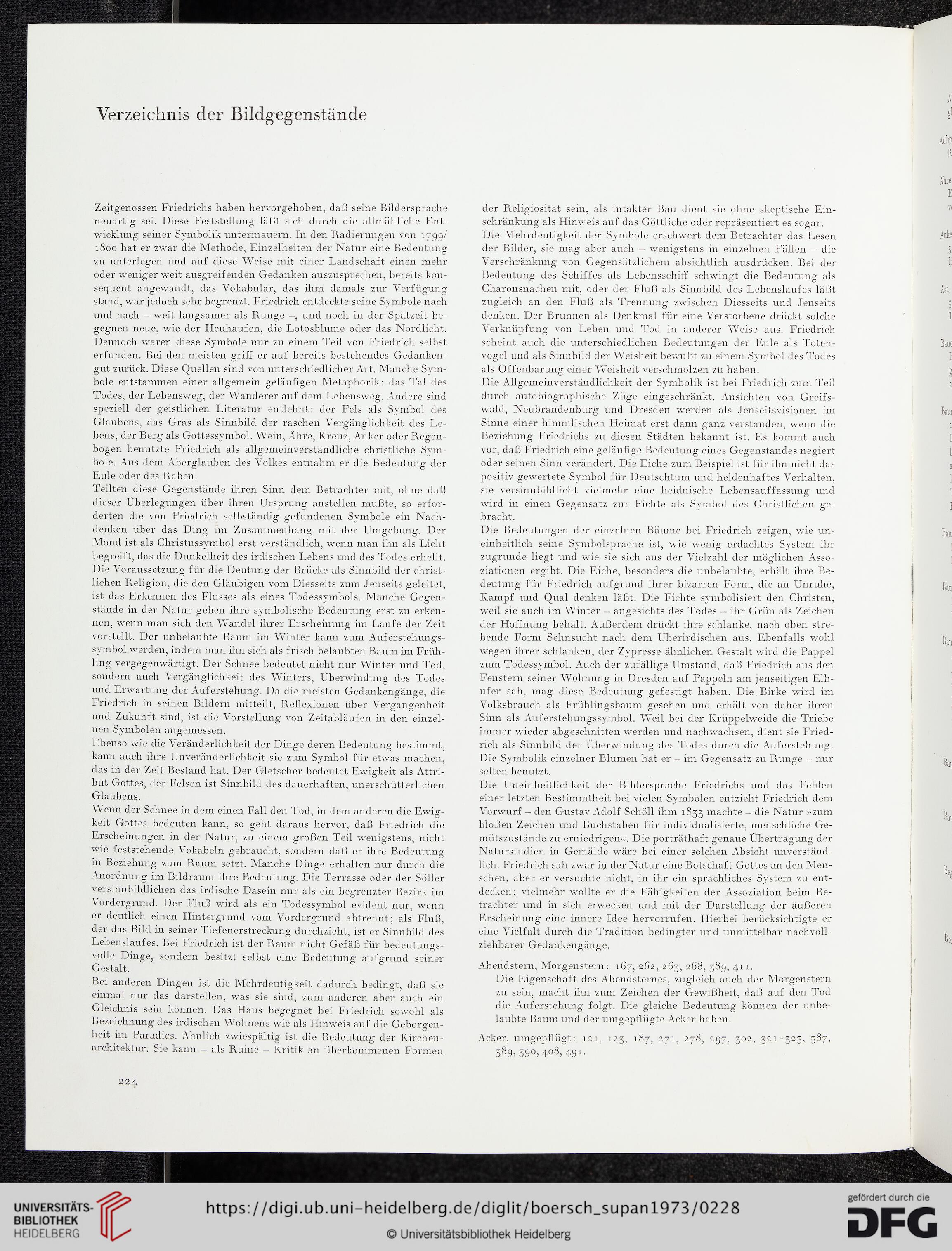Verzeichnis der Bildgegenstände
Zeitgenossen Friedrichs haben hervorgehoben, daß seine Bildersprache
neuartig sei. Diese Feststellung läßt sich durch die allmähliche Ent-
wicklung seiner Symbolik untermauern. In den Radierungen von 1799/
1800 hat er zwar die Methode, Einzelheiten der Natur eine Bedeutung
zu unterlegen und auf diese Weise mit einer Landschaft einen mehr
oder weniger weit ausgreifenden Gedanken auszusprechen, bereits kon-
sequent angewandt, das Vokabular, das ihm damals zur Verfügung
stand, war jedoch sehr begrenzt. Friedrich entdeckte seine Symbole nach
und nach — weit langsamer als Runge —, und noch in der Spätzeit be-
gegnen neue, wie der Heuhaufen, die Lotosblume oder das Nordlicht.
Dennoch waren diese Symbole nur zu einem Teil von Friedrich selbst
erfunden. Bei den meisten griff er auf bereits bestehendes Gedanken-
gut zurück. Diese Quellen sind von unterschiedlicher Art. Manche Sym-
bole entstammen einer allgemein geläufigen Metaphorik: das Tal des
Todes, der Lebensweg, der Wanderer auf dem Lebensweg. Andere sind
speziell der geistlichen Literatur entlehnt: der Fels als Symbol des
Glaubens, das Gras als Sinnbild der raschen Vergänglichkeit des Le-
bens, der Berg als Gottessymbol. Wein, Ähre, Kreuz, Anker oder Regen-
bogen benutzte Friedrich als allgemeinverständliche christliche Sym-
bole. Aus dem Aberglauben des Volkes entnahm er die Bedeutung der
Eule oder des Raben.
Teilten diese Gegenstände ihren Sinn dem Betrachter mit, ohne daß
dieser Überlegungen über ihren Ursprung anstellen mußte, so erfor-
derten die von Friedrich selbständig gefundenen Symbole ein Nach-
denken über das Ding im Zusammenhang mit der Umgebung. Der
Mond ist als Christussymbol erst verständlich, wenn man ihn als Licht
begreift, das die Dunkelheit des irdischen Lebens und des Todes erhellt.
Die Voraussetzung für die Deutung der Brücke als Sinnbild der christ-
lichen Religion, die den Gläubigen vom Diesseits zum Jenseits geleitet,
ist das Erkennen des Flusses als eines Todessymbols. Manche Gegen-
stände in der Natur geben ihre symbolische Bedeutung erst zu erken-
nen, wenn man sich den Wandel ihrer Erscheinung im Laufe der Zeit
vorstellt. Der unbelaubte Baum im Winter kann zum Auferstehungs-
symbol werden, indem man ihn sich als frisch belaubten Baum im Früh-
ling vergegenwärtigt. Der Schnee bedeutet nicht nur Winter und Tod,
sondern auch Vergänglichkeit des Winters, Überwindung des Todes
und Erwartung der Auferstehung. Da die meisten Gedankengänge, die
Friedrich in seinen Bildern mitteilt, Reflexionen über Vergangenheit
und Zukunft sind, ist die Vorstellung von Zeitabläufen in den einzel-
nen Symbolen angemessen.
Ebenso wie die Veränderlichkeit der Dinge deren Bedeutung bestimmt,
kann auch ihre Unveränderlichkeit sie zum Symbol für etwas machen,
das in der Zeit Bestand hat. Der Gletscher bedeutet Ewigkeit als Attri-
but Gottes, der Felsen ist Sinnbild des dauerhaften, unerschütterlichen
Glaubens.
Wenn der Schnee in dem einen Fall den Tod, in dem anderen die Ewig-
keit Gottes bedeuten kann, so geht daraus hervor, daß Friedrich die
Erscheinungen in der Natur, zu einem großen Teil wenigstens, nicht
wie feststehende Vokabeln gebraucht, sondern daß er ihre Bedeutung
in Beziehung zum Raum setzt. Manche Dinge erhalten nur durch die
Anordnung im Bildraum ihre Bedeutung. Die Terrasse oder der Söller
versinnbildlichen das irdische Dasein nur als ein begrenzter Bezirk im
Vordergrund. Der Fluß wird als ein Todessymbol evident nur, wenn
er deutlich einen Hintergrund vom Vordergrund abtrennt; als Fluß,
der das Bild in seiner Tiefenerstreckung durchzieht, ist er Sinnbild des
Lebenslaufes. Bei Friedrich ist der Raum nicht Gefäß für bedeutungs-
volle Dinge, sondern besitzt selbst eine Bedeutung aufgrund seiner
Gestalt.
Bei anderen Dingen ist die Mehrdeutigkeit dadurch bedingt, daß sie
einmal nur das darstellen, was sie sind, zum anderen aber auch ein
Gleichnis sein können. Das Haus begegnet bei Friedrich sowohl als
Bezeichnung des irdischen Wohnens wie als Hinweis auf die Geborgen-
heit im Paradies. Ähnlich zwiespältig ist die Bedeutung der Kirchen-
architektur. Sie kann — als Ruine — Kritik an überkommenen Formen
der Religiosität sein, als intakter Bau dient sie ohne skeptische Ein-
schränkung als Hinweis auf das Göttliche oder repräsentiert es sogar.
Die Mehrdeutigkeit der Symbole erschwert dem Betrachter das Lesen
der Bilder, sie mag aber auch — wenigstens in einzelnen Fällen — die
Verschränkung von Gegensätzlichem absichtlich ausdrücken. Bei der
Bedeutung des Schiffes als Lebensschiff schwingt die Bedeutung als
Charonsnachen mit, oder der Fluß als Sinnbild des Lebenslaufes läßt
zugleich an den Fluß als Trennung zwischen Diesseits und Jenseits
denken. Der Brunnen als Denkmal für eine Verstorbene drückt solche
Verknüpfung von Leben und Tod in anderer Weise aus. Friedrich
scheint auch die unterschiedlichen Bedeutungen der Eule als Toten-
vogel und als Sinnbild der Weisheit bewußt zu einem Symbol des Todes
als Offenbarung einer Weisheit verschmolzen zü haben.
Die Allgemeinverständlichkeit der Symbolik ist bei Friedrich zum Teil
durch autobiographische Züge eingeschränkt. Ansichten von Greifs-
wald, Neubrandenburg und Dresden werden als Jenseitsvisionen im
Sinne einer himmlischen Heimat erst dann ganz verstanden, wenn die
Beziehung Friedrichs zu diesen Städten bekannt ist. Es kommt auch
vor, daß Friedrich eine geläufige Bedeutung eines Gegenstandes negiert
oder seinen Sinn verändert. Die Eiche zum Beispiel ist für ihn nicht das
positiv gewertete Symbol für Deutschtum und heldenhaftes Verhalten,
sie versinnbildlicht vielmehr eine heidnische Lebensauffassung und
wird in einen Gegensatz zur Fichte als Symbol des Christlichen ge-
bracht.
Die Bedeutungen der einzelnen Bäume bei Friedrich zeigen, wie un-
einheitlich seine Symbolsprache ist, wie wenig erdachtes System ihr
zugrunde liegt und wie sie sich aus der Vielzahl der möglichen Asso-
ziationen ergibt. Die Eiche, besonders die unbelaubte, erhält ihre Be-
deutung für Friedrich aufgrund ihrer bizarren Form, die an Unruhe,
Kampf und Qual denken läßt. Die Fichte symbolisiert den Christen,
weil sie auch im Winter - angesichts des Todes — ihr Grün als Zeichen
der Hoffnung behält. Außerdem drückt ihre schlanke, nach oben stre-
bende Form Sehnsucht nach dem Überirdischen aus. Ebenfalls wohl
wegen ihrer schlanken, der Zypresse ähnlichen Gestalt wird die Pappel
zum Todessymbol. Auch der zufällige Umstand, daß Friedrich aus den
Fenstern seiner Wohnung in Dresden auf Pappeln am jenseitigen Elb-
ufer sah, mag diese Bedeutung gefestigt haben. Die Birke wird im
Volksbrauch als Frühlingsbaum gesehen und erhält von daher ihren
Sinn als Auferstehungssymbol. Weil bei der Krüppelweide die Triebe
immer wieder abgeschnitten werden und nachwachsen, dient sie Fried-
rich als Sinnbild der Überwindung des Todes durch die Auferstehung.
Die Symbolik einzelner Blumen hat er - im Gegensatz zu Runge - nur
selten benutzt.
Die Uneinheitlichkeit der Bildersprache Friedrichs und das Fehlen
einer letzten Bestimmtheit bei vielen Symbolen entzieht Friedrich dem
Vorwurf - den Gustav Adolf Schöll ihm 1833 machte - die Natur »zum
bloßen Zeichen und Buchstaben für individualisierte, menschliche Ge-
mütszustände zu erniedrigen«. Die porträthaft genaue Übertragung der
Naturstudien in Gemälde wäre bei einer solchen Absicht unverständ-
lich. Friedrich sah zwar i^i der Natur eine Botschaft Gottes an den Men-
schen, aber er versuchte nicht, in ihr ein sprachliches System zu ent-
decken; vielmehr wollte er die Fähigkeiten der Assoziation beim Be-
trachter und in sich erwecken und mit der Darstellung der äußeren
Erscheinung eine innere Idee hervorrufen. Hierbei berücksichtigte er
eine Vielfalt durch die Tradition bedingter und unmittelbar nachvoll-
ziehbarer Gedankengänge.
Abendstern, Morgenstern: 167, 262, 263, 268, 389, 411.
Die Eigenschaft des Abendsternes, zugleich auch der Morgenstern
zu sein, macht ihn zum Zeichen der Gewißheit, daß auf den Tod
die Auferstehung folgt. Die gleiche Bedeutung können der unbe-
laubte Baum und der umgepflügte Acker haben.
Acker, umgepflügt: 121, 123, 187, 271, 278, 297, 302, 321-323, 387,
389,39°, 4°8,491-
224
Zeitgenossen Friedrichs haben hervorgehoben, daß seine Bildersprache
neuartig sei. Diese Feststellung läßt sich durch die allmähliche Ent-
wicklung seiner Symbolik untermauern. In den Radierungen von 1799/
1800 hat er zwar die Methode, Einzelheiten der Natur eine Bedeutung
zu unterlegen und auf diese Weise mit einer Landschaft einen mehr
oder weniger weit ausgreifenden Gedanken auszusprechen, bereits kon-
sequent angewandt, das Vokabular, das ihm damals zur Verfügung
stand, war jedoch sehr begrenzt. Friedrich entdeckte seine Symbole nach
und nach — weit langsamer als Runge —, und noch in der Spätzeit be-
gegnen neue, wie der Heuhaufen, die Lotosblume oder das Nordlicht.
Dennoch waren diese Symbole nur zu einem Teil von Friedrich selbst
erfunden. Bei den meisten griff er auf bereits bestehendes Gedanken-
gut zurück. Diese Quellen sind von unterschiedlicher Art. Manche Sym-
bole entstammen einer allgemein geläufigen Metaphorik: das Tal des
Todes, der Lebensweg, der Wanderer auf dem Lebensweg. Andere sind
speziell der geistlichen Literatur entlehnt: der Fels als Symbol des
Glaubens, das Gras als Sinnbild der raschen Vergänglichkeit des Le-
bens, der Berg als Gottessymbol. Wein, Ähre, Kreuz, Anker oder Regen-
bogen benutzte Friedrich als allgemeinverständliche christliche Sym-
bole. Aus dem Aberglauben des Volkes entnahm er die Bedeutung der
Eule oder des Raben.
Teilten diese Gegenstände ihren Sinn dem Betrachter mit, ohne daß
dieser Überlegungen über ihren Ursprung anstellen mußte, so erfor-
derten die von Friedrich selbständig gefundenen Symbole ein Nach-
denken über das Ding im Zusammenhang mit der Umgebung. Der
Mond ist als Christussymbol erst verständlich, wenn man ihn als Licht
begreift, das die Dunkelheit des irdischen Lebens und des Todes erhellt.
Die Voraussetzung für die Deutung der Brücke als Sinnbild der christ-
lichen Religion, die den Gläubigen vom Diesseits zum Jenseits geleitet,
ist das Erkennen des Flusses als eines Todessymbols. Manche Gegen-
stände in der Natur geben ihre symbolische Bedeutung erst zu erken-
nen, wenn man sich den Wandel ihrer Erscheinung im Laufe der Zeit
vorstellt. Der unbelaubte Baum im Winter kann zum Auferstehungs-
symbol werden, indem man ihn sich als frisch belaubten Baum im Früh-
ling vergegenwärtigt. Der Schnee bedeutet nicht nur Winter und Tod,
sondern auch Vergänglichkeit des Winters, Überwindung des Todes
und Erwartung der Auferstehung. Da die meisten Gedankengänge, die
Friedrich in seinen Bildern mitteilt, Reflexionen über Vergangenheit
und Zukunft sind, ist die Vorstellung von Zeitabläufen in den einzel-
nen Symbolen angemessen.
Ebenso wie die Veränderlichkeit der Dinge deren Bedeutung bestimmt,
kann auch ihre Unveränderlichkeit sie zum Symbol für etwas machen,
das in der Zeit Bestand hat. Der Gletscher bedeutet Ewigkeit als Attri-
but Gottes, der Felsen ist Sinnbild des dauerhaften, unerschütterlichen
Glaubens.
Wenn der Schnee in dem einen Fall den Tod, in dem anderen die Ewig-
keit Gottes bedeuten kann, so geht daraus hervor, daß Friedrich die
Erscheinungen in der Natur, zu einem großen Teil wenigstens, nicht
wie feststehende Vokabeln gebraucht, sondern daß er ihre Bedeutung
in Beziehung zum Raum setzt. Manche Dinge erhalten nur durch die
Anordnung im Bildraum ihre Bedeutung. Die Terrasse oder der Söller
versinnbildlichen das irdische Dasein nur als ein begrenzter Bezirk im
Vordergrund. Der Fluß wird als ein Todessymbol evident nur, wenn
er deutlich einen Hintergrund vom Vordergrund abtrennt; als Fluß,
der das Bild in seiner Tiefenerstreckung durchzieht, ist er Sinnbild des
Lebenslaufes. Bei Friedrich ist der Raum nicht Gefäß für bedeutungs-
volle Dinge, sondern besitzt selbst eine Bedeutung aufgrund seiner
Gestalt.
Bei anderen Dingen ist die Mehrdeutigkeit dadurch bedingt, daß sie
einmal nur das darstellen, was sie sind, zum anderen aber auch ein
Gleichnis sein können. Das Haus begegnet bei Friedrich sowohl als
Bezeichnung des irdischen Wohnens wie als Hinweis auf die Geborgen-
heit im Paradies. Ähnlich zwiespältig ist die Bedeutung der Kirchen-
architektur. Sie kann — als Ruine — Kritik an überkommenen Formen
der Religiosität sein, als intakter Bau dient sie ohne skeptische Ein-
schränkung als Hinweis auf das Göttliche oder repräsentiert es sogar.
Die Mehrdeutigkeit der Symbole erschwert dem Betrachter das Lesen
der Bilder, sie mag aber auch — wenigstens in einzelnen Fällen — die
Verschränkung von Gegensätzlichem absichtlich ausdrücken. Bei der
Bedeutung des Schiffes als Lebensschiff schwingt die Bedeutung als
Charonsnachen mit, oder der Fluß als Sinnbild des Lebenslaufes läßt
zugleich an den Fluß als Trennung zwischen Diesseits und Jenseits
denken. Der Brunnen als Denkmal für eine Verstorbene drückt solche
Verknüpfung von Leben und Tod in anderer Weise aus. Friedrich
scheint auch die unterschiedlichen Bedeutungen der Eule als Toten-
vogel und als Sinnbild der Weisheit bewußt zu einem Symbol des Todes
als Offenbarung einer Weisheit verschmolzen zü haben.
Die Allgemeinverständlichkeit der Symbolik ist bei Friedrich zum Teil
durch autobiographische Züge eingeschränkt. Ansichten von Greifs-
wald, Neubrandenburg und Dresden werden als Jenseitsvisionen im
Sinne einer himmlischen Heimat erst dann ganz verstanden, wenn die
Beziehung Friedrichs zu diesen Städten bekannt ist. Es kommt auch
vor, daß Friedrich eine geläufige Bedeutung eines Gegenstandes negiert
oder seinen Sinn verändert. Die Eiche zum Beispiel ist für ihn nicht das
positiv gewertete Symbol für Deutschtum und heldenhaftes Verhalten,
sie versinnbildlicht vielmehr eine heidnische Lebensauffassung und
wird in einen Gegensatz zur Fichte als Symbol des Christlichen ge-
bracht.
Die Bedeutungen der einzelnen Bäume bei Friedrich zeigen, wie un-
einheitlich seine Symbolsprache ist, wie wenig erdachtes System ihr
zugrunde liegt und wie sie sich aus der Vielzahl der möglichen Asso-
ziationen ergibt. Die Eiche, besonders die unbelaubte, erhält ihre Be-
deutung für Friedrich aufgrund ihrer bizarren Form, die an Unruhe,
Kampf und Qual denken läßt. Die Fichte symbolisiert den Christen,
weil sie auch im Winter - angesichts des Todes — ihr Grün als Zeichen
der Hoffnung behält. Außerdem drückt ihre schlanke, nach oben stre-
bende Form Sehnsucht nach dem Überirdischen aus. Ebenfalls wohl
wegen ihrer schlanken, der Zypresse ähnlichen Gestalt wird die Pappel
zum Todessymbol. Auch der zufällige Umstand, daß Friedrich aus den
Fenstern seiner Wohnung in Dresden auf Pappeln am jenseitigen Elb-
ufer sah, mag diese Bedeutung gefestigt haben. Die Birke wird im
Volksbrauch als Frühlingsbaum gesehen und erhält von daher ihren
Sinn als Auferstehungssymbol. Weil bei der Krüppelweide die Triebe
immer wieder abgeschnitten werden und nachwachsen, dient sie Fried-
rich als Sinnbild der Überwindung des Todes durch die Auferstehung.
Die Symbolik einzelner Blumen hat er - im Gegensatz zu Runge - nur
selten benutzt.
Die Uneinheitlichkeit der Bildersprache Friedrichs und das Fehlen
einer letzten Bestimmtheit bei vielen Symbolen entzieht Friedrich dem
Vorwurf - den Gustav Adolf Schöll ihm 1833 machte - die Natur »zum
bloßen Zeichen und Buchstaben für individualisierte, menschliche Ge-
mütszustände zu erniedrigen«. Die porträthaft genaue Übertragung der
Naturstudien in Gemälde wäre bei einer solchen Absicht unverständ-
lich. Friedrich sah zwar i^i der Natur eine Botschaft Gottes an den Men-
schen, aber er versuchte nicht, in ihr ein sprachliches System zu ent-
decken; vielmehr wollte er die Fähigkeiten der Assoziation beim Be-
trachter und in sich erwecken und mit der Darstellung der äußeren
Erscheinung eine innere Idee hervorrufen. Hierbei berücksichtigte er
eine Vielfalt durch die Tradition bedingter und unmittelbar nachvoll-
ziehbarer Gedankengänge.
Abendstern, Morgenstern: 167, 262, 263, 268, 389, 411.
Die Eigenschaft des Abendsternes, zugleich auch der Morgenstern
zu sein, macht ihn zum Zeichen der Gewißheit, daß auf den Tod
die Auferstehung folgt. Die gleiche Bedeutung können der unbe-
laubte Baum und der umgepflügte Acker haben.
Acker, umgepflügt: 121, 123, 187, 271, 278, 297, 302, 321-323, 387,
389,39°, 4°8,491-
224