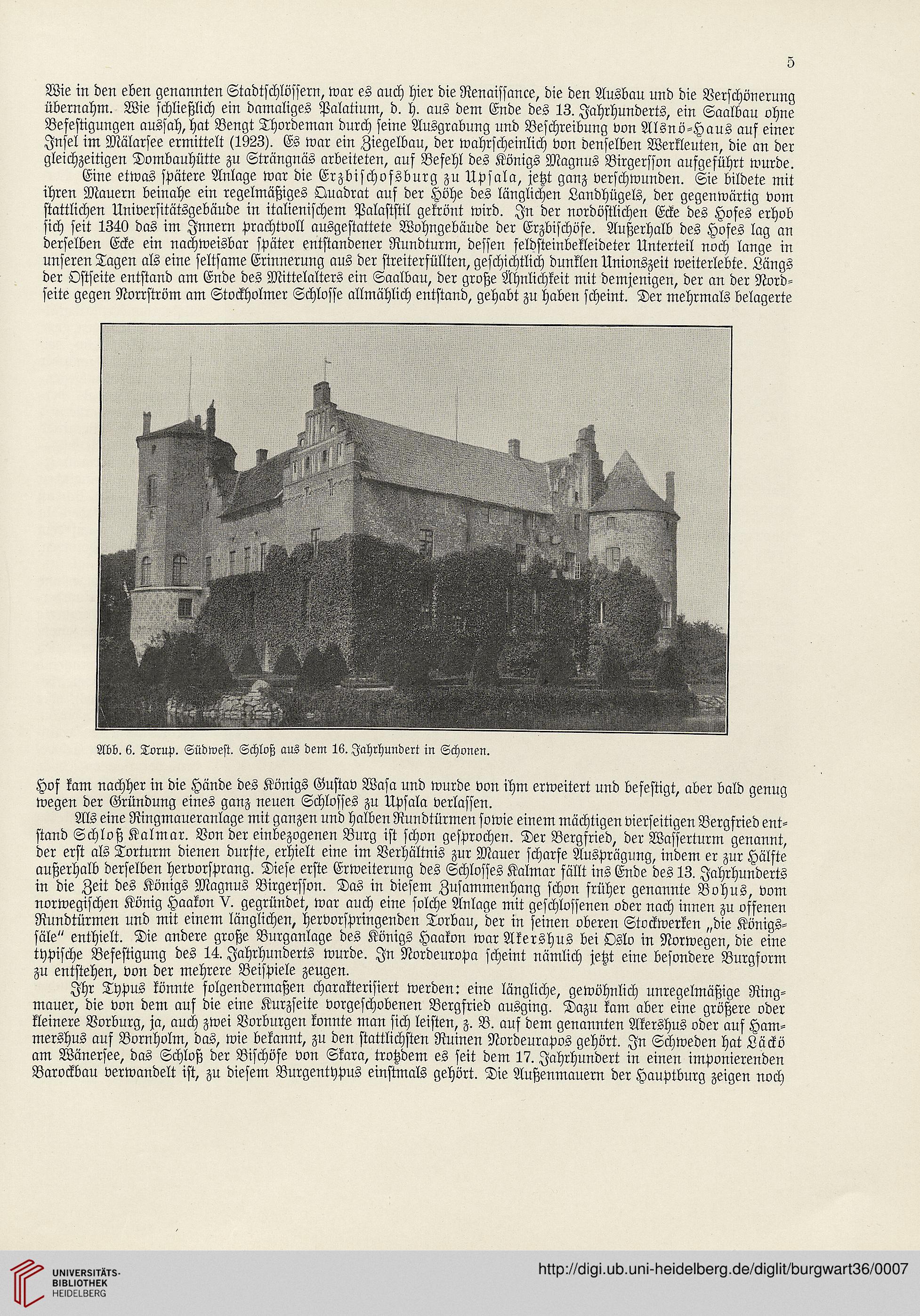Wie in den eben genannten Stadtschlössern, war es auch hier die Renaissance, die den Ausbau und die Verschönerung
übernahm. Wie schließlich ein damaliges Palatium, d. h. aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, ein Saalbau ohne
Befesügungen aussah,hat Beugt Thordeman durch seine Ausgrabung und Beschreibung von Alsnö-Haus auf einer
Insel im Mälarsee ermittelt (1923). Es war ein Ziegelbau, der wahrscheinlich von denselben Werkleuten, die an der
gleichzeitigen Dombauhütte zu Strängnäs arbeiteten, auf Befehl des Königs Magnus Birgersson aufgesührt wurde.
Eine etwas spätere Anlage war die Erzbischofsburg zu Upsala, jetzt ganz verschwunden. Sie bildete mit
ihren Mauern beinahe ein regelmäßiges Quadrat auf der Höhe des länglichen Landhügels, der gegenwärtig vom
stattlichen Universitätsgebäude in italienischem Palaststil gekrönt wird. In der nordöstlichen Ecke des Hofes erhob
sich seit 1340 das im Innern prachtvoll ausgestattete Wohngebäude der Erzbischöfe. Außerhalb des Hofes lag an
derselben Ecke ein nachweisbar später entstandener Rundturm, dessen feldsteinbekleideter Unterteil noch lange in
unseren Tagen als eine seltsame Erinnerung aus der streiterfüllten, geschichtlich dunklen Unionszeit weiterlebte. Längs
der Ostseite entstand am Ende des Mittelalters ein Saalbau, der große Ähnlichkeit mit demjenigen, der an der Nord-
seite gegen Norrström am Stockholmer Schlosse allmählich entstand, gehabt zu haben scheint. Der mehrmals belagerte
Abb. 6. Torup. Südwest. Schloß aus dem 16. Jahrhundert m Schonen.
Hof kam nachher in die Hände des Königs Gustav Wasa und wurde von ihm erweitert und befestigt, aber bald genug
wegen der Gründung eines ganz neuen Schlosses zu Upsala verlassen.
Als eine Ringmaueranlage mit ganzen und halben Rundtürmen sowie einem mächtigen vierseitigen Bergfried ent-
stand Schloß Kalmar. Von der einbezogenen Burg ist schon gesprochen. Der Bergfried, der Wasserturm genannt,
der erst als Torturm dienen durste, erhielt eine im Verhältnis zur Mauer scharfe Ausprägung, indem er zur Hälfte
außerhalb derselben hervorsprang. Diese erste Erweiterung des Schlosses Kalmar fällt ins Ende des 13. Jahrhunderts
in die Zeit des Königs Magnus Birgersson. Das in diesem Zusammenhang schon früher genannte Bohus, vom
norwegischen König Haakon V. gegründet, war auch eine solche Anlage mit geschlossenen oder nach innen zu offenen
Rundtürmen und mit einem länglichen, hervorspringenden Torbau, der in seinen oberen Stockwerken „die Königs-
säle" enthielt. Die andere große Burganlage des Königs Haakon war Akershus bei Oslo in Norwegen, die eine
typische Befestigung des 14. Jahrhunderts wurde. In Nordeuropa scheint nämlich jetzt eine besondere Burgform
zu entstehen, von der mehrere Beispiele zeugen.
Ihr Typus könnte folgendermaßen charakterisiert werden: eine längliche, gewöhnlich unregelmäßige Ring-
mauer, die von dem auf die eine Kurzseite vorgeschobenen Bergfried ausging. Dazu kam aber eine größere oder
kleinere Vorburg, ja, auch zwei Vorburgen konnte man sich leisten, z. B. auf dem genannten Akershus oder auf Ham-
mershus auf Bornholm, das, wie bekannt, zu den stattlichsten Ruinen Nordeurapos gehört. In Schweden hat Läckö
am Wänersee, das Schloß der Bischöfe von Skara, trotzdem es seit dem 17. Jahrhundert in einen imponierenden
Barockbau verwandelt ist, zu diesem Burgentypus einstmals gehört. Die Außenmanern der Hauptburg zeigen noch
übernahm. Wie schließlich ein damaliges Palatium, d. h. aus dem Ende des 13. Jahrhunderts, ein Saalbau ohne
Befesügungen aussah,hat Beugt Thordeman durch seine Ausgrabung und Beschreibung von Alsnö-Haus auf einer
Insel im Mälarsee ermittelt (1923). Es war ein Ziegelbau, der wahrscheinlich von denselben Werkleuten, die an der
gleichzeitigen Dombauhütte zu Strängnäs arbeiteten, auf Befehl des Königs Magnus Birgersson aufgesührt wurde.
Eine etwas spätere Anlage war die Erzbischofsburg zu Upsala, jetzt ganz verschwunden. Sie bildete mit
ihren Mauern beinahe ein regelmäßiges Quadrat auf der Höhe des länglichen Landhügels, der gegenwärtig vom
stattlichen Universitätsgebäude in italienischem Palaststil gekrönt wird. In der nordöstlichen Ecke des Hofes erhob
sich seit 1340 das im Innern prachtvoll ausgestattete Wohngebäude der Erzbischöfe. Außerhalb des Hofes lag an
derselben Ecke ein nachweisbar später entstandener Rundturm, dessen feldsteinbekleideter Unterteil noch lange in
unseren Tagen als eine seltsame Erinnerung aus der streiterfüllten, geschichtlich dunklen Unionszeit weiterlebte. Längs
der Ostseite entstand am Ende des Mittelalters ein Saalbau, der große Ähnlichkeit mit demjenigen, der an der Nord-
seite gegen Norrström am Stockholmer Schlosse allmählich entstand, gehabt zu haben scheint. Der mehrmals belagerte
Abb. 6. Torup. Südwest. Schloß aus dem 16. Jahrhundert m Schonen.
Hof kam nachher in die Hände des Königs Gustav Wasa und wurde von ihm erweitert und befestigt, aber bald genug
wegen der Gründung eines ganz neuen Schlosses zu Upsala verlassen.
Als eine Ringmaueranlage mit ganzen und halben Rundtürmen sowie einem mächtigen vierseitigen Bergfried ent-
stand Schloß Kalmar. Von der einbezogenen Burg ist schon gesprochen. Der Bergfried, der Wasserturm genannt,
der erst als Torturm dienen durste, erhielt eine im Verhältnis zur Mauer scharfe Ausprägung, indem er zur Hälfte
außerhalb derselben hervorsprang. Diese erste Erweiterung des Schlosses Kalmar fällt ins Ende des 13. Jahrhunderts
in die Zeit des Königs Magnus Birgersson. Das in diesem Zusammenhang schon früher genannte Bohus, vom
norwegischen König Haakon V. gegründet, war auch eine solche Anlage mit geschlossenen oder nach innen zu offenen
Rundtürmen und mit einem länglichen, hervorspringenden Torbau, der in seinen oberen Stockwerken „die Königs-
säle" enthielt. Die andere große Burganlage des Königs Haakon war Akershus bei Oslo in Norwegen, die eine
typische Befestigung des 14. Jahrhunderts wurde. In Nordeuropa scheint nämlich jetzt eine besondere Burgform
zu entstehen, von der mehrere Beispiele zeugen.
Ihr Typus könnte folgendermaßen charakterisiert werden: eine längliche, gewöhnlich unregelmäßige Ring-
mauer, die von dem auf die eine Kurzseite vorgeschobenen Bergfried ausging. Dazu kam aber eine größere oder
kleinere Vorburg, ja, auch zwei Vorburgen konnte man sich leisten, z. B. auf dem genannten Akershus oder auf Ham-
mershus auf Bornholm, das, wie bekannt, zu den stattlichsten Ruinen Nordeurapos gehört. In Schweden hat Läckö
am Wänersee, das Schloß der Bischöfe von Skara, trotzdem es seit dem 17. Jahrhundert in einen imponierenden
Barockbau verwandelt ist, zu diesem Burgentypus einstmals gehört. Die Außenmanern der Hauptburg zeigen noch