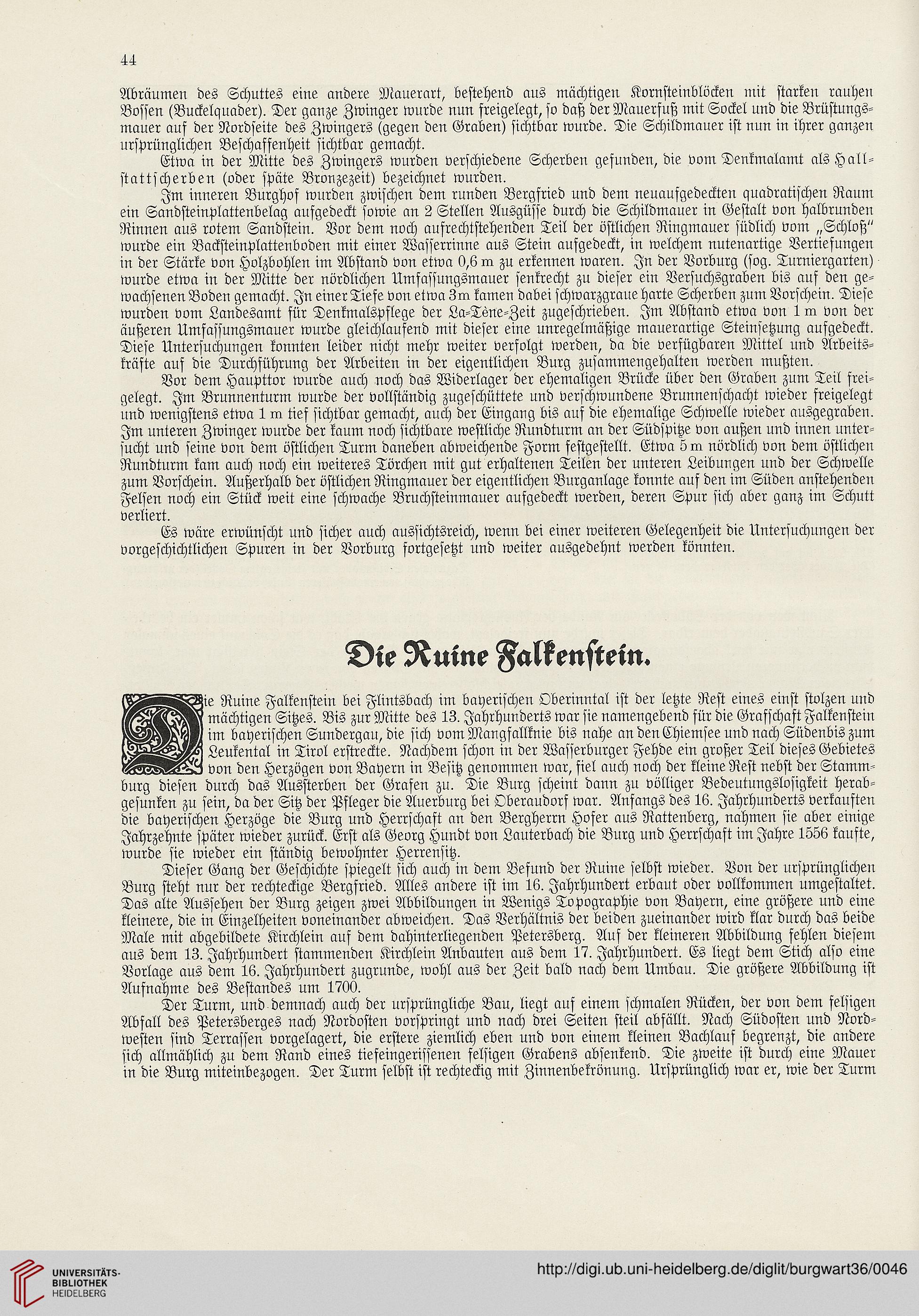44
Abräumen des Schuttes eine andere Mauerart, bestehend aus mächtigen Kornsteinblöcken mit starken rauhen
Bossen (Buckelquader). Der ganze Zwinger wurde nun freigelegt, so daß der Blauerfuß mit Sockel und die Brüstungs-
mauer auf der Nordseite des Zwingers (gegen den Graben) sichtbar wurde. Die Schildmauer ist nun in ihrer ganzen
ursprünglichen Beschaffenheit sichtbar gemacht.
Etwa in der Mitte des Zwingers wurden verschiedene Scherben gefunden, die vom Denkmalamt als Hall-
stattscherben (oder späte Bronzezeit) bezeichnet wurden.
Im inneren Burghof wurden zwischen dem runden Bergfried und den: neuaufgedeckten quadratischen Raum
ein Sandsteinplattenbelag aufgedeckt sowie an 2 Stellen Ausgüsse durch die Schildmauer in Gestalt von halbrunden
Rinnen aus rotem Sandstein. Vor dem noch aufrechtstehenden Teil der östlichen Ringmauer südlich vom „Schloß"
wurde ein Backsteinplattenboden mit einer Wasserrinne aus Stein aufgedeckt, in welchem nutenartige Vertiefungen
in der Stärke von Holzbohlen im Abstand von etwa 0,6 m zu erkennen waren. In der Borburg (sog. Turniergarten)
wurde etwa in der Mitte der nördlichen Umfassungsmauer senkrecht zu dieser ein Versuchsgraben bis auf den ge-
wachsenen Boden gemacht. In einer Tiefe von etwa 3m kamen dabei schwarzgraue harte Scherben zum Vorschein. Diese
wurden vom Landesamt für Denkmalspflege der La-Tene-Zeit zugeschrieben. Im Abstand etwa von 1 m von der
äußeren Umfassungsmauer wurde gleichlaufend mit dieser eine unregelmäßige mauerartige Steinsetzung aufgedeckt.
Diese Untersuchungen konnten leider nicht mehr weiter verfolgt werden, da die verfügbaren Mittel und Arbeits-
kräfte auf die Durchführung der Arbeiten in der eigentlichen Burg zusammengehalten werden mußten.
Vor dem Haupttor wurde auch noch das Widerlager der ehemaligen Brücke über den Graben zun: Teil frei-
gelegt. Im Brunnenturm wurde der vollständig zugeschüttete und verschwundene Brunnenschacht wieder freigelegt
und wenigstens etwa 1 m tief sichtbar gemacht, auch der Eingang bis auf die ehemalige Schwelle wieder ausgegraben.
Im unteren Zwinger wurde der kaum noch sichtbare westliche Rundturm an der Südspitze von außen und innen unter-
sucht und seine von dem östlichen Turm daneben abweichende Form festgestellt. Etwa 5 m nördlich von dem östlichen
Rundturm kam auch noch ein weiteres Törchen mit gut erhaltenen Teilen der unteren Leibungen und der Schwelle
zum Vorschein. Außerhalb der östlichen Ringmauer der eigentlichen Burganlage konnte auf den im Süden anstehenden
Felsen noch ein Stück weit eine schwache Bruchsteinmauer aufgedeckt werden, deren Spur sich aber ganz im Schutt
verliert.
Es wäre erwünscht und sicher auch aussichtsreich, wenn bei einer weiteren Gelegenheit die Untersuchungen der
vorgeschichtlichen Spuren in der Vorburg fortgesetzt und weiter ausgedehnt werden könnten.
Die Ruine Falkenstein.
Hie Ruine Falkenstein bei Flintsbach in: bayerischen Oberinntal ist der letzte Rest eines einst stolzen und
^ mächtigen Sitzes. Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts war sie namengebend für die Grafschaft Falkenstein
Am bayerischen Sundergau, die sich vom Mangfallknie bis nahe an den Chiemsee und nach Südenbis zum
Leukental in Tirol erstreckte. Nachdem schon in der Wasserburger Fehde ein großer Teil dieses Gebietes
von den Herzögen von Bayern in Besitz genommen war, fiel auch noch der kleine Rest nebst der Stamm-
burg diesen durch das Aussterben der Grafen zu. Die Burg scheint dann zu völliger Bedeutungslosigkeit herab-
gesunken zu sein, da der Sitz der Pfleger die Auerburg bei Oberaudorf war. Anfangs des 16. Jahrhunderts verkauften
die bayerischen Herzöge die Burg und Herrschaft an den Bergherrn Hofer aus Rattenberg, nahmen sie aber einige
Jahrzehnte später wieder zurück. Erst als Georg Hundt von Lauterbach die Burg und Herrschaft im Jahre 1556 kaufte,
wurde sie wieder ein ständig bewohnter Herrensitz.
Dieser Gang der Geschichte spiegelt sich auch in dein Befund der Ruine selbst wieder. Von der ursprünglichen
Burg steht nur der rechteckige Bergfried. Alles andere ist im 16. Jahrhundert erbaut oder vollkommen umgestaltet.
Das alte Aussehen der Burg zeigen zwei Abbildungen in Wenigs Topographie von Bayern, eine größere und eine
kleinere, die in Einzelheiten voneinander abweichen. Das Verhältnis der beiden zueinander wird klar durch das beide
Male mit abgebildete Kirchlein auf dem dahinterliegenden Petersberg. Auf der kleineren Abbildung fehlen diesem
aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirchlein Anbauten aus dem 17. Jahrhundert. Es liegt dem Stich also eine
Vorlage aus dem 16. Jahrhundert zugrunde, wohl aus der Zeit bald nach dem Umbau. Die größere Abbildung ist
Aufnahme des Bestandes um 1700.
Der Turm, und demnach auch der ursprüngliche Bau, liegt auf einein schmälen Rücken, der von dem felsigen
Abfall des Petersberges nach Nordosten vorspringt und nach drei Seiten steil abfällt. Nach Südosten und Nord-
westen sind Terrassen vorgelagert, die erstere ziemlich eben und von einem kleinen Bachlauf begrenzt, die andere
sich allmählich zu dem Rand eines tiefeingerissenen felsigen Grabens absenkend. Die zweite ist durch eine Mauer
in die Burg miteinbezogen. Der Turm selbst ist rechteckig mit Zinnenbekrönung. Ursprünglich war er, wie der Turm
Abräumen des Schuttes eine andere Mauerart, bestehend aus mächtigen Kornsteinblöcken mit starken rauhen
Bossen (Buckelquader). Der ganze Zwinger wurde nun freigelegt, so daß der Blauerfuß mit Sockel und die Brüstungs-
mauer auf der Nordseite des Zwingers (gegen den Graben) sichtbar wurde. Die Schildmauer ist nun in ihrer ganzen
ursprünglichen Beschaffenheit sichtbar gemacht.
Etwa in der Mitte des Zwingers wurden verschiedene Scherben gefunden, die vom Denkmalamt als Hall-
stattscherben (oder späte Bronzezeit) bezeichnet wurden.
Im inneren Burghof wurden zwischen dem runden Bergfried und den: neuaufgedeckten quadratischen Raum
ein Sandsteinplattenbelag aufgedeckt sowie an 2 Stellen Ausgüsse durch die Schildmauer in Gestalt von halbrunden
Rinnen aus rotem Sandstein. Vor dem noch aufrechtstehenden Teil der östlichen Ringmauer südlich vom „Schloß"
wurde ein Backsteinplattenboden mit einer Wasserrinne aus Stein aufgedeckt, in welchem nutenartige Vertiefungen
in der Stärke von Holzbohlen im Abstand von etwa 0,6 m zu erkennen waren. In der Borburg (sog. Turniergarten)
wurde etwa in der Mitte der nördlichen Umfassungsmauer senkrecht zu dieser ein Versuchsgraben bis auf den ge-
wachsenen Boden gemacht. In einer Tiefe von etwa 3m kamen dabei schwarzgraue harte Scherben zum Vorschein. Diese
wurden vom Landesamt für Denkmalspflege der La-Tene-Zeit zugeschrieben. Im Abstand etwa von 1 m von der
äußeren Umfassungsmauer wurde gleichlaufend mit dieser eine unregelmäßige mauerartige Steinsetzung aufgedeckt.
Diese Untersuchungen konnten leider nicht mehr weiter verfolgt werden, da die verfügbaren Mittel und Arbeits-
kräfte auf die Durchführung der Arbeiten in der eigentlichen Burg zusammengehalten werden mußten.
Vor dem Haupttor wurde auch noch das Widerlager der ehemaligen Brücke über den Graben zun: Teil frei-
gelegt. Im Brunnenturm wurde der vollständig zugeschüttete und verschwundene Brunnenschacht wieder freigelegt
und wenigstens etwa 1 m tief sichtbar gemacht, auch der Eingang bis auf die ehemalige Schwelle wieder ausgegraben.
Im unteren Zwinger wurde der kaum noch sichtbare westliche Rundturm an der Südspitze von außen und innen unter-
sucht und seine von dem östlichen Turm daneben abweichende Form festgestellt. Etwa 5 m nördlich von dem östlichen
Rundturm kam auch noch ein weiteres Törchen mit gut erhaltenen Teilen der unteren Leibungen und der Schwelle
zum Vorschein. Außerhalb der östlichen Ringmauer der eigentlichen Burganlage konnte auf den im Süden anstehenden
Felsen noch ein Stück weit eine schwache Bruchsteinmauer aufgedeckt werden, deren Spur sich aber ganz im Schutt
verliert.
Es wäre erwünscht und sicher auch aussichtsreich, wenn bei einer weiteren Gelegenheit die Untersuchungen der
vorgeschichtlichen Spuren in der Vorburg fortgesetzt und weiter ausgedehnt werden könnten.
Die Ruine Falkenstein.
Hie Ruine Falkenstein bei Flintsbach in: bayerischen Oberinntal ist der letzte Rest eines einst stolzen und
^ mächtigen Sitzes. Bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts war sie namengebend für die Grafschaft Falkenstein
Am bayerischen Sundergau, die sich vom Mangfallknie bis nahe an den Chiemsee und nach Südenbis zum
Leukental in Tirol erstreckte. Nachdem schon in der Wasserburger Fehde ein großer Teil dieses Gebietes
von den Herzögen von Bayern in Besitz genommen war, fiel auch noch der kleine Rest nebst der Stamm-
burg diesen durch das Aussterben der Grafen zu. Die Burg scheint dann zu völliger Bedeutungslosigkeit herab-
gesunken zu sein, da der Sitz der Pfleger die Auerburg bei Oberaudorf war. Anfangs des 16. Jahrhunderts verkauften
die bayerischen Herzöge die Burg und Herrschaft an den Bergherrn Hofer aus Rattenberg, nahmen sie aber einige
Jahrzehnte später wieder zurück. Erst als Georg Hundt von Lauterbach die Burg und Herrschaft im Jahre 1556 kaufte,
wurde sie wieder ein ständig bewohnter Herrensitz.
Dieser Gang der Geschichte spiegelt sich auch in dein Befund der Ruine selbst wieder. Von der ursprünglichen
Burg steht nur der rechteckige Bergfried. Alles andere ist im 16. Jahrhundert erbaut oder vollkommen umgestaltet.
Das alte Aussehen der Burg zeigen zwei Abbildungen in Wenigs Topographie von Bayern, eine größere und eine
kleinere, die in Einzelheiten voneinander abweichen. Das Verhältnis der beiden zueinander wird klar durch das beide
Male mit abgebildete Kirchlein auf dem dahinterliegenden Petersberg. Auf der kleineren Abbildung fehlen diesem
aus dem 13. Jahrhundert stammenden Kirchlein Anbauten aus dem 17. Jahrhundert. Es liegt dem Stich also eine
Vorlage aus dem 16. Jahrhundert zugrunde, wohl aus der Zeit bald nach dem Umbau. Die größere Abbildung ist
Aufnahme des Bestandes um 1700.
Der Turm, und demnach auch der ursprüngliche Bau, liegt auf einein schmälen Rücken, der von dem felsigen
Abfall des Petersberges nach Nordosten vorspringt und nach drei Seiten steil abfällt. Nach Südosten und Nord-
westen sind Terrassen vorgelagert, die erstere ziemlich eben und von einem kleinen Bachlauf begrenzt, die andere
sich allmählich zu dem Rand eines tiefeingerissenen felsigen Grabens absenkend. Die zweite ist durch eine Mauer
in die Burg miteinbezogen. Der Turm selbst ist rechteckig mit Zinnenbekrönung. Ursprünglich war er, wie der Turm