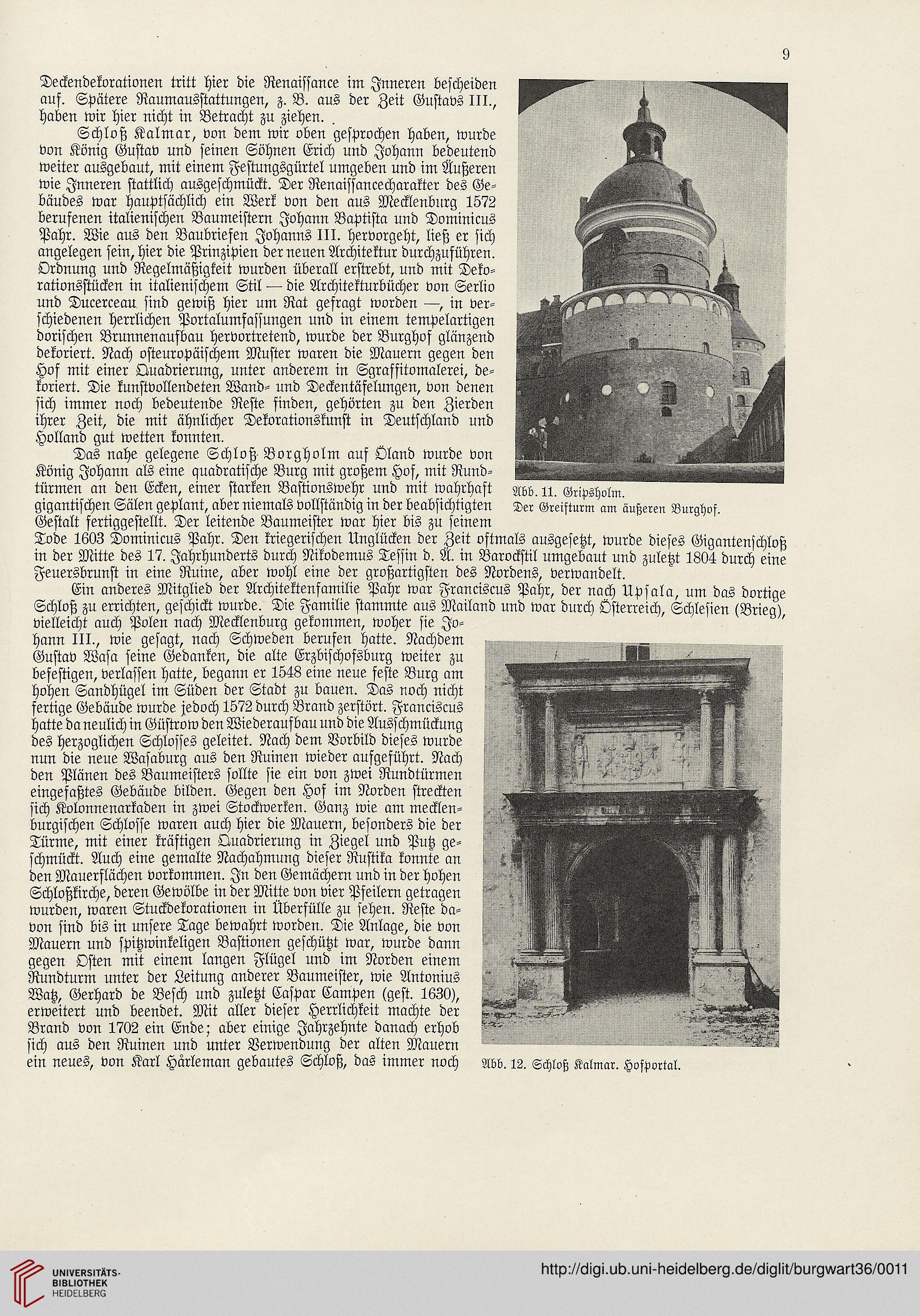9
Deckendekorationen tritt hier die Renaissance im Inneren bescheiden
auf. Spätere Raumausstattungen, z. B. aus der Zeit Gustavs III.,
haben wir hier nicht in Betracht zu ziehen.
Schloß Kalmar, von dem wir oben gesprochen haben, wurde
von König Gustav und seinen Söhnen Erich und Johann bedeutend
weiter ausgebaut, mit einem Festungsgürtel umgeben und im Äußeren
wie Inneren stattlich ausgeschmückt. Der Renaissancecharakter des Ge-
bäudes war hauptsächlich ein Werk von den aus Mecklenburg 1572
berufenen italienischen Baumeistern Johann Baptista und Dominicus
Pahr. Wie aus den Baubriefen Johanns III. hervorgeht, ließ er sich
angelegen sein, hier die Prinzipien der neuen Architektur durchzuführen.
Ordnung und Regelmäßigkeit wurden überall erstrebt, und mit Deko-
rationsstücken in italienischem Stil — die Architekturbücher von Serlio
und Ducerceau sind gewiß hier um Rat gefragt worden —, in ver-
schiedenen herrlichen Portalumfassungen und in einem tempelartigen
dorischen Bruunenaufbau hervortretend, wurde der Burghof glänzend
dekoriert. Nach osteuropäischem Muster waren die Mauern gegen den
Hof mit einer Quadrierung, unter anderem in Sgraffitomalerei, de-
koriert. Die kunstvollendeten Wand- und Deckentäfelungen, von denen
sich immer noch bedeutende Reste finden, gehörten zu den Zierden
ihrer Zeit, die mit ähnlicher Dekorationskunst in Deutschland und
Holland gut wetten konnten.
Das nahe gelegene Schloß Borg Holm aus Öland wurde von
König Johann als eine quadratische Burg mit großem Hof, mit Rund-
türmen an den Ecken, einer starken Bastionswehr und mit wahrhaft
gigantischen Sälen geplant, aber niemals vollständig in der beabsichtigten
Gestalt fertiggestellt. Der leitende Baumeister war hier bis zu seinem
Tode 1603 Dominicus Pahr. Den kriegerischen Unglücken der Zeit oftmals ausgesetzt, wurde dieses Gigantenschloß
in der Mitte des 17. Jahrhunderts durch Nikodemus Tessin d. Ä. in Barockstil umgebaut und zuletzt 1804 durch eine
Feuersbrunst in eine Ruine, aber wohl eine der großartigsten des Nordens, verwandelt.
Ein anderes Mitglied der Architektenfamilie Pahr war Franciscus Pahr, der nach Upsala, um das dortige
Schloß zu errichten, geschickt wurde. Die Familie stammte aus Mailand und war durch Österreich, Schlesien (Brieg),
vielleicht auch Polen nach Mecklenburg gekommen, woher sie Jo-
hann III., wie gesagt, nach Schweden berufen hatte. Nachdem
Gustav Wasa seine Gedanken, die alte Erzbischofsburg weiter zu
befestigen, verlassen hatte, begann er 1548 eine neue feste Burg am
hohen Sandhügel im Süden der Stadt zu bauen. Das noch nicht
fertige Gebäude wurde jedoch 1572 durch Brand zerstört. Franciscus
hatte da neulich in Güstrow den Wiederaufbau und die Ausschmückung
des herzoglichen Schlosses geleitet. Nach dem Vorbild dieses wurde
nun die neue Wasaburg aus den Ruinen wieder aufgeführt. Nach
den Plänen des Baumeisters sollte sie ein von zwei Rundtürmen
eingefaßtes Gebäude bilden. Gegen den Hof im Norden streckten
sich Kolonnenarkaden in zwei Stockwerken. Ganz wie am mecklen-
burgischen Schlosse waren auch hier die Mauern, besonders die der
Türme, mit einer kräftigen Quadrierung in Ziegel und Putz ge-
schmückt. Auch eine gemalte Nachahmung dieser Rustika konnte an
den Mauerslächen Vorkommen. In den Gemächern und in der hohen
Schloßkirche, deren Gewölbe in der Mitte von vier Pfeilern getragen
wurden, waren Stuckdekorationen in Überfülle zu sehen. Reste da-
von sind bis in unsere Tage bewahrt worden. Die Anlage, die von
Mauern und spitzwinkeligen Bastionen geschützt war, wurde dann
gegen Osten mit einem langen Flügel und im Norden einem
Rundturm unter der Leitung anderer Baumeister, wie Antonius
Watz, Gerhard de Besch und zuletzt Caspar Campen (gest. 1630),
erweitert und beendet. Mit aller dieser Herrlichkeit machte der
Brand von 1702 ein Ende; aber einige Jahrzehnte danach erhob
sich aus den Ruinen und unter Verwendung der alten Mauern
ein neues, von Karl Härleman gebautes Schloß, das immer noch Abb. 12. Schloß Kalmar. Hofportal.
Abb.11. Gripsholm.
Der Greifturm am äußeren Burghof.
Deckendekorationen tritt hier die Renaissance im Inneren bescheiden
auf. Spätere Raumausstattungen, z. B. aus der Zeit Gustavs III.,
haben wir hier nicht in Betracht zu ziehen.
Schloß Kalmar, von dem wir oben gesprochen haben, wurde
von König Gustav und seinen Söhnen Erich und Johann bedeutend
weiter ausgebaut, mit einem Festungsgürtel umgeben und im Äußeren
wie Inneren stattlich ausgeschmückt. Der Renaissancecharakter des Ge-
bäudes war hauptsächlich ein Werk von den aus Mecklenburg 1572
berufenen italienischen Baumeistern Johann Baptista und Dominicus
Pahr. Wie aus den Baubriefen Johanns III. hervorgeht, ließ er sich
angelegen sein, hier die Prinzipien der neuen Architektur durchzuführen.
Ordnung und Regelmäßigkeit wurden überall erstrebt, und mit Deko-
rationsstücken in italienischem Stil — die Architekturbücher von Serlio
und Ducerceau sind gewiß hier um Rat gefragt worden —, in ver-
schiedenen herrlichen Portalumfassungen und in einem tempelartigen
dorischen Bruunenaufbau hervortretend, wurde der Burghof glänzend
dekoriert. Nach osteuropäischem Muster waren die Mauern gegen den
Hof mit einer Quadrierung, unter anderem in Sgraffitomalerei, de-
koriert. Die kunstvollendeten Wand- und Deckentäfelungen, von denen
sich immer noch bedeutende Reste finden, gehörten zu den Zierden
ihrer Zeit, die mit ähnlicher Dekorationskunst in Deutschland und
Holland gut wetten konnten.
Das nahe gelegene Schloß Borg Holm aus Öland wurde von
König Johann als eine quadratische Burg mit großem Hof, mit Rund-
türmen an den Ecken, einer starken Bastionswehr und mit wahrhaft
gigantischen Sälen geplant, aber niemals vollständig in der beabsichtigten
Gestalt fertiggestellt. Der leitende Baumeister war hier bis zu seinem
Tode 1603 Dominicus Pahr. Den kriegerischen Unglücken der Zeit oftmals ausgesetzt, wurde dieses Gigantenschloß
in der Mitte des 17. Jahrhunderts durch Nikodemus Tessin d. Ä. in Barockstil umgebaut und zuletzt 1804 durch eine
Feuersbrunst in eine Ruine, aber wohl eine der großartigsten des Nordens, verwandelt.
Ein anderes Mitglied der Architektenfamilie Pahr war Franciscus Pahr, der nach Upsala, um das dortige
Schloß zu errichten, geschickt wurde. Die Familie stammte aus Mailand und war durch Österreich, Schlesien (Brieg),
vielleicht auch Polen nach Mecklenburg gekommen, woher sie Jo-
hann III., wie gesagt, nach Schweden berufen hatte. Nachdem
Gustav Wasa seine Gedanken, die alte Erzbischofsburg weiter zu
befestigen, verlassen hatte, begann er 1548 eine neue feste Burg am
hohen Sandhügel im Süden der Stadt zu bauen. Das noch nicht
fertige Gebäude wurde jedoch 1572 durch Brand zerstört. Franciscus
hatte da neulich in Güstrow den Wiederaufbau und die Ausschmückung
des herzoglichen Schlosses geleitet. Nach dem Vorbild dieses wurde
nun die neue Wasaburg aus den Ruinen wieder aufgeführt. Nach
den Plänen des Baumeisters sollte sie ein von zwei Rundtürmen
eingefaßtes Gebäude bilden. Gegen den Hof im Norden streckten
sich Kolonnenarkaden in zwei Stockwerken. Ganz wie am mecklen-
burgischen Schlosse waren auch hier die Mauern, besonders die der
Türme, mit einer kräftigen Quadrierung in Ziegel und Putz ge-
schmückt. Auch eine gemalte Nachahmung dieser Rustika konnte an
den Mauerslächen Vorkommen. In den Gemächern und in der hohen
Schloßkirche, deren Gewölbe in der Mitte von vier Pfeilern getragen
wurden, waren Stuckdekorationen in Überfülle zu sehen. Reste da-
von sind bis in unsere Tage bewahrt worden. Die Anlage, die von
Mauern und spitzwinkeligen Bastionen geschützt war, wurde dann
gegen Osten mit einem langen Flügel und im Norden einem
Rundturm unter der Leitung anderer Baumeister, wie Antonius
Watz, Gerhard de Besch und zuletzt Caspar Campen (gest. 1630),
erweitert und beendet. Mit aller dieser Herrlichkeit machte der
Brand von 1702 ein Ende; aber einige Jahrzehnte danach erhob
sich aus den Ruinen und unter Verwendung der alten Mauern
ein neues, von Karl Härleman gebautes Schloß, das immer noch Abb. 12. Schloß Kalmar. Hofportal.
Abb.11. Gripsholm.
Der Greifturm am äußeren Burghof.