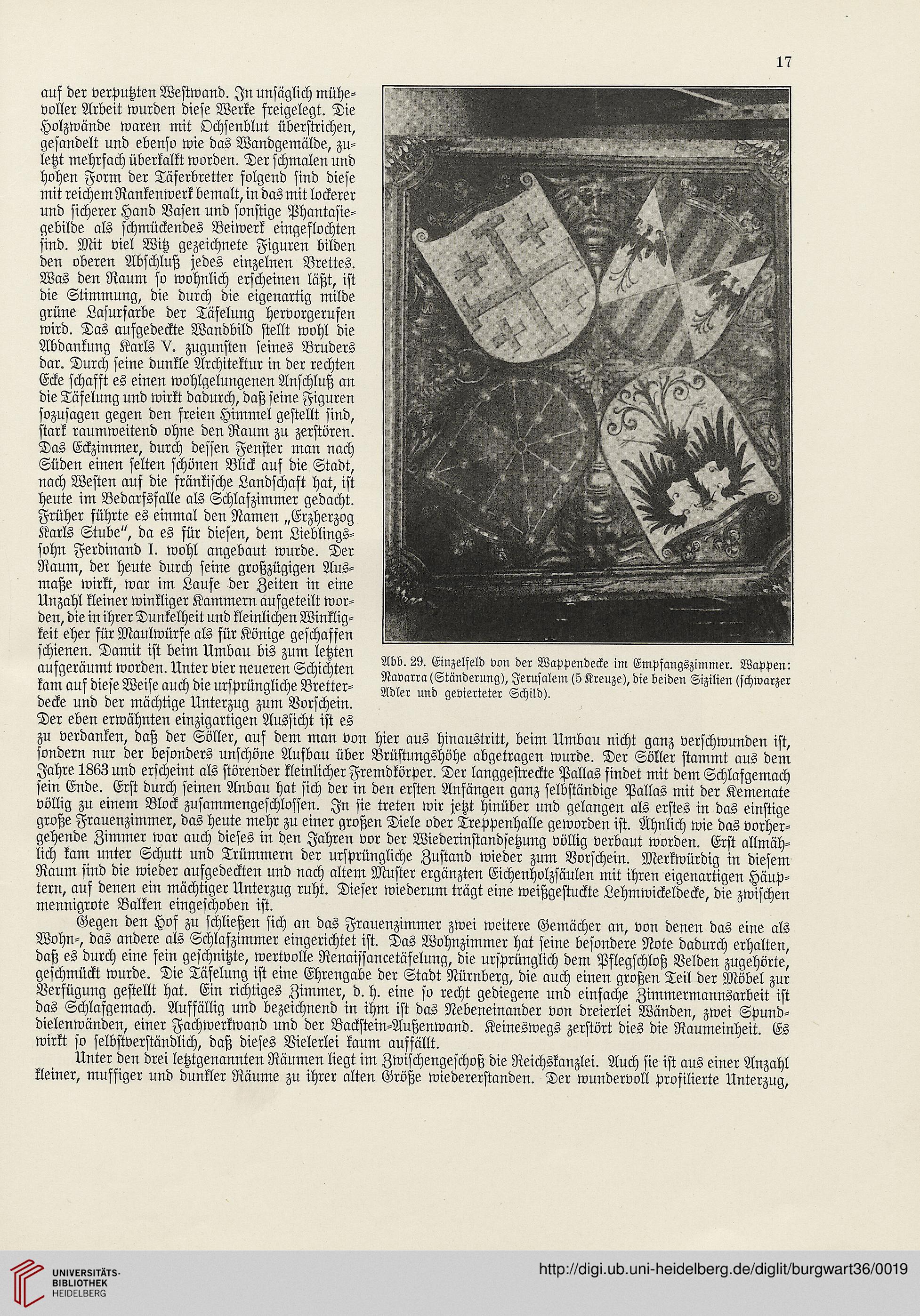17
auf der verputzten Westwand. In unsäglich mühe-
voller Arbeit wurden diese Werke freigelegt. Die
Holzwände waren mit Ochsenblut überstrichen,
gesandelt und ebenso wie das Wandgemälde, zu-
letzt mehrfach überkalkt worden. Der schmalen und
hohen Form der Täferbretter folgend sind diese
mit reichem Rankenwerk bemalt, in das mit lockerer
und sicherer Hand Vasen und sonstige Phantasie-
gebilde als schmückendes Beiwerk eingeslochten
sind. Mit viel Witz gezeichnete Figuren bilden
den oberen Abschluß jedes einzelnen Brettes.
Was den Raum so wohnlich erscheinen läßt, ist
die Sümmung, die durch die eigenartig milde
grüne Lasurfarbe der Täfelung hervorgerufen
wird. Das aufgedeckte Wandbild stellt wohl die
Abdankung Karls V. zugunsten seines Bruders
dar. Durch seine dunkle Architektur in der rechten
Ecke schafft es einen wohlgelungenen Anschluß au
die Täfelung und wirkt dadurch, daß seine Figuren
sozusagen gegen den freien Himmel gestellt sind,
stark raumweitend ohne den Raum zu zerstören.
Das Eckzimmer, durch dessen Fenster man nach
Süden einen selten schönen Blick auf die Stadt,
nach Westen auf die fränkische Landschaft hat, ist
heute im Bedarfsfälle als Schlafzimmer gedacht.
Früher führte es einmal den Namen „Erzherzog
Karls Stube", da es für diesen, dem Lieblings-
sohn Ferdinand I. wohl angebaut wurde. Der
Raum, der heute durch seine großzügigen Aus-
maße wirkt, war im Laufe der Zeiten in eine
Unzahl kleiner winkliger Kammern aufgeteilt wor-
den, die in ihrer Dunkelheit und kleinlichen Winklig-
keit eher für Maulwürfe als für Könige geschaffen
schienen. Damit ist beim Umbau bis zum letzten
aufgeräumt worden. Unter vier neueren Schichten
kam auf diese Weise auch die ursprüngliche Bretter-
decke und der mächtige Unterzug zum Vorschein.
Der eben erwähnten einzigartigen Aussicht ist es
zu verdanken, daß der Söller, auf dem man von hier aus hiuaustritt, beim Umbau nicht ganz verschwunden ist,
sondern nur der besonders unschöne Aufbau über Brüstungshöhe abgetragen wurde. Der Söller stammt aus dem
Jahre 1863 und erscheint als störender kleinlicher Fremdkörper. Der langgestreckte Pallas findet mit dem Schlafgemach
sein Ende. Erst durch seinen Anbau hat sich der in den ersten Anfängen ganz selbständige Pallas mit der Kemenate
völlig zu einem Block zusammengeschlossen. In sie treten wir jetzt hinüber und gelangen als erstes in das einstige
große Frauenzimmer, das heute mehr zu einer großen Diele oder Treppenhalle geworden ist. Ähnlich wie das vorher-
gehende Zimmer war auch dieses in den Jahren vor der Wiederinstandsetzung völlig verbaut worden. Erst allmäh-
lich kam unter Schutt und Trümmern der ursprüngliche Zustand wieder zum Vorschein. Merkwürdig in diesem
Raum sind die wieder aufgedeckten und nach altem Muster ergänzten Eichenholzsäulen mit ihren eigenartigen Häup-
tern, auf deneu ein mächtiger Unterzug ruht. Dieser wiederum trägt eine weißgestuckte Lehmwickeldecke, die zwischen
mennigrote Balken eingeschoben ist.
Gegen den Hof zu schließen sich an das Frauenzimmer zwei weitere Gemächer an, von denen das eine als
Wohn-, das andere als Schlafzimmer eingerichtet ist. Das Wohnzimmer hat seine besondere Note dadurch erhalten,
daß es durch eine fein geschnitzte, wertvolle Renaissancetäfelung, die ursprünglich dem Pflegschloß Velden zugehörte,
geschmückt wurde. Die Täfelung ist eine Ehrengabe der Stadt Nürnberg, die auch einen großen Teil der Möbel zur
Verfügung gestellt hat. Ein richtiges Zimmer, d. h. eine so recht gediegene und einfache Zimmermannsarbeit ist
das Schlafgemach. Auffällig und bezeichnend in ihm ist das Nebeneinander von dreierlei Wänden, zwei Spund-
dielenwänden, einer Fachwerkwand und der Backstein-Außenwand. Keineswegs zerstört dies die Raumeinheit. Es
wirkt so selbstverständlich, daß dieses Vielerlei kaum auffällt.
Unter den drei letztgenannten Räumen liegt im Zwischengeschoß die Reichskanzlei. Auch sie ist aus einer Anzahl
kleiner, muffiger und dunkler Räume zu ihrer alten Größe wiedererstauden. Der wundervoll profilierte Unterzug,
Abb. 29. Einzelseld von der Wappendecke im Empfangszimmer. Wappen:
Navarra (Ständerung), Jerusalem (5 Kreuze), die beiden Sizilien (schwarzer
Adler und gevierteter Schild).
auf der verputzten Westwand. In unsäglich mühe-
voller Arbeit wurden diese Werke freigelegt. Die
Holzwände waren mit Ochsenblut überstrichen,
gesandelt und ebenso wie das Wandgemälde, zu-
letzt mehrfach überkalkt worden. Der schmalen und
hohen Form der Täferbretter folgend sind diese
mit reichem Rankenwerk bemalt, in das mit lockerer
und sicherer Hand Vasen und sonstige Phantasie-
gebilde als schmückendes Beiwerk eingeslochten
sind. Mit viel Witz gezeichnete Figuren bilden
den oberen Abschluß jedes einzelnen Brettes.
Was den Raum so wohnlich erscheinen läßt, ist
die Sümmung, die durch die eigenartig milde
grüne Lasurfarbe der Täfelung hervorgerufen
wird. Das aufgedeckte Wandbild stellt wohl die
Abdankung Karls V. zugunsten seines Bruders
dar. Durch seine dunkle Architektur in der rechten
Ecke schafft es einen wohlgelungenen Anschluß au
die Täfelung und wirkt dadurch, daß seine Figuren
sozusagen gegen den freien Himmel gestellt sind,
stark raumweitend ohne den Raum zu zerstören.
Das Eckzimmer, durch dessen Fenster man nach
Süden einen selten schönen Blick auf die Stadt,
nach Westen auf die fränkische Landschaft hat, ist
heute im Bedarfsfälle als Schlafzimmer gedacht.
Früher führte es einmal den Namen „Erzherzog
Karls Stube", da es für diesen, dem Lieblings-
sohn Ferdinand I. wohl angebaut wurde. Der
Raum, der heute durch seine großzügigen Aus-
maße wirkt, war im Laufe der Zeiten in eine
Unzahl kleiner winkliger Kammern aufgeteilt wor-
den, die in ihrer Dunkelheit und kleinlichen Winklig-
keit eher für Maulwürfe als für Könige geschaffen
schienen. Damit ist beim Umbau bis zum letzten
aufgeräumt worden. Unter vier neueren Schichten
kam auf diese Weise auch die ursprüngliche Bretter-
decke und der mächtige Unterzug zum Vorschein.
Der eben erwähnten einzigartigen Aussicht ist es
zu verdanken, daß der Söller, auf dem man von hier aus hiuaustritt, beim Umbau nicht ganz verschwunden ist,
sondern nur der besonders unschöne Aufbau über Brüstungshöhe abgetragen wurde. Der Söller stammt aus dem
Jahre 1863 und erscheint als störender kleinlicher Fremdkörper. Der langgestreckte Pallas findet mit dem Schlafgemach
sein Ende. Erst durch seinen Anbau hat sich der in den ersten Anfängen ganz selbständige Pallas mit der Kemenate
völlig zu einem Block zusammengeschlossen. In sie treten wir jetzt hinüber und gelangen als erstes in das einstige
große Frauenzimmer, das heute mehr zu einer großen Diele oder Treppenhalle geworden ist. Ähnlich wie das vorher-
gehende Zimmer war auch dieses in den Jahren vor der Wiederinstandsetzung völlig verbaut worden. Erst allmäh-
lich kam unter Schutt und Trümmern der ursprüngliche Zustand wieder zum Vorschein. Merkwürdig in diesem
Raum sind die wieder aufgedeckten und nach altem Muster ergänzten Eichenholzsäulen mit ihren eigenartigen Häup-
tern, auf deneu ein mächtiger Unterzug ruht. Dieser wiederum trägt eine weißgestuckte Lehmwickeldecke, die zwischen
mennigrote Balken eingeschoben ist.
Gegen den Hof zu schließen sich an das Frauenzimmer zwei weitere Gemächer an, von denen das eine als
Wohn-, das andere als Schlafzimmer eingerichtet ist. Das Wohnzimmer hat seine besondere Note dadurch erhalten,
daß es durch eine fein geschnitzte, wertvolle Renaissancetäfelung, die ursprünglich dem Pflegschloß Velden zugehörte,
geschmückt wurde. Die Täfelung ist eine Ehrengabe der Stadt Nürnberg, die auch einen großen Teil der Möbel zur
Verfügung gestellt hat. Ein richtiges Zimmer, d. h. eine so recht gediegene und einfache Zimmermannsarbeit ist
das Schlafgemach. Auffällig und bezeichnend in ihm ist das Nebeneinander von dreierlei Wänden, zwei Spund-
dielenwänden, einer Fachwerkwand und der Backstein-Außenwand. Keineswegs zerstört dies die Raumeinheit. Es
wirkt so selbstverständlich, daß dieses Vielerlei kaum auffällt.
Unter den drei letztgenannten Räumen liegt im Zwischengeschoß die Reichskanzlei. Auch sie ist aus einer Anzahl
kleiner, muffiger und dunkler Räume zu ihrer alten Größe wiedererstauden. Der wundervoll profilierte Unterzug,
Abb. 29. Einzelseld von der Wappendecke im Empfangszimmer. Wappen:
Navarra (Ständerung), Jerusalem (5 Kreuze), die beiden Sizilien (schwarzer
Adler und gevierteter Schild).