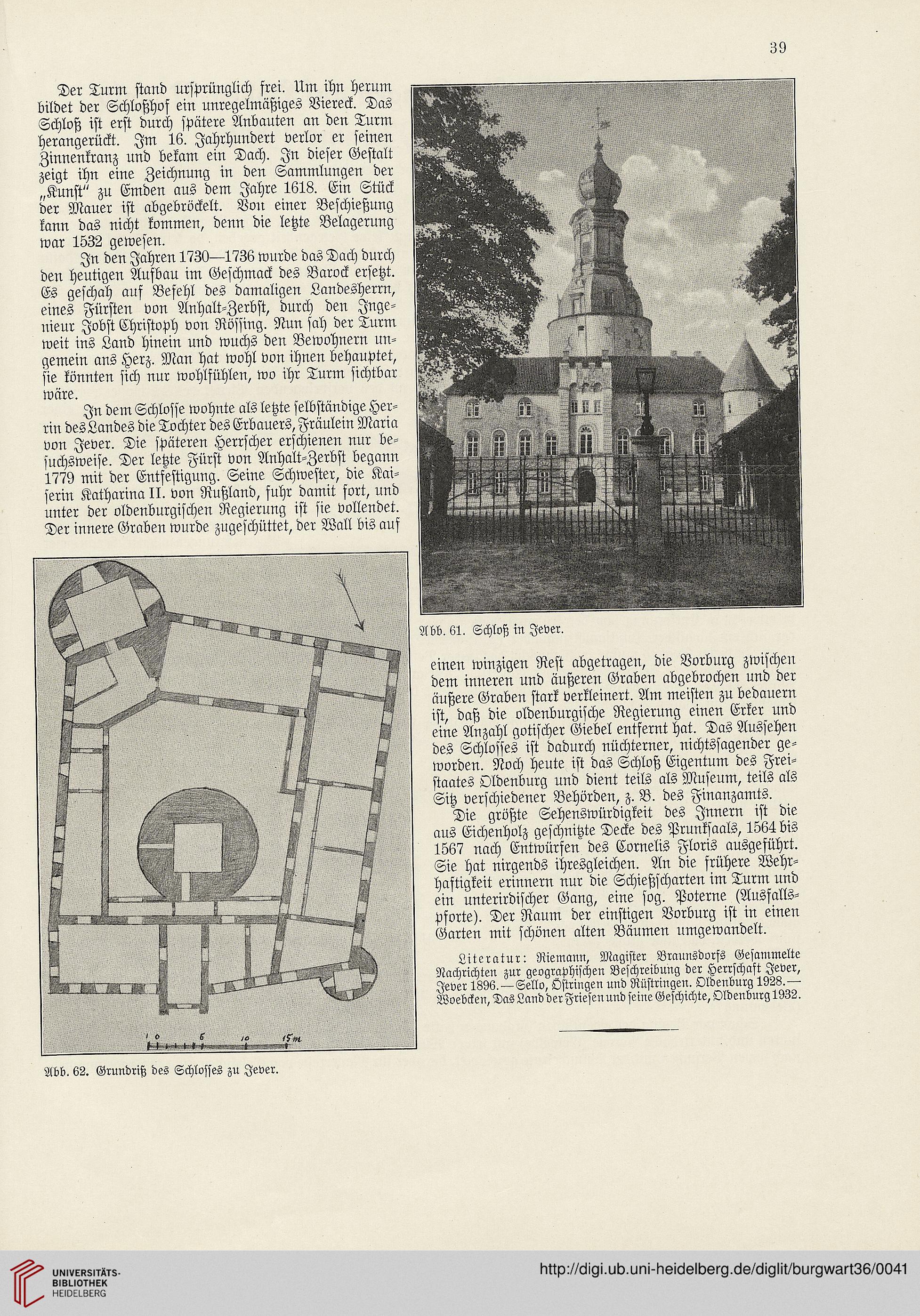39
Der Turin stand ursprünglich frei. Um ihn herum
bildet der Schloßhof ein unregelmäßiges Viereck. Das
Schloß ist erst durch spätere Anbauten an den Turm
herangerückt. Im 16. Jahrhundert verlor er seinen
Zinnenkranz und bekam ein Dach. In dieser Gestalt
zeigt ihn eine Zeichnung in den Sammlungen der
„Kunst" zu Emden aus dem Jahre 1618. Ein Stück
der Mauer ist abgebröckelt. Von einer Beschießung
kann das nicht kommen, denn die letzte Belagerung
war 1532 gewesen.
In den Jahren 1730—1736 wurde das Dach durch
den heutigen Aufbau im Geschmack des Barock ersetzt.
Es geschah auf Befehl des damaligen Landesherrn,
eines Fürsten von Anhalt-Zerbst, durch den Inge-
nieur Jobst Christoph von Rössing. Nun sah der Turm
weit ins Land hinein und wuchs den Bewohnern un-
gemein ans Herz. Man hat wohl von ihnen behauptet,
sie könnten sich nur wohlfühlen, wo ihr Turm sichtbar
wäre.
In dem Schlosse wohnte als letzte selbständige Her-
rin desLandes die Tochter des Erbauers, Fräulein Maria
von Jever. Die späteren Herrscher erschienen nur be-
suchsweise. Der letzte Fürst von Anhalt-Zerbst begann
1779 mit der Entfestigung. Seine Schwester, die Kai-
serin Katharina II. von Rußland, fuhr damit fort, und
unter der oldenburgischen Regierung ist sie vollendet.
Der innere Graben wurde zugeschüttet, der Wall bis auf
Abb. 61. Schloß in Jever.
einen winzigen Rest abgetragen, die Vorburg zwischen
dem inneren und äußeren Graben abgebrochen und der
äußere Graben stark verkleinert. Am meisten zu bedauern
ist, daß die oldenburgische Regierung einen Erker und
eine Anzahl gotischer Giebel entfernt hat. Das Aussehen
des Schlosses ist dadurch nüchterner, nichtssagender ge-
worden. Noch heute ist das Schloß Eigentum des Frei-
staates Oldenburg und dient teils als Museum, teils als
Sitz verschiedener Behörden, z. B. des Finanzamts.
Die größte Sehenswürdigkeit des Innern ist die
aus Eichenholz geschnitzte Decke des Prunksaals, 1564 bis
1567 nach Entwürfen des Cornelis Floris ausgeführt.
Sie hat nirgends ihresgleichen. An die frühere Wehr-
haftigkeit erinnern nur die Schießscharten im Turm und
ein unterirdischer Gang, eine sog. Poterne (Ausfalls-
pforte). Der Raum der einstigen Vorburg ist in einen
Garten mit schönen alten Bäumen umgewandelt.
Literatur: Riemann, Magister Braunsdvrfs Gesammelte
Nachrichten zur geographischen Beschreibung der Herrschaft Jever,
Jever 1896.—Sello, Östringen und Rüstringen. Oldenburg 1928.—
Woebcken, Das Land der Friesen und seine Geschichte, Oldenburg 1932.
Abb. 62. Grundriß des Schlosses zu Jever.
Der Turin stand ursprünglich frei. Um ihn herum
bildet der Schloßhof ein unregelmäßiges Viereck. Das
Schloß ist erst durch spätere Anbauten an den Turm
herangerückt. Im 16. Jahrhundert verlor er seinen
Zinnenkranz und bekam ein Dach. In dieser Gestalt
zeigt ihn eine Zeichnung in den Sammlungen der
„Kunst" zu Emden aus dem Jahre 1618. Ein Stück
der Mauer ist abgebröckelt. Von einer Beschießung
kann das nicht kommen, denn die letzte Belagerung
war 1532 gewesen.
In den Jahren 1730—1736 wurde das Dach durch
den heutigen Aufbau im Geschmack des Barock ersetzt.
Es geschah auf Befehl des damaligen Landesherrn,
eines Fürsten von Anhalt-Zerbst, durch den Inge-
nieur Jobst Christoph von Rössing. Nun sah der Turm
weit ins Land hinein und wuchs den Bewohnern un-
gemein ans Herz. Man hat wohl von ihnen behauptet,
sie könnten sich nur wohlfühlen, wo ihr Turm sichtbar
wäre.
In dem Schlosse wohnte als letzte selbständige Her-
rin desLandes die Tochter des Erbauers, Fräulein Maria
von Jever. Die späteren Herrscher erschienen nur be-
suchsweise. Der letzte Fürst von Anhalt-Zerbst begann
1779 mit der Entfestigung. Seine Schwester, die Kai-
serin Katharina II. von Rußland, fuhr damit fort, und
unter der oldenburgischen Regierung ist sie vollendet.
Der innere Graben wurde zugeschüttet, der Wall bis auf
Abb. 61. Schloß in Jever.
einen winzigen Rest abgetragen, die Vorburg zwischen
dem inneren und äußeren Graben abgebrochen und der
äußere Graben stark verkleinert. Am meisten zu bedauern
ist, daß die oldenburgische Regierung einen Erker und
eine Anzahl gotischer Giebel entfernt hat. Das Aussehen
des Schlosses ist dadurch nüchterner, nichtssagender ge-
worden. Noch heute ist das Schloß Eigentum des Frei-
staates Oldenburg und dient teils als Museum, teils als
Sitz verschiedener Behörden, z. B. des Finanzamts.
Die größte Sehenswürdigkeit des Innern ist die
aus Eichenholz geschnitzte Decke des Prunksaals, 1564 bis
1567 nach Entwürfen des Cornelis Floris ausgeführt.
Sie hat nirgends ihresgleichen. An die frühere Wehr-
haftigkeit erinnern nur die Schießscharten im Turm und
ein unterirdischer Gang, eine sog. Poterne (Ausfalls-
pforte). Der Raum der einstigen Vorburg ist in einen
Garten mit schönen alten Bäumen umgewandelt.
Literatur: Riemann, Magister Braunsdvrfs Gesammelte
Nachrichten zur geographischen Beschreibung der Herrschaft Jever,
Jever 1896.—Sello, Östringen und Rüstringen. Oldenburg 1928.—
Woebcken, Das Land der Friesen und seine Geschichte, Oldenburg 1932.
Abb. 62. Grundriß des Schlosses zu Jever.