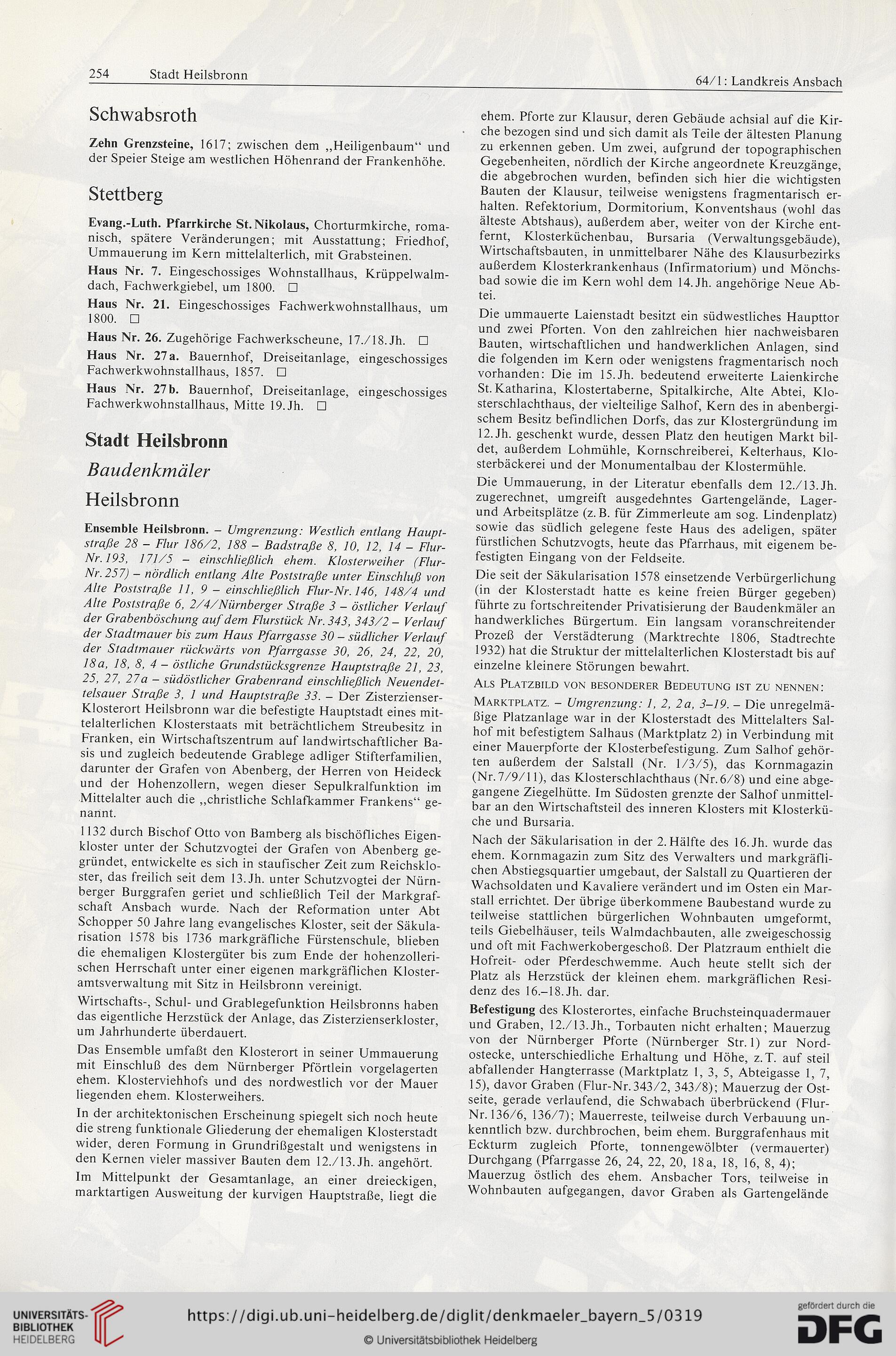254
Stadt Heilsbronn
64/1: Landkreis Ansbach
Schwabsroth
Zehn Grenzsteine, 1617; zwischen dem „Heiligenbaum“ und
der Speier Steige am westlichen Höhenrand der Frankenhöhe.
Stettberg
Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Nikolaus, Chorturmkirche, roma-
nisch, spätere Veränderungen; mit Ausstattung; Friedhof,
Ummauerung im Kern mittelalterlich, mit Grabsteinen.
Haus Nr. 7. Eingeschossiges Wohnstallhaus, Krüppelwalm-
dach, Fachwerkgiebel, um 1800.
Haus Nr. 21. Eingeschossiges Fachwerkwohnstallhaus, um
1800.
Haus Nr. 26. Zugehörige Fachwerkscheune, 17./18. Jh.
Haus Nr. 27 a. Bauernhof, Dreiseitanlage, eingeschossiges
Fachwerkwohnstallhaus, 1857.
Haus Nr. 27b. Bauernhof, Dreiseitanlage, eingeschossiges
Fachwerkwohnstallhaus, Mitte 19. Jh.
Stadt Heilsbronn
Baudenkmäler
Heilsbronn
Ensemble Heilsbronn. - Umgrenzung: Westlich entlang Haupt-
straße 28 - Flur 186/2, 188 - Badstraße 8, 10, 12, 14 - Flur-
Nr. 193, 171/5 - einschließlich ehern. Klosterweiher (Flur-
Nr. 257) - nördlich entlang Alte Poststraße unter Einschluß von
Alte Poststraße 11, 9 - einschließlich Flur-Nr. 146, 148/4 und
Alte Poststraße 6, 2/4/Nürnberger Straße 3 - östlicher Verlauf
der Grabenböschung auf dem Flurstück Nr. 343, 343/2 - Verlauf
der Stadtmauer bis zum Haus Pfarrgasse 30 - südlicher Verlauf
der Stadtmauer rückwärts von Pfarrgasse 30, 26, 24, 22, 20,
18 a, 18, 8, 4 - östliche Grundstücksgrenze Hauptstraße 21, 23,
25, 27, 27ä - südöstlicher Grabenrand einschließlich Neuendet-
telsauer Straße 3, 1 und Hauptstraße 33. - Der Zisterzienser-
Klosterort Heilsbronn war die befestigte Hauptstadt eines mit-
telalterlichen Klosterstaats mit beträchtlichem Streubesitz in
Franken, ein Wirtschaftszentrum auf landwirtschaftlicher Ba-
sis und zugleich bedeutende Grablege adliger Stifterfamilien,
darunter der Grafen von Abenberg, der Herren von Heideck
und der Hohenzollern, wegen dieser Sepulkralfunktion im
Mittelalter auch die „christliche Schlafkammer Frankens“ ge-
nannt.
1132 durch Bischof Otto von Bamberg als bischöfliches Eigen-
kloster unter der Schutzvogtei der Grafen von Abenberg ge-
gründet, entwickelte es sich in staufischer Zeit zum Reichsklo-
ster, das freilich seit dem 13. Jh. unter Schutzvogtei der Nürn-
berger Burggrafen geriet und schließlich Teil der Markgraf-
schaft Ansbach wurde. Nach der Reformation unter Abt
Schopper 50 Jahre lang evangelisches Kloster, seit der Säkula-
risation 1578 bis 1736 markgräfliche Fürstenschule, blieben
die ehemaligen Klostergüter bis zum Ende der hohenzolleri-
schen Herrschaft unter einer eigenen markgräflichen Kloster-
amtsverwaltung mit Sitz in Heilsbronn vereinigt.
Wirtschafts-, Schul- und Grablegefunktion Heilsbronns haben
das eigentliche Herzstück der Anlage, das Zisterzienserkloster,
um Jahrhunderte überdauert.
Das Ensemble umfaßt den Klosterort in seiner Ummauerung
mit Einschluß des dem Nürnberger Pförtlein vorgelagerten
ehern. Klosterviehhofs und des nordwestlich vor der Mauer
liegenden ehern. Klosterweihers.
In der architektonischen Erscheinung spiegelt sich noch heute
die streng funktionale Gliederung der ehemaligen Klosterstadt
wider, deren Formung in Grundrißgestalt und wenigstens in
den Kernen vieler massiver Bauten dem 12./13.Jh. angehört.
Im Mittelpunkt der Gesamtanlage, an einer dreieckigen,
marktartigen Ausweitung der kurvigen Hauptstraße, liegt die
ehern. Pforte zur Klausur, deren Gebäude achsial auf die Kir-
che bezogen sind und sich damit als Teile der ältesten Planung
zu erkennen geben. Um zwei, aufgrund der topographischen
Gegebenheiten, nördlich der Kirche angeordnete Kreuzgänge,
die abgebrochen wurden, befinden sich hier die wichtigsten
Bauten der Klausur, teilweise wenigstens fragmentarisch er-
halten. Refektorium, Dormitorium, Konventshaus (wohl das
älteste Abtshaus), außerdem aber, weiter von der Kirche ent-
fernt, Klosterküchenbau, Bursaria (Verwaltungsgebäude),
Wirtschaftsbauten, in unmittelbarer Nähe des Klausurbezirks
außerdem Klosterkrankenhaus (Infirmatorium) und Mönchs-
bad sowie die im Kern wohl dem 14. Jh. angehörige Neue Ab-
tei.
Die ummauerte Laienstadt besitzt ein südwestliches Haupttor
und zwei Pforten. Von den zahlreichen hier nachweisbaren
Bauten, wirtschaftlichen und handwerklichen Anlagen, sind
die folgenden im Kern oder wenigstens fragmentarisch noch
vorhanden: Die im 15.Jh. bedeutend erweiterte Laienkirche
St. Katharina, Klostertaberne, Spitalkirche, Alte Abtei, Klo-
sterschlachthaus, der vielteilige Salhof, Kern des in abenbergi-
schem Besitz befindlichen Dorfs, das zur Klostergründung im
12. Jh. geschenkt wurde, dessen Platz den heutigen Markt bil-
det, außerdem Lohmühle, Kornschreiberei, Kelterhaus, Klo-
sterbäckerei und der Monumentalbau der Klostermühle.
Die Ummauerung, in der Literatur ebenfalls dem 12./13. Jh.
zugerechnet, umgreift ausgedehntes Gartengelände, Lager-
und Arbeitsplätze (z. B. für Zimmerleute am sog. Lindenplatz)
sowie das südlich gelegene feste Haus des adeligen, später
fürstlichen Schutzvogts, heute das Pfarrhaus, mit eigenem be-
festigten Eingang von der Feldseite.
Die seit der Säkularisation 1578 einsetzende Verbürgerlichung
(in der Klosterstadt hatte es keine freien Bürger gegeben)
führte zu fortschreitender Privatisierung der Baudenkmäler an
handwerkliches Bürgertum. Ein langsam voranschreitender
Prozeß der Verstädterung (Marktrechte 1806, Stadtrechte
1932) hat die Struktur der mittelalterlichen Klosterstadt bis auf
einzelne kleinere Störungen bewahrt.
Als Platzbild von besonderer Bedeutung ist zu nennen:
Marktplatz. - Umgrenzung: 1, 2, 2a, 3-19. - Die unregelmä-
ßige Platzanlage war in der Klosterstadt des Mittelalters Sal-
hof mit befestigtem Salhaus (Marktplatz 2) in Verbindung mit
einer Mauerpforte der Klosterbefestigung. Zum Salhof gehör-
ten außerdem der Salstall (Nr. 1/3/5), das Kornmagazin
(Nr. 7/9/11), das Klosterschlachthaus (Nr. 6/8) und eine abge-
gangene Ziegelhütte. Im Südosten grenzte der Salhof unmittel-
bar an den Wirtschaftsteil des inneren Klosters mit Klosterkü-
che und Bursaria.
Nach der Säkularisation in der 2. Hälfte des 16. Jh. wurde das
ehern. Kornmagazin zum Sitz des Verwalters und markgräfli-
chen Abstiegsquartier umgebaut, der Salstall zu Quartieren der
Wachsoldaten und Kavaliere verändert und im Osten ein Mar-
stall errichtet. Der übrige überkommene Baubestand wurde zu
teilweise stattlichen bürgerlichen Wohnbauten umgeformt,
teils Giebelhäuser, teils Walmdachbauten, alle zweigeschossig
und oft mit Fachwerkobergeschoß. Der Platzraum enthielt die
Hofreit- oder Pferdeschwemme. Auch heute stellt sich der
Platz als Herzstück der kleinen ehern, markgräflichen Resi-
denz des 16.-18. Jh. dar.
Befestigung des Klosterortes, einfache Bruchsteinquadermauer
und Graben, I2./13. Jh., Torbauten nicht erhalten; Mauerzug
von der Nürnberger Pforte (Nürnberger Str. 1) zur Nord-
ostecke, unterschiedliche Erhaltung und Höhe, z.T. auf steil
abfallender Hangterrasse (Marktplatz 1, 3, 5, Abteigasse 1, 7,
15), davor Graben (Flur-Nr. 343/2, 343/8); Mauerzug der Ost-
seite, gerade verlaufend, die Schwabach überbrückend (Flur-
Nr. 136/6, 136/7); Mauerreste, teilweise durch Verbauung un-
kenntlich bzw. durchbrochen, beim ehern. Burggrafenhaus mit
Eckturm zugleich Pforte, tonnengewölbter (vermauerter)
Durchgang (Pfarrgasse 26, 24, 22, 20, 18 a, 18, 16, 8, 4);
Mauerzug östlich des ehern. Ansbacher Tors, teilweise in
Wohnbauten aufgegangen, davor Graben als Gartengelände
Stadt Heilsbronn
64/1: Landkreis Ansbach
Schwabsroth
Zehn Grenzsteine, 1617; zwischen dem „Heiligenbaum“ und
der Speier Steige am westlichen Höhenrand der Frankenhöhe.
Stettberg
Evang.-Luth. Pfarrkirche St. Nikolaus, Chorturmkirche, roma-
nisch, spätere Veränderungen; mit Ausstattung; Friedhof,
Ummauerung im Kern mittelalterlich, mit Grabsteinen.
Haus Nr. 7. Eingeschossiges Wohnstallhaus, Krüppelwalm-
dach, Fachwerkgiebel, um 1800.
Haus Nr. 21. Eingeschossiges Fachwerkwohnstallhaus, um
1800.
Haus Nr. 26. Zugehörige Fachwerkscheune, 17./18. Jh.
Haus Nr. 27 a. Bauernhof, Dreiseitanlage, eingeschossiges
Fachwerkwohnstallhaus, 1857.
Haus Nr. 27b. Bauernhof, Dreiseitanlage, eingeschossiges
Fachwerkwohnstallhaus, Mitte 19. Jh.
Stadt Heilsbronn
Baudenkmäler
Heilsbronn
Ensemble Heilsbronn. - Umgrenzung: Westlich entlang Haupt-
straße 28 - Flur 186/2, 188 - Badstraße 8, 10, 12, 14 - Flur-
Nr. 193, 171/5 - einschließlich ehern. Klosterweiher (Flur-
Nr. 257) - nördlich entlang Alte Poststraße unter Einschluß von
Alte Poststraße 11, 9 - einschließlich Flur-Nr. 146, 148/4 und
Alte Poststraße 6, 2/4/Nürnberger Straße 3 - östlicher Verlauf
der Grabenböschung auf dem Flurstück Nr. 343, 343/2 - Verlauf
der Stadtmauer bis zum Haus Pfarrgasse 30 - südlicher Verlauf
der Stadtmauer rückwärts von Pfarrgasse 30, 26, 24, 22, 20,
18 a, 18, 8, 4 - östliche Grundstücksgrenze Hauptstraße 21, 23,
25, 27, 27ä - südöstlicher Grabenrand einschließlich Neuendet-
telsauer Straße 3, 1 und Hauptstraße 33. - Der Zisterzienser-
Klosterort Heilsbronn war die befestigte Hauptstadt eines mit-
telalterlichen Klosterstaats mit beträchtlichem Streubesitz in
Franken, ein Wirtschaftszentrum auf landwirtschaftlicher Ba-
sis und zugleich bedeutende Grablege adliger Stifterfamilien,
darunter der Grafen von Abenberg, der Herren von Heideck
und der Hohenzollern, wegen dieser Sepulkralfunktion im
Mittelalter auch die „christliche Schlafkammer Frankens“ ge-
nannt.
1132 durch Bischof Otto von Bamberg als bischöfliches Eigen-
kloster unter der Schutzvogtei der Grafen von Abenberg ge-
gründet, entwickelte es sich in staufischer Zeit zum Reichsklo-
ster, das freilich seit dem 13. Jh. unter Schutzvogtei der Nürn-
berger Burggrafen geriet und schließlich Teil der Markgraf-
schaft Ansbach wurde. Nach der Reformation unter Abt
Schopper 50 Jahre lang evangelisches Kloster, seit der Säkula-
risation 1578 bis 1736 markgräfliche Fürstenschule, blieben
die ehemaligen Klostergüter bis zum Ende der hohenzolleri-
schen Herrschaft unter einer eigenen markgräflichen Kloster-
amtsverwaltung mit Sitz in Heilsbronn vereinigt.
Wirtschafts-, Schul- und Grablegefunktion Heilsbronns haben
das eigentliche Herzstück der Anlage, das Zisterzienserkloster,
um Jahrhunderte überdauert.
Das Ensemble umfaßt den Klosterort in seiner Ummauerung
mit Einschluß des dem Nürnberger Pförtlein vorgelagerten
ehern. Klosterviehhofs und des nordwestlich vor der Mauer
liegenden ehern. Klosterweihers.
In der architektonischen Erscheinung spiegelt sich noch heute
die streng funktionale Gliederung der ehemaligen Klosterstadt
wider, deren Formung in Grundrißgestalt und wenigstens in
den Kernen vieler massiver Bauten dem 12./13.Jh. angehört.
Im Mittelpunkt der Gesamtanlage, an einer dreieckigen,
marktartigen Ausweitung der kurvigen Hauptstraße, liegt die
ehern. Pforte zur Klausur, deren Gebäude achsial auf die Kir-
che bezogen sind und sich damit als Teile der ältesten Planung
zu erkennen geben. Um zwei, aufgrund der topographischen
Gegebenheiten, nördlich der Kirche angeordnete Kreuzgänge,
die abgebrochen wurden, befinden sich hier die wichtigsten
Bauten der Klausur, teilweise wenigstens fragmentarisch er-
halten. Refektorium, Dormitorium, Konventshaus (wohl das
älteste Abtshaus), außerdem aber, weiter von der Kirche ent-
fernt, Klosterküchenbau, Bursaria (Verwaltungsgebäude),
Wirtschaftsbauten, in unmittelbarer Nähe des Klausurbezirks
außerdem Klosterkrankenhaus (Infirmatorium) und Mönchs-
bad sowie die im Kern wohl dem 14. Jh. angehörige Neue Ab-
tei.
Die ummauerte Laienstadt besitzt ein südwestliches Haupttor
und zwei Pforten. Von den zahlreichen hier nachweisbaren
Bauten, wirtschaftlichen und handwerklichen Anlagen, sind
die folgenden im Kern oder wenigstens fragmentarisch noch
vorhanden: Die im 15.Jh. bedeutend erweiterte Laienkirche
St. Katharina, Klostertaberne, Spitalkirche, Alte Abtei, Klo-
sterschlachthaus, der vielteilige Salhof, Kern des in abenbergi-
schem Besitz befindlichen Dorfs, das zur Klostergründung im
12. Jh. geschenkt wurde, dessen Platz den heutigen Markt bil-
det, außerdem Lohmühle, Kornschreiberei, Kelterhaus, Klo-
sterbäckerei und der Monumentalbau der Klostermühle.
Die Ummauerung, in der Literatur ebenfalls dem 12./13. Jh.
zugerechnet, umgreift ausgedehntes Gartengelände, Lager-
und Arbeitsplätze (z. B. für Zimmerleute am sog. Lindenplatz)
sowie das südlich gelegene feste Haus des adeligen, später
fürstlichen Schutzvogts, heute das Pfarrhaus, mit eigenem be-
festigten Eingang von der Feldseite.
Die seit der Säkularisation 1578 einsetzende Verbürgerlichung
(in der Klosterstadt hatte es keine freien Bürger gegeben)
führte zu fortschreitender Privatisierung der Baudenkmäler an
handwerkliches Bürgertum. Ein langsam voranschreitender
Prozeß der Verstädterung (Marktrechte 1806, Stadtrechte
1932) hat die Struktur der mittelalterlichen Klosterstadt bis auf
einzelne kleinere Störungen bewahrt.
Als Platzbild von besonderer Bedeutung ist zu nennen:
Marktplatz. - Umgrenzung: 1, 2, 2a, 3-19. - Die unregelmä-
ßige Platzanlage war in der Klosterstadt des Mittelalters Sal-
hof mit befestigtem Salhaus (Marktplatz 2) in Verbindung mit
einer Mauerpforte der Klosterbefestigung. Zum Salhof gehör-
ten außerdem der Salstall (Nr. 1/3/5), das Kornmagazin
(Nr. 7/9/11), das Klosterschlachthaus (Nr. 6/8) und eine abge-
gangene Ziegelhütte. Im Südosten grenzte der Salhof unmittel-
bar an den Wirtschaftsteil des inneren Klosters mit Klosterkü-
che und Bursaria.
Nach der Säkularisation in der 2. Hälfte des 16. Jh. wurde das
ehern. Kornmagazin zum Sitz des Verwalters und markgräfli-
chen Abstiegsquartier umgebaut, der Salstall zu Quartieren der
Wachsoldaten und Kavaliere verändert und im Osten ein Mar-
stall errichtet. Der übrige überkommene Baubestand wurde zu
teilweise stattlichen bürgerlichen Wohnbauten umgeformt,
teils Giebelhäuser, teils Walmdachbauten, alle zweigeschossig
und oft mit Fachwerkobergeschoß. Der Platzraum enthielt die
Hofreit- oder Pferdeschwemme. Auch heute stellt sich der
Platz als Herzstück der kleinen ehern, markgräflichen Resi-
denz des 16.-18. Jh. dar.
Befestigung des Klosterortes, einfache Bruchsteinquadermauer
und Graben, I2./13. Jh., Torbauten nicht erhalten; Mauerzug
von der Nürnberger Pforte (Nürnberger Str. 1) zur Nord-
ostecke, unterschiedliche Erhaltung und Höhe, z.T. auf steil
abfallender Hangterrasse (Marktplatz 1, 3, 5, Abteigasse 1, 7,
15), davor Graben (Flur-Nr. 343/2, 343/8); Mauerzug der Ost-
seite, gerade verlaufend, die Schwabach überbrückend (Flur-
Nr. 136/6, 136/7); Mauerreste, teilweise durch Verbauung un-
kenntlich bzw. durchbrochen, beim ehern. Burggrafenhaus mit
Eckturm zugleich Pforte, tonnengewölbter (vermauerter)
Durchgang (Pfarrgasse 26, 24, 22, 20, 18 a, 18, 16, 8, 4);
Mauerzug östlich des ehern. Ansbacher Tors, teilweise in
Wohnbauten aufgegangen, davor Graben als Gartengelände