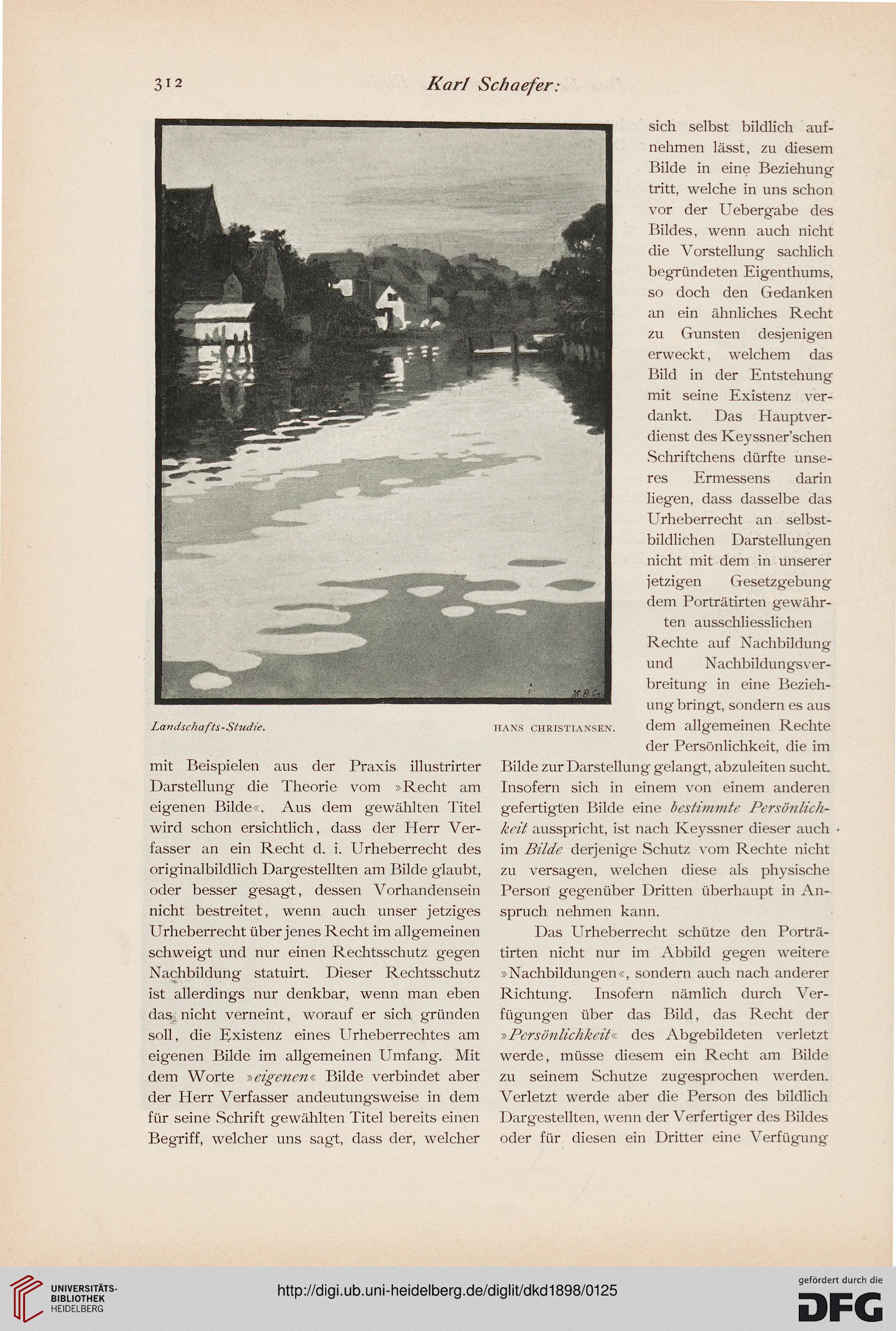312
Karl Schaefer:
Lava1 Schafts-Studie.
mit Beispielen aus der Praxis illustrirter
Darstellung die Theorie vom »Recht am
eigenen Bilde?. Aus dem gewählten Titel
wird schon ersichtlich, dass der Herr Ver-
fasser an ein Recht d. i. Urheberrecht des
originalbildlich Dargestellten am Bilde glaubt,
oder besser gesagt, dessen Vorhandensein
nicht bestreitet, wenn auch unser jetziges
Urheberrecht über jenes Recht im allgemeinen
schweigt und nur einen Rechtsschutz gegen
Nachbildung statuirt. Dieser Rechtsschutz
ist allerdings nur denkbar, wenn man eben
das nicht verneint, worauf er sich gründen
soll, die Existenz eines Urheberrechtes am
eigenen Bilde im allgemeinen Umfang. Mit
dem Worte »eigenen« Bilde verbindet aber
der Herr Verfasser andeutungsweise in dem
für seine Schrift gewählten Titel bereits einen
Begriff, welcher uns sagt, dass der, welcher
sich selbst bildlich auf-
nehmen lässt, zu diesem
Bilde in eine Beziehung
tritt, welche in uns schon
vor der Uebergabe des
Bildes, wenn auch nicht
die Vorstellung sachlich
begründeten Eigenthums,
so doch den Gedanken
an ein ähnliches Recht
zu Gunsten desjenigen
erweckt, welchem das
Bild in der Entstehung
mit seine Existenz ver-
dankt. Das Hauptver-
dienst des Keyssner'schen
Schriftchens dürfte unse-
res Ermessens darin
liegen, dass dasselbe das
Urheberrecht an selbst-
bildlichen Darstellungen
nicht mit dem in unserer
jetzigen Gesetzgebung
dem Porträtirten gewähr-
ten ausschliesslichen
Rechte auf Nachbildung
und Nachbildungsver-
breitung in eine Bezieh-
ung bringt, sondern es aus
dem allgemeinen Rechte
der Persönlichkeit, die im
Bilde zur Darstellung gelangt, abzuleiten sucht.
Insofern sich in einem von einem anderen
gefertigten Bilde eine bestimmte Persönlich-
keit ausspricht, ist nach Keyssner dieser auch ■
im Bilde derjenige Schutz vom Rechte nicht
zu versagen, welchen diese als physische
Person gegenüber Dritten überhaupt in An-
spruch nehmen kann.
Das Urheberrecht schütze den Porträ-
tirten nicht nur im Abbild gegen weitere
»Nachbildungen«, sondern auch nach anderer
Richtung. Insofern nämlich durch Ver-
fügungen über das Bild, das Recht der
»Persönlichkeit« des Abgebildeten verletzt
werde, müsse diesem ein Recht am Bilde
zu seinem Schutze zugesprochen werden.
Verletzt werde aber die Person des bildlich
I )argestellten, wenn der Verfertiger des Bildes
oder für diesen ein Dritter eine Verfügung
II WS CmiiSTI.W'SKN.
Karl Schaefer:
Lava1 Schafts-Studie.
mit Beispielen aus der Praxis illustrirter
Darstellung die Theorie vom »Recht am
eigenen Bilde?. Aus dem gewählten Titel
wird schon ersichtlich, dass der Herr Ver-
fasser an ein Recht d. i. Urheberrecht des
originalbildlich Dargestellten am Bilde glaubt,
oder besser gesagt, dessen Vorhandensein
nicht bestreitet, wenn auch unser jetziges
Urheberrecht über jenes Recht im allgemeinen
schweigt und nur einen Rechtsschutz gegen
Nachbildung statuirt. Dieser Rechtsschutz
ist allerdings nur denkbar, wenn man eben
das nicht verneint, worauf er sich gründen
soll, die Existenz eines Urheberrechtes am
eigenen Bilde im allgemeinen Umfang. Mit
dem Worte »eigenen« Bilde verbindet aber
der Herr Verfasser andeutungsweise in dem
für seine Schrift gewählten Titel bereits einen
Begriff, welcher uns sagt, dass der, welcher
sich selbst bildlich auf-
nehmen lässt, zu diesem
Bilde in eine Beziehung
tritt, welche in uns schon
vor der Uebergabe des
Bildes, wenn auch nicht
die Vorstellung sachlich
begründeten Eigenthums,
so doch den Gedanken
an ein ähnliches Recht
zu Gunsten desjenigen
erweckt, welchem das
Bild in der Entstehung
mit seine Existenz ver-
dankt. Das Hauptver-
dienst des Keyssner'schen
Schriftchens dürfte unse-
res Ermessens darin
liegen, dass dasselbe das
Urheberrecht an selbst-
bildlichen Darstellungen
nicht mit dem in unserer
jetzigen Gesetzgebung
dem Porträtirten gewähr-
ten ausschliesslichen
Rechte auf Nachbildung
und Nachbildungsver-
breitung in eine Bezieh-
ung bringt, sondern es aus
dem allgemeinen Rechte
der Persönlichkeit, die im
Bilde zur Darstellung gelangt, abzuleiten sucht.
Insofern sich in einem von einem anderen
gefertigten Bilde eine bestimmte Persönlich-
keit ausspricht, ist nach Keyssner dieser auch ■
im Bilde derjenige Schutz vom Rechte nicht
zu versagen, welchen diese als physische
Person gegenüber Dritten überhaupt in An-
spruch nehmen kann.
Das Urheberrecht schütze den Porträ-
tirten nicht nur im Abbild gegen weitere
»Nachbildungen«, sondern auch nach anderer
Richtung. Insofern nämlich durch Ver-
fügungen über das Bild, das Recht der
»Persönlichkeit« des Abgebildeten verletzt
werde, müsse diesem ein Recht am Bilde
zu seinem Schutze zugesprochen werden.
Verletzt werde aber die Person des bildlich
I )argestellten, wenn der Verfertiger des Bildes
oder für diesen ein Dritter eine Verfügung
II WS CmiiSTI.W'SKN.