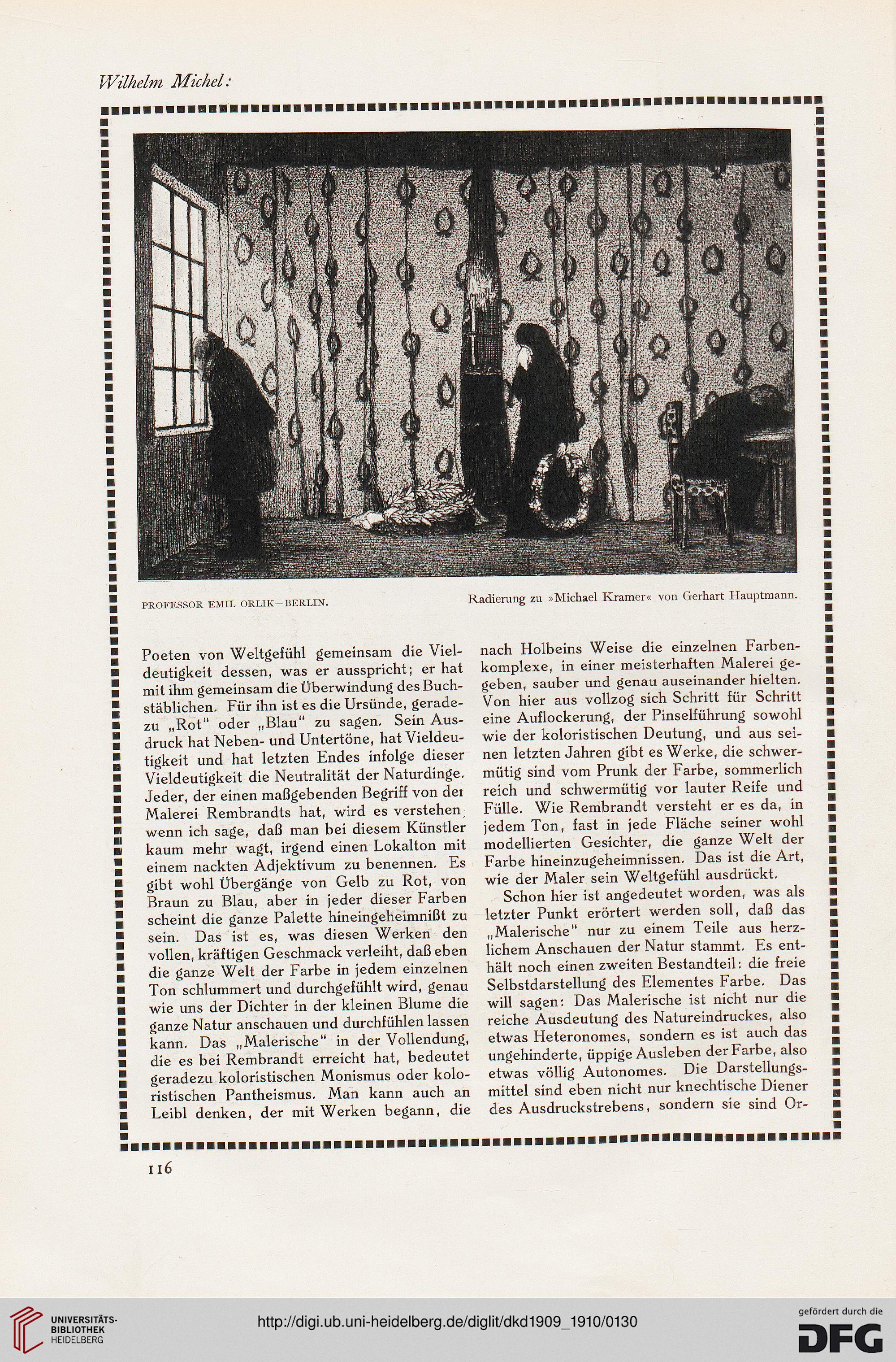Wilhelm Michel:
Professor emil orlik- herlin. Radierung zu »Michael Kramer« von (ierhart Hauptmann.
Poeten von Weltgefühl gemeinsam die Viel-
deutigkeit dessen, was er ausspricht; er hat
mit ihm gemeinsam die Überwindung des Buch-
stäblichen. Für ihn ist es die Ursünde, gerade-
zu „Rot" oder „Blau" zu sagen. Sein Aus-
druck hat Neben- und Untertöne, hat Vieldeu-
tigkeit und hat letzten Endes infolge dieser
Vieldeutigkeit die Neutralität der Naturdinge.
Jeder, der einen maßgebenden Begriff von dei
Malerei Rembrandts hat, wird es verstehen
wenn ich sage, daß man bei diesem Künstler
kaum mehr wagt, irgend einen Lokalton mit
einem nackten Adjektivum zu benennen. Es
gibt wohl Übergänge von Gelb zu Rot, von
Braun zu Blau, aber in jeder dieser Farben
scheint die ganze Palette hineingeheimnißt zu
sein. Das ist es, was diesen Werken den
vollen, kräftigen Geschmack verleiht, daß eben
die ganze Welt der Farbe in jedem einzelnen
Ton schlummert und durchgefühlt wird, genau
wie uns der Dichter in der kleinen Blume die
ganze Natur anschauen und durchfühlen lassen
kann. Das „Malerische" in der Vollendung,
die es bei Rembrandt erreicht hat, bedeutet
geradezu koloristischen Monismus oder kolo-
ristischen Pantheismus. Man kann auch an
Leibi denken, der mit Werken begann, die
nach Holbeins Weise die einzelnen Farben-
komplexe, in einer meisterhaften Malerei ge-
geben, sauber und genau auseinander hielten.
Von hier aus vollzog sich Schritt für Schritt
eine Auflockerung, der Pinselführung sowohl
wie der koloristischen Deutung, und aus sei-
nen letzten Jahren gibt es Werke, die schwer-
mütig sind vom Prunk der Farbe, sommerlich
reich und schwermütig vor lauter Reife und
Fülle. Wie Rembrandt versteht er es da, in
jedem Ton, fast in jede Fläche seiner wohl
modellierten Gesichter, die ganze Welt der
Farbe hineinzugeheimnissen. Das ist die Art,
wie der Maler sein Weltgefühl ausdrückt.
Schon hier ist angedeutet worden, was als
letzter Punkt erörtert werden soll, daß das
„Malerische" nur zu einem Teile aus herz-
lichem Anschauen der Natur stammt. Es ent-
hält noch einen zweiten Bestandteil: die freie
Selbstdarstellung des Elementes Farbe. Das
will sagen: Das Malerische ist nicht nur die
reiche Ausdeutung des Natureindruckes, also
etwas Heteronomes, sondern es ist auch das
ungehinderte, üppige Ausleben der Farbe, also
etwas völlig Autonomes. Die Darstellungs-
mittel sind eben nicht nur knechtische Diener
des Ausdruckstrebens, sondern sie sind Or-
Il6
Professor emil orlik- herlin. Radierung zu »Michael Kramer« von (ierhart Hauptmann.
Poeten von Weltgefühl gemeinsam die Viel-
deutigkeit dessen, was er ausspricht; er hat
mit ihm gemeinsam die Überwindung des Buch-
stäblichen. Für ihn ist es die Ursünde, gerade-
zu „Rot" oder „Blau" zu sagen. Sein Aus-
druck hat Neben- und Untertöne, hat Vieldeu-
tigkeit und hat letzten Endes infolge dieser
Vieldeutigkeit die Neutralität der Naturdinge.
Jeder, der einen maßgebenden Begriff von dei
Malerei Rembrandts hat, wird es verstehen
wenn ich sage, daß man bei diesem Künstler
kaum mehr wagt, irgend einen Lokalton mit
einem nackten Adjektivum zu benennen. Es
gibt wohl Übergänge von Gelb zu Rot, von
Braun zu Blau, aber in jeder dieser Farben
scheint die ganze Palette hineingeheimnißt zu
sein. Das ist es, was diesen Werken den
vollen, kräftigen Geschmack verleiht, daß eben
die ganze Welt der Farbe in jedem einzelnen
Ton schlummert und durchgefühlt wird, genau
wie uns der Dichter in der kleinen Blume die
ganze Natur anschauen und durchfühlen lassen
kann. Das „Malerische" in der Vollendung,
die es bei Rembrandt erreicht hat, bedeutet
geradezu koloristischen Monismus oder kolo-
ristischen Pantheismus. Man kann auch an
Leibi denken, der mit Werken begann, die
nach Holbeins Weise die einzelnen Farben-
komplexe, in einer meisterhaften Malerei ge-
geben, sauber und genau auseinander hielten.
Von hier aus vollzog sich Schritt für Schritt
eine Auflockerung, der Pinselführung sowohl
wie der koloristischen Deutung, und aus sei-
nen letzten Jahren gibt es Werke, die schwer-
mütig sind vom Prunk der Farbe, sommerlich
reich und schwermütig vor lauter Reife und
Fülle. Wie Rembrandt versteht er es da, in
jedem Ton, fast in jede Fläche seiner wohl
modellierten Gesichter, die ganze Welt der
Farbe hineinzugeheimnissen. Das ist die Art,
wie der Maler sein Weltgefühl ausdrückt.
Schon hier ist angedeutet worden, was als
letzter Punkt erörtert werden soll, daß das
„Malerische" nur zu einem Teile aus herz-
lichem Anschauen der Natur stammt. Es ent-
hält noch einen zweiten Bestandteil: die freie
Selbstdarstellung des Elementes Farbe. Das
will sagen: Das Malerische ist nicht nur die
reiche Ausdeutung des Natureindruckes, also
etwas Heteronomes, sondern es ist auch das
ungehinderte, üppige Ausleben der Farbe, also
etwas völlig Autonomes. Die Darstellungs-
mittel sind eben nicht nur knechtische Diener
des Ausdruckstrebens, sondern sie sind Or-
Il6