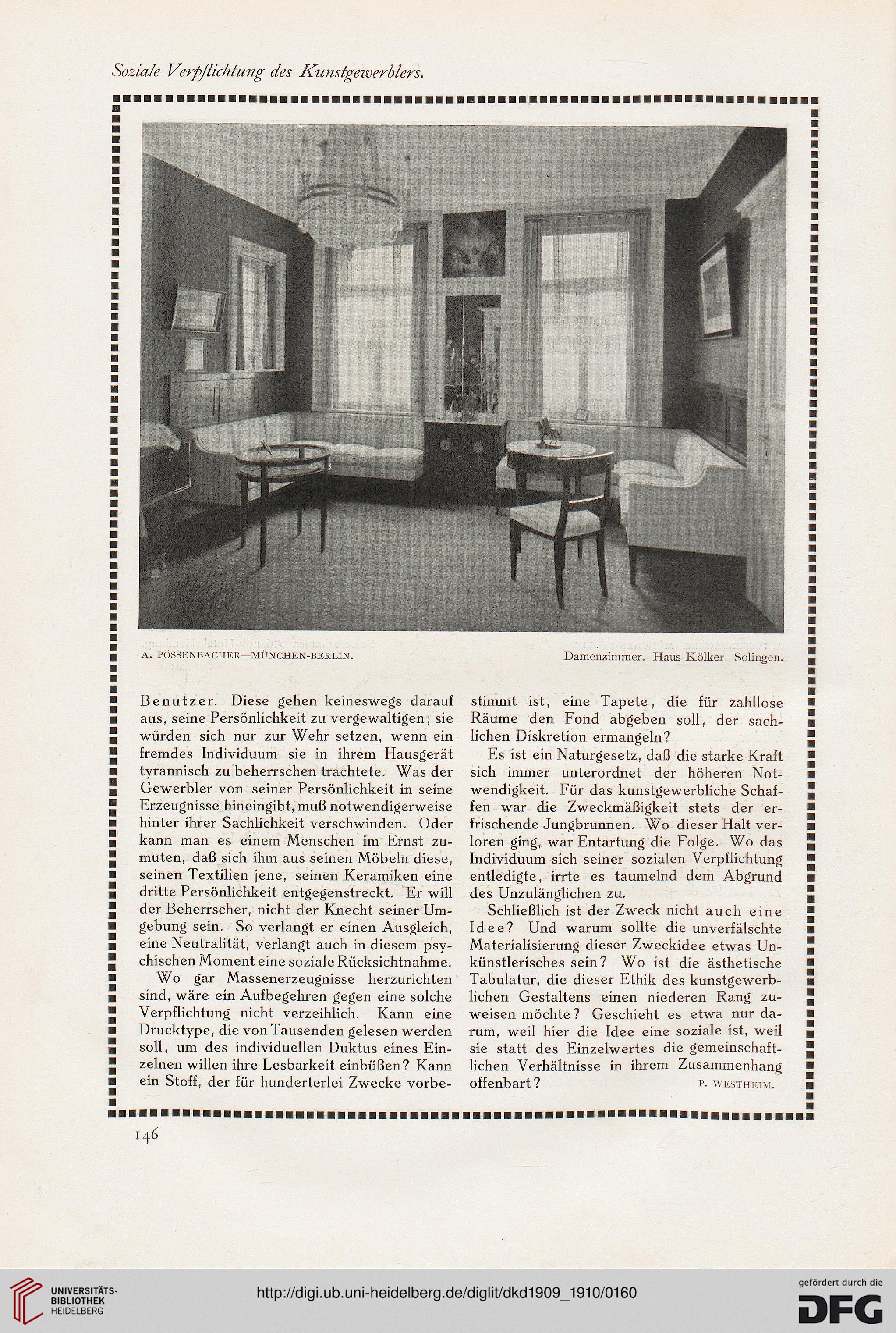Soziale Verpfliclitu)ig des Kunstgewerblers.
A. IN ISSENIiACHEK M U XCJIKN-KKK I.I N.
Damenzimmer. I laus Kölker Solingen.
Benutzer. Diese gehen keineswegs darauf
aus, seine Persönlichkeit zu vergewaltigen; sie
würden sich nur zur Wehr setzen, wenn ein
fremdes Individuum sie in ihrem Hausgerät
tyrannisch zu beherrschen trachtete. Was der
Gewerbler von seiner Persönlichkeit in seine
Erzeugnisse hineingibt, muß notwendigerweise
hinter ihrer Sachlichkeit verschwinden. Oder
kann man es einem Menschen im Ernst zu-
muten, daß sich ihm aus seinen Möbeln diese,
seinen Textilien jene, seinen Keramiken eine
dritte Persönlichkeit entgegenstreckt. Er will
der Beherrscher, nicht der Knecht seiner Um-
gebung sein. So verlangt er einen Ausgleich,
eine Neutralität, verlangt auch in diesem psy-
chischen Moment eine soziale Rücksichtnahme.
Wo gar Massenerzeugnisse herzurichten
sind, wäre ein Aufbegehren gegen eine solche
Verpflichtung nicht verzeihlich. Kann eine
Drucktype, die von Tausenden gelesen werden
soll, um des individuellen Duktus eines Ein-
zelnen willen ihre Lesbarkeit einbüßen? Kann
ein Stoff, der für hunderterlei Zwecke vorbe-
stimmt ist, eine Tapete, die für zahllose
Räume den Fond abgeben soll, der sach-
lichen Diskretion ermangeln?
Es ist ein Naturgesetz, daß die starke Kraft
sich immer unterordnet der höheren Not-
wendigkeit. Für das kunstgewerbliche Schaf-
fen war die Zweckmäßigkeit stets der er-
frischende Jungbrunnen. Wo dieser Halt ver-
loren ging, war Entartung die Folge. Wo das
Individuum sich seiner sozialen Verpflichtung
entledigte, irrte es taumelnd dem Abgrund
des Unzulänglichen zu.
Schließlich ist der Zweck nicht auch eine
Idee? Und warum sollte die unverfälschte
Materialisierung dieser Zweckidee etwas Un-
künstlerisches sein? Wo ist die ästhetische
Tabulatur, die dieser Ethik des kunstgewerb-
lichen Gestaltens einen niederen Rang zu-
weisen möchte? Geschieht es etwa nur da-
rum, weil hier die Idee eine soziale ist, weil
sie statt des Einzelwertes die gemeinschaft-
lichen Verhältnisse in ihrem Zusammenhang
offenbart? ''• westheim.
146
A. IN ISSENIiACHEK M U XCJIKN-KKK I.I N.
Damenzimmer. I laus Kölker Solingen.
Benutzer. Diese gehen keineswegs darauf
aus, seine Persönlichkeit zu vergewaltigen; sie
würden sich nur zur Wehr setzen, wenn ein
fremdes Individuum sie in ihrem Hausgerät
tyrannisch zu beherrschen trachtete. Was der
Gewerbler von seiner Persönlichkeit in seine
Erzeugnisse hineingibt, muß notwendigerweise
hinter ihrer Sachlichkeit verschwinden. Oder
kann man es einem Menschen im Ernst zu-
muten, daß sich ihm aus seinen Möbeln diese,
seinen Textilien jene, seinen Keramiken eine
dritte Persönlichkeit entgegenstreckt. Er will
der Beherrscher, nicht der Knecht seiner Um-
gebung sein. So verlangt er einen Ausgleich,
eine Neutralität, verlangt auch in diesem psy-
chischen Moment eine soziale Rücksichtnahme.
Wo gar Massenerzeugnisse herzurichten
sind, wäre ein Aufbegehren gegen eine solche
Verpflichtung nicht verzeihlich. Kann eine
Drucktype, die von Tausenden gelesen werden
soll, um des individuellen Duktus eines Ein-
zelnen willen ihre Lesbarkeit einbüßen? Kann
ein Stoff, der für hunderterlei Zwecke vorbe-
stimmt ist, eine Tapete, die für zahllose
Räume den Fond abgeben soll, der sach-
lichen Diskretion ermangeln?
Es ist ein Naturgesetz, daß die starke Kraft
sich immer unterordnet der höheren Not-
wendigkeit. Für das kunstgewerbliche Schaf-
fen war die Zweckmäßigkeit stets der er-
frischende Jungbrunnen. Wo dieser Halt ver-
loren ging, war Entartung die Folge. Wo das
Individuum sich seiner sozialen Verpflichtung
entledigte, irrte es taumelnd dem Abgrund
des Unzulänglichen zu.
Schließlich ist der Zweck nicht auch eine
Idee? Und warum sollte die unverfälschte
Materialisierung dieser Zweckidee etwas Un-
künstlerisches sein? Wo ist die ästhetische
Tabulatur, die dieser Ethik des kunstgewerb-
lichen Gestaltens einen niederen Rang zu-
weisen möchte? Geschieht es etwa nur da-
rum, weil hier die Idee eine soziale ist, weil
sie statt des Einzelwertes die gemeinschaft-
lichen Verhältnisse in ihrem Zusammenhang
offenbart? ''• westheim.
146