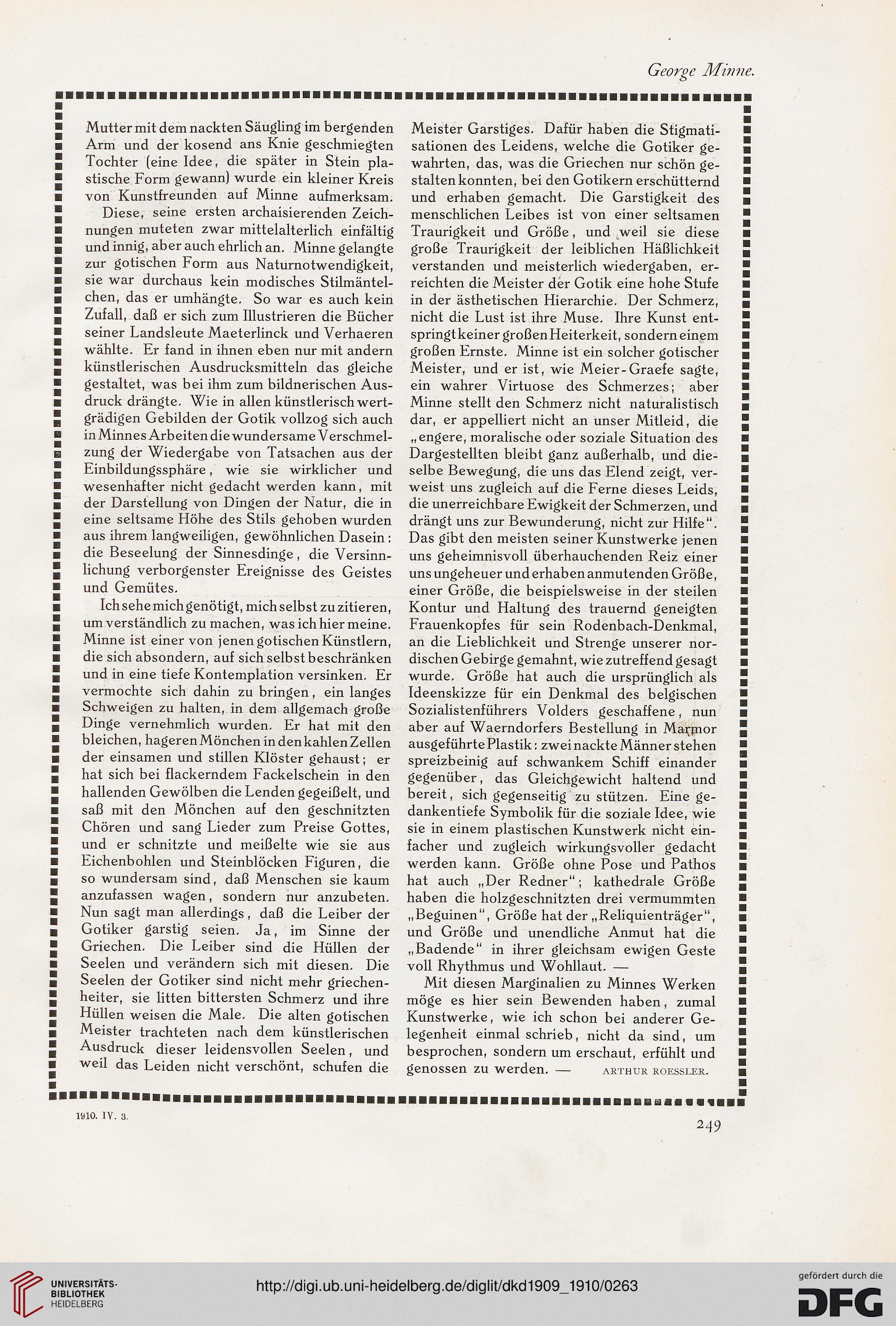George Mimie.
Mutter mit dem nackten Säugling im bergenden
Arm und der kosend ans Knie geschmiegten
Tochter (eine Idee, die später in Stein pla-
stische Form gewann) wurde ein kleiner Kreis
von Kunstfreunden auf Minne aufmerksam.
Diese, seine ersten archaisierenden Zeich-
nungen muteten zwar mittelalterlich einfältig
und innig, aber auch ehrlich an. Minne gelangte
zur gotischen Form aus Naturnotwendigkeit,
sie war durchaus kein modisches Stilmäntel-
chen, das er umhängte. So war es auch kein
Zufall, daß er sich zum Illustrieren die Bücher
seiner Landsleute Maeterlinck und Verhaeren
wählte. Er fand in ihnen eben nur mit andern
künstlerischen Ausdrucksmitteln das gleiche
gestaltet, was bei ihm zum bildnerischen Aus-
druck drängte. Wie in allen künstlerisch wert-
grädigen Gebilden der Gotik vollzog sich auch
in Minnes Arbeiten die wundersame Verschmel-
zung der Wiedergabe von Tatsachen aus der
Einbildungssphäre, wie sie wirklicher und
wesenhafter nicht gedacht werden kann, mit
der Darstellung von Dingen der Natur, die in
eine seltsame Höhe des Stils gehoben wurden
aus ihrem langweiligen, gewöhnlichen Dasein :
die Beseelung der Sinnesdinge , die Versinn-
lichung verborgenster Ereignisse des Geistes
und Gemütes.
Ich sehe mich genötigt, mich selbst zu zitieren,
um verständlich zumachen, was ich hier meine.
Minne ist einer von jenen gotischen Künstlern,
die sich absondern, auf sich selbst beschränken
und in eine tiefe Kontemplation versinken. Er
vermochte sich dahin zu bringen , ein langes
Schweigen zu halten, in dem allgemach große
Dinge vernehmlich wurden. Er hat mit den
bleichen, hageren Mönchen in den kahlen Zellen
der einsamen und stillen Klöster gehaust; er
hat sich bei flackerndem Fackelschein in den
hallenden Gewölben die Lenden gegeißelt, und
saß mit den Mönchen auf den geschnitzten
Chören und sang Lieder zum Preise Gottes,
und er schnitzte und meißelte wie sie aus
Eichenbohlen und Steinblöcken Figuren, die
so wundersam sind, daß Menschen sie kaum
anzufassen wagen, sondern nur anzubeten.
Nun sagt man allerdings, daß die Leiber der
Gotiker garstig seien. Ja, im Sinne der
Griechen. Die Leiber sind die Hüllen der
Seelen und verändern sich mit diesen. Die
Seelen der Gotiker sind nicht mehr griechen-
heiter, sie litten bittersten Schmerz und ihre
Hüllen weisen die Male. Die alten gotischen
Meister trachteten nach dem künstlerischen
Ausdruck dieser leidensvollen Seelen, und
weil das Leiden nicht verschönt, schufen die
Meister Garstiges. Dafür haben die Stigmati-
sationen des Leidens, welche die Gotiker ge-
wahrten, das, was die Griechen nur schön ge-
staltenkonnten, bei den Gotikern erschütternd
und erhaben gemacht. Die Garstigkeit des
menschlichen Leibes ist von einer seltsamen
Traurigkeit und Größe, und weil sie diese
große Traurigkeit der leiblichen Häßlichkeit
verstanden und meisterlich wiedergaben, er-
reichten die Meister der Gotik eine hohe Stufe
in der ästhetischen Hierarchie. Der Schmerz,
nicht die Lust ist ihre Muse. Ihre Kunst ent-
springt keiner großen Heiterkeit, sondern einem
großen Ernste. Minne ist ein solcher gotischer
Meister, und er ist, wie Meier-Graefe sagte,
ein wahrer Virtuose des Schmerzes; aber
Minne stellt den Schmerz nicht naturalistisch
dar, er appelliert nicht an unser Mitleid, die
„engere, moralische oder soziale Situation des
Dargestellten bleibt ganz außerhalb, und die-
selbe Bewegung, die uns das Elend zeigt, ver-
weist uns zugleich auf die Ferne dieses Leids,
die unerreichbare Ewigkeit der Schmerzen, und
drängt uns zur Bewunderung, nicht zur Hilfe".
Das gibt den meisten seiner Kunstwerke jenen
uns geheimnisvoll überhauchenden Reiz einer
uns ungeheuer und erhaben anmutenden Größe,
einer Größe, die beispielsweise in der steilen
Kontur und Haltung des trauernd geneigten
Frauenkopfes für sein Rodenbach-Denkmal,
an die Lieblichkeit und Strenge unserer nor-
dischen Gebirge gemahnt, wie zutreffend gesagt
wurde. Größe hat auch die ursprünglich als
Ideenskizze für ein Denkmal des belgischen
Sozialistenführers Volders geschaffene, nun
aber auf Waerndorfers Bestellung in Marpior
ausgeführte Plastik: zwei nackte Männer stehen
spreizbeinig auf schwankem Schiff einander
gegenüber, das Gleichgewicht haltend und
bereit, sich gegenseitig zu stützen. Eine ge-
dankentiefe Symbolik für die soziale Idee, wie
sie in einem plastischen Kunstwerk nicht ein-
facher und zugleich wirkungsvoller gedacht
werden kann. Größe ohne Pose und Pathos
hat auch „Der Redner"; kathedrale Größe
haben die holzgeschnitzten drei vermummten
„Beguinen", Größe hat der „Reliquienträger",
und Größe und unendliche Anmut hat die
„Badende" in ihrer gleichsam ewigen Geste
voll Rhythmus und Wohllaut. —
Mit diesen Marginalien zu Minnes Werken
möge es hier sein Bewenden haben, zumal
Kunstwerke, wie ich schon bei anderer Ge-
legenheit einmal schrieb, nicht da sind, um
besprochen, sondern um erschaut, erfühlt und
genossen zu werden. — arthur roessler.
mo. iv. 3.
249
Mutter mit dem nackten Säugling im bergenden
Arm und der kosend ans Knie geschmiegten
Tochter (eine Idee, die später in Stein pla-
stische Form gewann) wurde ein kleiner Kreis
von Kunstfreunden auf Minne aufmerksam.
Diese, seine ersten archaisierenden Zeich-
nungen muteten zwar mittelalterlich einfältig
und innig, aber auch ehrlich an. Minne gelangte
zur gotischen Form aus Naturnotwendigkeit,
sie war durchaus kein modisches Stilmäntel-
chen, das er umhängte. So war es auch kein
Zufall, daß er sich zum Illustrieren die Bücher
seiner Landsleute Maeterlinck und Verhaeren
wählte. Er fand in ihnen eben nur mit andern
künstlerischen Ausdrucksmitteln das gleiche
gestaltet, was bei ihm zum bildnerischen Aus-
druck drängte. Wie in allen künstlerisch wert-
grädigen Gebilden der Gotik vollzog sich auch
in Minnes Arbeiten die wundersame Verschmel-
zung der Wiedergabe von Tatsachen aus der
Einbildungssphäre, wie sie wirklicher und
wesenhafter nicht gedacht werden kann, mit
der Darstellung von Dingen der Natur, die in
eine seltsame Höhe des Stils gehoben wurden
aus ihrem langweiligen, gewöhnlichen Dasein :
die Beseelung der Sinnesdinge , die Versinn-
lichung verborgenster Ereignisse des Geistes
und Gemütes.
Ich sehe mich genötigt, mich selbst zu zitieren,
um verständlich zumachen, was ich hier meine.
Minne ist einer von jenen gotischen Künstlern,
die sich absondern, auf sich selbst beschränken
und in eine tiefe Kontemplation versinken. Er
vermochte sich dahin zu bringen , ein langes
Schweigen zu halten, in dem allgemach große
Dinge vernehmlich wurden. Er hat mit den
bleichen, hageren Mönchen in den kahlen Zellen
der einsamen und stillen Klöster gehaust; er
hat sich bei flackerndem Fackelschein in den
hallenden Gewölben die Lenden gegeißelt, und
saß mit den Mönchen auf den geschnitzten
Chören und sang Lieder zum Preise Gottes,
und er schnitzte und meißelte wie sie aus
Eichenbohlen und Steinblöcken Figuren, die
so wundersam sind, daß Menschen sie kaum
anzufassen wagen, sondern nur anzubeten.
Nun sagt man allerdings, daß die Leiber der
Gotiker garstig seien. Ja, im Sinne der
Griechen. Die Leiber sind die Hüllen der
Seelen und verändern sich mit diesen. Die
Seelen der Gotiker sind nicht mehr griechen-
heiter, sie litten bittersten Schmerz und ihre
Hüllen weisen die Male. Die alten gotischen
Meister trachteten nach dem künstlerischen
Ausdruck dieser leidensvollen Seelen, und
weil das Leiden nicht verschönt, schufen die
Meister Garstiges. Dafür haben die Stigmati-
sationen des Leidens, welche die Gotiker ge-
wahrten, das, was die Griechen nur schön ge-
staltenkonnten, bei den Gotikern erschütternd
und erhaben gemacht. Die Garstigkeit des
menschlichen Leibes ist von einer seltsamen
Traurigkeit und Größe, und weil sie diese
große Traurigkeit der leiblichen Häßlichkeit
verstanden und meisterlich wiedergaben, er-
reichten die Meister der Gotik eine hohe Stufe
in der ästhetischen Hierarchie. Der Schmerz,
nicht die Lust ist ihre Muse. Ihre Kunst ent-
springt keiner großen Heiterkeit, sondern einem
großen Ernste. Minne ist ein solcher gotischer
Meister, und er ist, wie Meier-Graefe sagte,
ein wahrer Virtuose des Schmerzes; aber
Minne stellt den Schmerz nicht naturalistisch
dar, er appelliert nicht an unser Mitleid, die
„engere, moralische oder soziale Situation des
Dargestellten bleibt ganz außerhalb, und die-
selbe Bewegung, die uns das Elend zeigt, ver-
weist uns zugleich auf die Ferne dieses Leids,
die unerreichbare Ewigkeit der Schmerzen, und
drängt uns zur Bewunderung, nicht zur Hilfe".
Das gibt den meisten seiner Kunstwerke jenen
uns geheimnisvoll überhauchenden Reiz einer
uns ungeheuer und erhaben anmutenden Größe,
einer Größe, die beispielsweise in der steilen
Kontur und Haltung des trauernd geneigten
Frauenkopfes für sein Rodenbach-Denkmal,
an die Lieblichkeit und Strenge unserer nor-
dischen Gebirge gemahnt, wie zutreffend gesagt
wurde. Größe hat auch die ursprünglich als
Ideenskizze für ein Denkmal des belgischen
Sozialistenführers Volders geschaffene, nun
aber auf Waerndorfers Bestellung in Marpior
ausgeführte Plastik: zwei nackte Männer stehen
spreizbeinig auf schwankem Schiff einander
gegenüber, das Gleichgewicht haltend und
bereit, sich gegenseitig zu stützen. Eine ge-
dankentiefe Symbolik für die soziale Idee, wie
sie in einem plastischen Kunstwerk nicht ein-
facher und zugleich wirkungsvoller gedacht
werden kann. Größe ohne Pose und Pathos
hat auch „Der Redner"; kathedrale Größe
haben die holzgeschnitzten drei vermummten
„Beguinen", Größe hat der „Reliquienträger",
und Größe und unendliche Anmut hat die
„Badende" in ihrer gleichsam ewigen Geste
voll Rhythmus und Wohllaut. —
Mit diesen Marginalien zu Minnes Werken
möge es hier sein Bewenden haben, zumal
Kunstwerke, wie ich schon bei anderer Ge-
legenheit einmal schrieb, nicht da sind, um
besprochen, sondern um erschaut, erfühlt und
genossen zu werden. — arthur roessler.
mo. iv. 3.
249