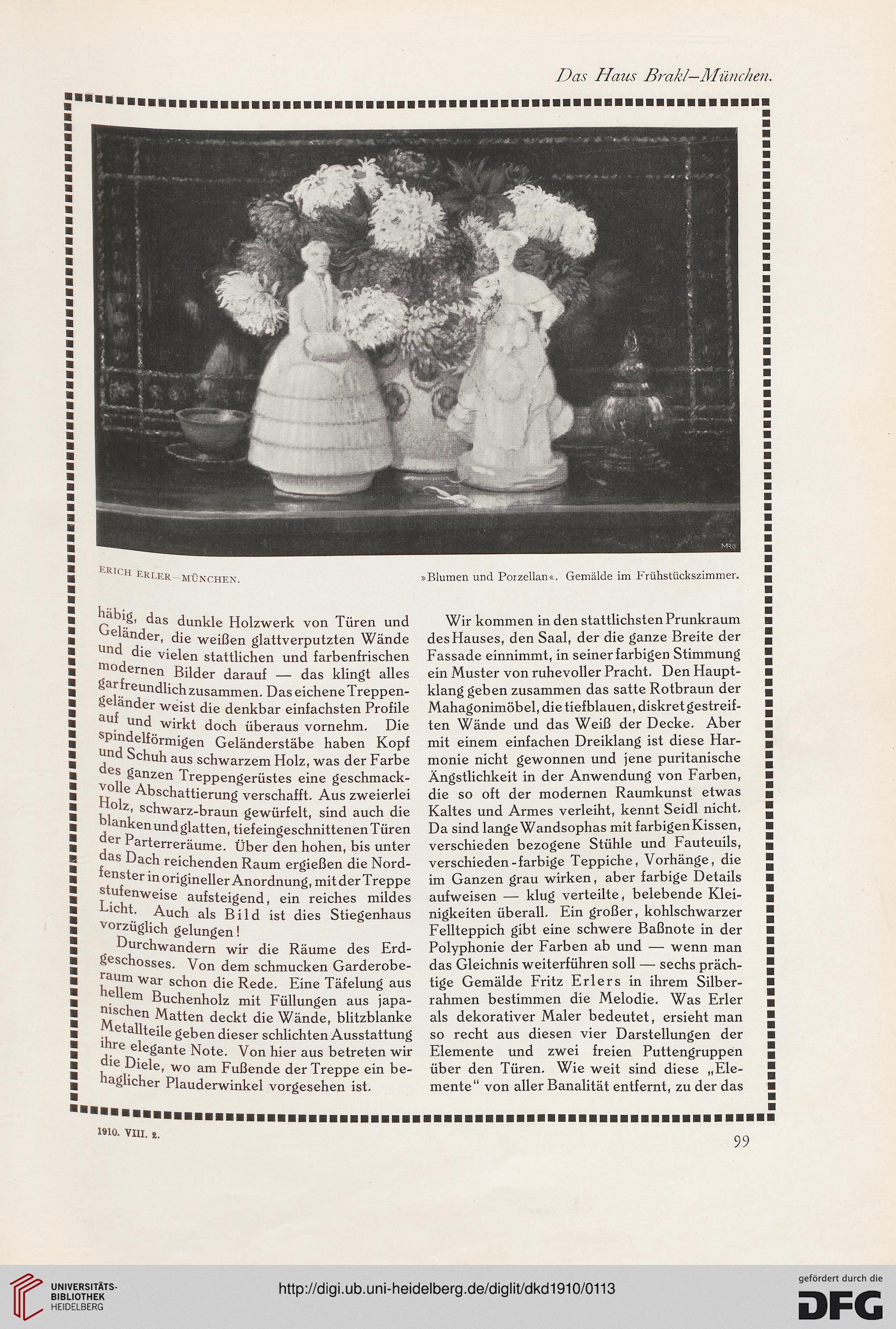Das Haus Braki—München.
ER,CH ER,.ER
MÜNCHEN.
»Blumen und Porzellan«. Gemälde im Frühstückszimmer.
habig, das dunkle Holzwerk von Türen und
Geländer, die weißen glattverputzten Wände
und die vielen stattlichen und farbenfrischen
modernen Bilder darauf — das klingt alles
gar freundlich
zusammen. Das eichene Treppen-
geländer weist die denkbar einfachsten Profile
auf und wirkt doch überaus vornehm. Die
spindelförmigen Geländerstäbe haben Kopf
und Schuh aus schwarzem Holz, was der Farbe
des ganzen Treppengerüstes eine geschmack-
volle Abschattierung verschafft. Aus zweierlei
H°lz, schwarz-braun gewürfelt, sind auch die
blanken und glatten, tiefeingeschnittenen Türen
der Parterreräume. Über den hohen, bis unter
das Dach reichenden Raum ergießen die Nord-
fenster in origineller Anordnung, mit der Treppe
stufenweise aufsteigend, ein reiches mildes
Licht. Auch als Bild ist dies Stiegenhaus
vorzüglich gelungen!
Durchwandern wir die Räume des Erd-
geschosses. Von dem schmucken Garderobe-
raum war schon die Rede. Eine Täfelung aus
hellem Buchenholz mit Füllungen aus japa-
nischen Matten deckt die Wände, blitzblanke
Metallteile geben dieser schlichten Ausstattung
ihre elegante Note. Von hier aus betreten wir
die Diele, wo am Fußende der Treppe ein be-
haglicher Plauderwinkel vorgesehen ist.
Wir kommen in den stattlichsten Prunkraum
des Hauses, den Saal, der die ganze Breite der
Fassade einnimmt, in seiner farbigen Stimmung
ein Muster von ruhevoller Pracht. Den Haupt-
klang geben zusammen das satte Rotbraun der
Mahagonimöbel, die tiefblauen, diskret gestreif-
ten Wände und das Weiß der Decke. Aber
mit einem einfachen Dreiklang ist diese Har-
monie nicht gewonnen und jene puritanische
Ängstlichkeit in der Anwendung von Farben,
die so oft der modernen Raumkunst etwas
Kaltes und Armes verleiht, kennt Seidl nicht.
Da sind lange Wandsophas mit farbigenKissen,
verschieden bezogene Stühle und Fauteuils,
verschieden-farbige Teppiche, Vorhänge, die
im Ganzen grau wirken, aber farbige Details
aufweisen — klug verteilte, belebende Klei-
nigkeiten überall. Ein großer, kohlschwarzer
Fellteppich gibt eine schwere Baßnote in der
Polyphonie der Farben ab und — wenn man
das Gleichnis weiterführen soll — sechs präch-
tige Gemälde Fritz Erlers in ihrem Silber-
rahmen bestimmen die Melodie. Was Erler
als dekorativer Maler bedeutet, ersieht man
so recht aus diesen vier Darstellungen der
Elemente und zwei freien Puttengruppen
über den Türen. Wie weit sind diese „Ele-
mente" von aller Banalität entfernt, zu der das
i»io. VIII. t.
99
ER,CH ER,.ER
MÜNCHEN.
»Blumen und Porzellan«. Gemälde im Frühstückszimmer.
habig, das dunkle Holzwerk von Türen und
Geländer, die weißen glattverputzten Wände
und die vielen stattlichen und farbenfrischen
modernen Bilder darauf — das klingt alles
gar freundlich
zusammen. Das eichene Treppen-
geländer weist die denkbar einfachsten Profile
auf und wirkt doch überaus vornehm. Die
spindelförmigen Geländerstäbe haben Kopf
und Schuh aus schwarzem Holz, was der Farbe
des ganzen Treppengerüstes eine geschmack-
volle Abschattierung verschafft. Aus zweierlei
H°lz, schwarz-braun gewürfelt, sind auch die
blanken und glatten, tiefeingeschnittenen Türen
der Parterreräume. Über den hohen, bis unter
das Dach reichenden Raum ergießen die Nord-
fenster in origineller Anordnung, mit der Treppe
stufenweise aufsteigend, ein reiches mildes
Licht. Auch als Bild ist dies Stiegenhaus
vorzüglich gelungen!
Durchwandern wir die Räume des Erd-
geschosses. Von dem schmucken Garderobe-
raum war schon die Rede. Eine Täfelung aus
hellem Buchenholz mit Füllungen aus japa-
nischen Matten deckt die Wände, blitzblanke
Metallteile geben dieser schlichten Ausstattung
ihre elegante Note. Von hier aus betreten wir
die Diele, wo am Fußende der Treppe ein be-
haglicher Plauderwinkel vorgesehen ist.
Wir kommen in den stattlichsten Prunkraum
des Hauses, den Saal, der die ganze Breite der
Fassade einnimmt, in seiner farbigen Stimmung
ein Muster von ruhevoller Pracht. Den Haupt-
klang geben zusammen das satte Rotbraun der
Mahagonimöbel, die tiefblauen, diskret gestreif-
ten Wände und das Weiß der Decke. Aber
mit einem einfachen Dreiklang ist diese Har-
monie nicht gewonnen und jene puritanische
Ängstlichkeit in der Anwendung von Farben,
die so oft der modernen Raumkunst etwas
Kaltes und Armes verleiht, kennt Seidl nicht.
Da sind lange Wandsophas mit farbigenKissen,
verschieden bezogene Stühle und Fauteuils,
verschieden-farbige Teppiche, Vorhänge, die
im Ganzen grau wirken, aber farbige Details
aufweisen — klug verteilte, belebende Klei-
nigkeiten überall. Ein großer, kohlschwarzer
Fellteppich gibt eine schwere Baßnote in der
Polyphonie der Farben ab und — wenn man
das Gleichnis weiterführen soll — sechs präch-
tige Gemälde Fritz Erlers in ihrem Silber-
rahmen bestimmen die Melodie. Was Erler
als dekorativer Maler bedeutet, ersieht man
so recht aus diesen vier Darstellungen der
Elemente und zwei freien Puttengruppen
über den Türen. Wie weit sind diese „Ele-
mente" von aller Banalität entfernt, zu der das
i»io. VIII. t.
99