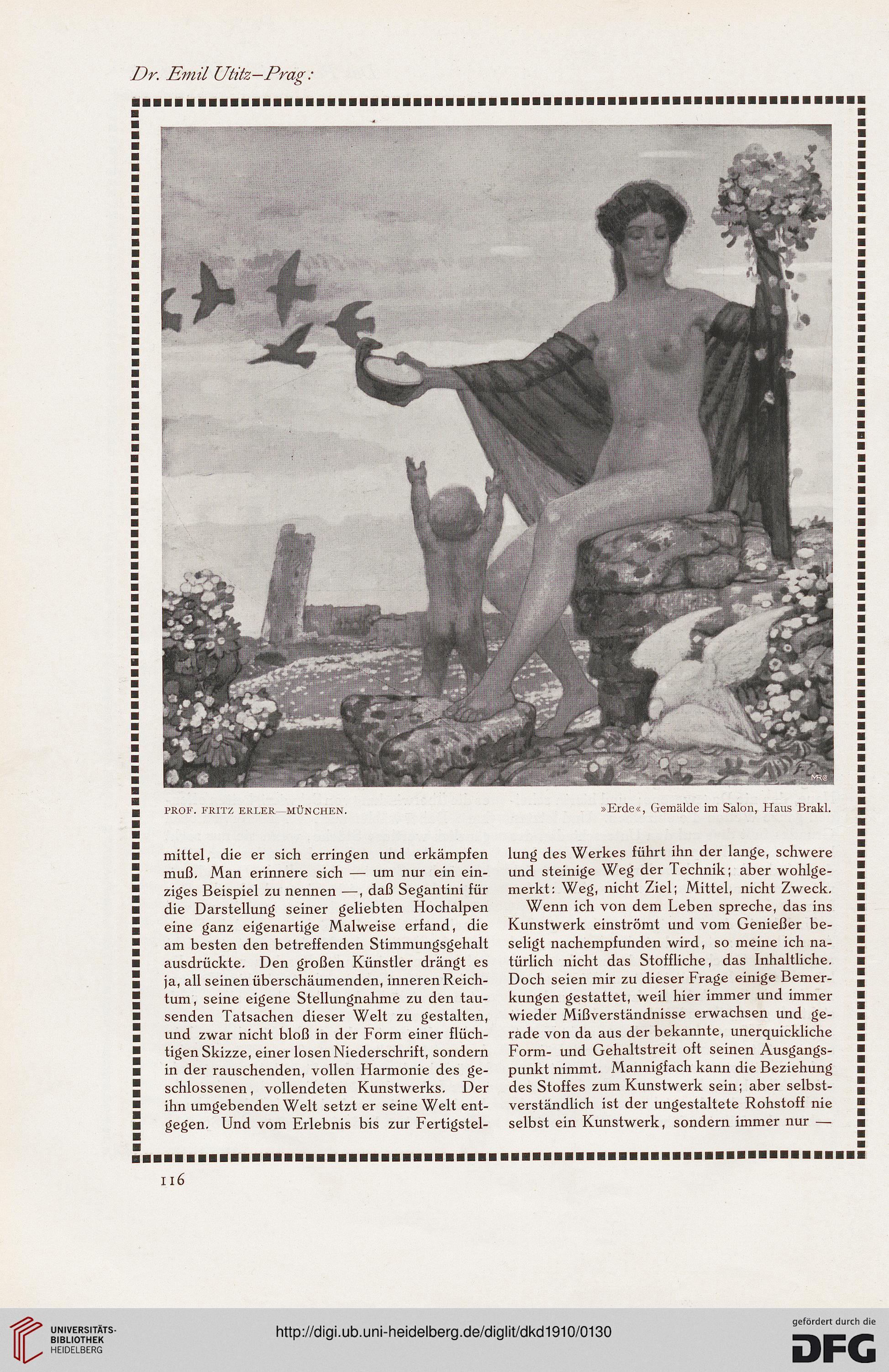Dr. Emil Utitz—Prag:
PROF. FRITZ ERLER-MÜNCHEN.
»Erde«, Gemälde im Salon, Haus Brakl.
mittel, die er sich erringen und erkämpfen
muß. Man erinnere sich — um nur ein ein-
ziges Beispiel zu nennen —, daß Segantini für
die Darstellung seiner geliebten Hochalpen
eine ganz eigenartige Malweise erfand, die
am besten den betreffenden Stimmungsgehalt
ausdrückte. Den großen Künstler drängt es
ja, all seinen überschäumenden, inneren Reich-
tum, seine eigene Stellungnahme zu den tau-
senden Tatsachen dieser Welt zu gestalten,
und zwar nicht bloß in der Form einer flüch-
tigen Skizze, einer losen Niederschrift, sondern
in der rauschenden, vollen Harmonie des ge-
schlossenen , vollendeten Kunstwerks. Der
ihn umgebenden Welt setzt er seine Welt ent-
gegen. Und vom Erlebnis bis zur Fertigstel-
lung des Werkes führt ihn der lange, schwere
und steinige Weg der Technik; aber wohlge-
merkt: Weg, nicht Ziel; Mittel, nicht Zweck.
Wenn ich von dem Leben spreche, das ins
Kunstwerk einströmt und vom Genießer be-
seligt nachempfunden wird, so meine ich na-
türlich nicht das Stoffliche, das Inhaltliche.
Doch seien mir zu dieser Frage einige Bemer-
kungen gestattet, weil hier immer und immer
wieder Mißverständnisse erwachsen und ge-
rade von da aus der bekannte, unerquickliche
Form- und Gehaltstreit oft seinen Ausgangs-
punkt nimmt. Mannigfach kann die Beziehung
des Stoffes zum Kunstwerk sein; aber selbst-
verständlich ist der ungestaltete Rohstoff nie
selbst ein Kunstwerk, sondern immer nur —
116
PROF. FRITZ ERLER-MÜNCHEN.
»Erde«, Gemälde im Salon, Haus Brakl.
mittel, die er sich erringen und erkämpfen
muß. Man erinnere sich — um nur ein ein-
ziges Beispiel zu nennen —, daß Segantini für
die Darstellung seiner geliebten Hochalpen
eine ganz eigenartige Malweise erfand, die
am besten den betreffenden Stimmungsgehalt
ausdrückte. Den großen Künstler drängt es
ja, all seinen überschäumenden, inneren Reich-
tum, seine eigene Stellungnahme zu den tau-
senden Tatsachen dieser Welt zu gestalten,
und zwar nicht bloß in der Form einer flüch-
tigen Skizze, einer losen Niederschrift, sondern
in der rauschenden, vollen Harmonie des ge-
schlossenen , vollendeten Kunstwerks. Der
ihn umgebenden Welt setzt er seine Welt ent-
gegen. Und vom Erlebnis bis zur Fertigstel-
lung des Werkes führt ihn der lange, schwere
und steinige Weg der Technik; aber wohlge-
merkt: Weg, nicht Ziel; Mittel, nicht Zweck.
Wenn ich von dem Leben spreche, das ins
Kunstwerk einströmt und vom Genießer be-
seligt nachempfunden wird, so meine ich na-
türlich nicht das Stoffliche, das Inhaltliche.
Doch seien mir zu dieser Frage einige Bemer-
kungen gestattet, weil hier immer und immer
wieder Mißverständnisse erwachsen und ge-
rade von da aus der bekannte, unerquickliche
Form- und Gehaltstreit oft seinen Ausgangs-
punkt nimmt. Mannigfach kann die Beziehung
des Stoffes zum Kunstwerk sein; aber selbst-
verständlich ist der ungestaltete Rohstoff nie
selbst ein Kunstwerk, sondern immer nur —
116