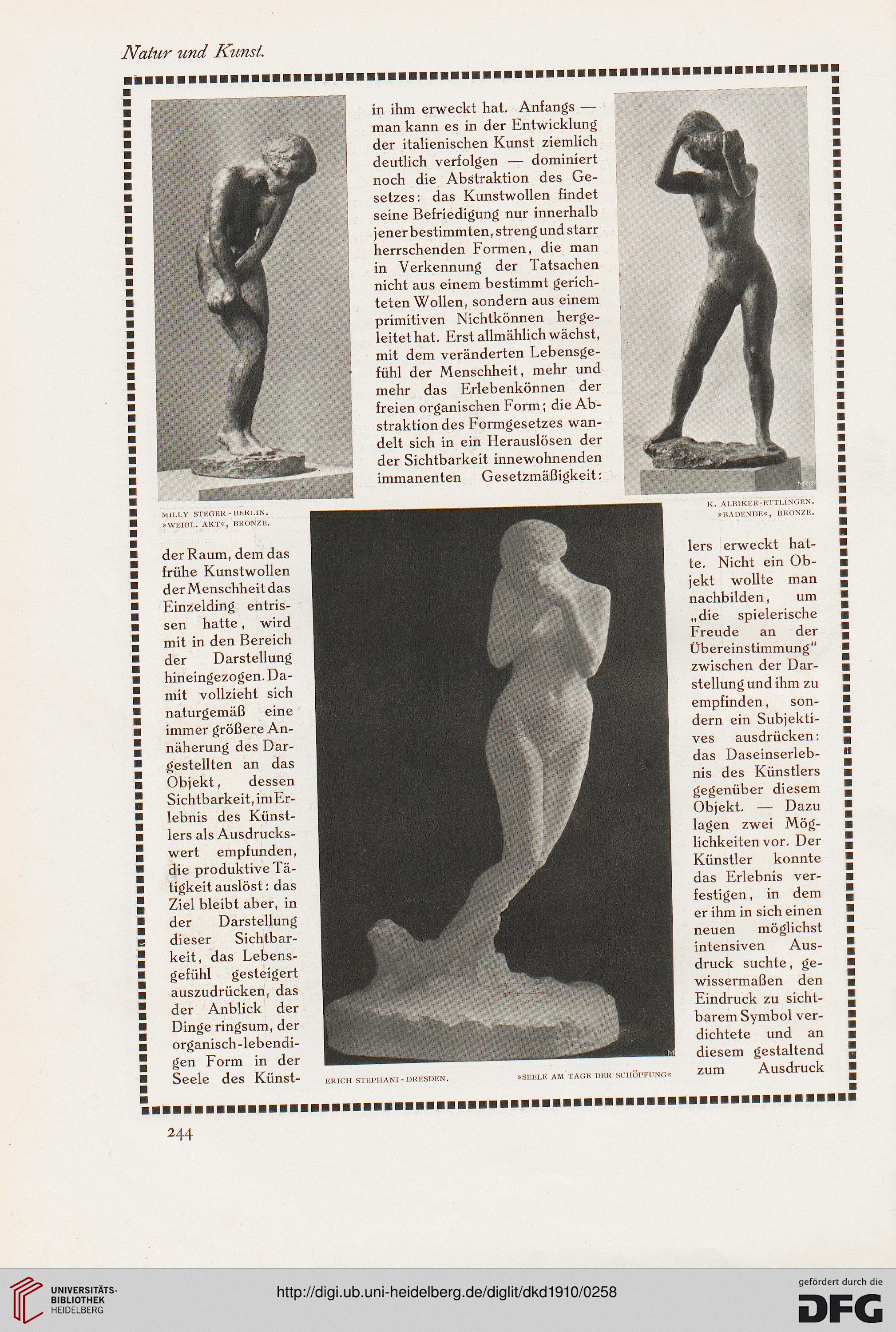Natur und Kunst.
Mll.LY STKGEU - liKKI.IN.
»WF.IBL. AKT«. BRONZE.
der Raum, dem das
frühe Kunstwollen
der Menschheit das
Einzelding entris-
sen hatte, wird
mit in den Bereich
der Darstellung
hineingezogen. Da-
mit vollzieht sich
naturgemäß eine
immer größere An-
näherung des Dar-
gestellten an das
Objekt, dessen
Sichtbarkeit, imEr-
lebnis des Künst-
lers als Ausdrucks-
wert empfunden,
die produktive Tä-
tigkeit auslöst: das
Ziel bleibt aber, in
der Darstellung
dieser Sichtbar-
keit, das Lebens-
gefühl gesteigert
auszudrücken, das
der Anblick der
Dinge ringsum, der
organisch-lebendi-
gen Form in der
Seele des Künst-
in ihm erweckt hat. Anfangs —
man kann es in der Entwicklung
der italienischen Kunst ziemlich
deutlich verfolgen — dominiert
noch die Abstraktion des Ge-
setzes: das Kunstwollen findet
seine Befriedigung nur innerhalb
jenerbestimmten, streng und starr
herrschenden Formen, die man
in Verkennung der Tatsachen
nicht aus einem bestimmt gerich-
teten Wollen, sondern aus einem
primitiven Nichtkönnen herge-
leitet hat. Erst allmählich wächst,
mit dem veränderten Lebensge-
fühl der Menschheit, mehr und
mehr das Erlebenkönnen der
freien organischen Form; die Ab-
straktion des Formgesetzes wan-
delt sich in ein Herauslösen der
der Sichtbarkeit innewohnenden
immanenten Gesetzmäßigkeit:
ER [< II s I BPHANI- DRESDEN.
»SEELE AM TAGE DER Sl HUPFIINO«
. ALBIKBR7E7TLINGBN.
»BADENDE«, BRONZE.
lers erweckt hat-
te. Nicht ein Ob-
jekt wollte man
nachbilden, um
„die spielerische
Freude an der
Übereinstimmung"
zwischen der Dar-
stellung und ihm zu
empfinden, son-
dern ein Subjekti-
ves ausdrücken:
das Daseinserleb-
nis des Künstlers
gegenüber diesem
Objekt. — Dazu
lagen zwei Mög-
lichkeiten vor. Der
Künstler konnte
das Erlebnis ver-
festigen , in dem
er ihm in sich einen
neuen möglichst
intensiven Aus-
druck suchte, ge-
wissermaßen den
Eindruck zu sicht-
barem Symbol ver-
dichtete und an
diesem gestaltend
zum Ausdruck
244
Mll.LY STKGEU - liKKI.IN.
»WF.IBL. AKT«. BRONZE.
der Raum, dem das
frühe Kunstwollen
der Menschheit das
Einzelding entris-
sen hatte, wird
mit in den Bereich
der Darstellung
hineingezogen. Da-
mit vollzieht sich
naturgemäß eine
immer größere An-
näherung des Dar-
gestellten an das
Objekt, dessen
Sichtbarkeit, imEr-
lebnis des Künst-
lers als Ausdrucks-
wert empfunden,
die produktive Tä-
tigkeit auslöst: das
Ziel bleibt aber, in
der Darstellung
dieser Sichtbar-
keit, das Lebens-
gefühl gesteigert
auszudrücken, das
der Anblick der
Dinge ringsum, der
organisch-lebendi-
gen Form in der
Seele des Künst-
in ihm erweckt hat. Anfangs —
man kann es in der Entwicklung
der italienischen Kunst ziemlich
deutlich verfolgen — dominiert
noch die Abstraktion des Ge-
setzes: das Kunstwollen findet
seine Befriedigung nur innerhalb
jenerbestimmten, streng und starr
herrschenden Formen, die man
in Verkennung der Tatsachen
nicht aus einem bestimmt gerich-
teten Wollen, sondern aus einem
primitiven Nichtkönnen herge-
leitet hat. Erst allmählich wächst,
mit dem veränderten Lebensge-
fühl der Menschheit, mehr und
mehr das Erlebenkönnen der
freien organischen Form; die Ab-
straktion des Formgesetzes wan-
delt sich in ein Herauslösen der
der Sichtbarkeit innewohnenden
immanenten Gesetzmäßigkeit:
ER [< II s I BPHANI- DRESDEN.
»SEELE AM TAGE DER Sl HUPFIINO«
. ALBIKBR7E7TLINGBN.
»BADENDE«, BRONZE.
lers erweckt hat-
te. Nicht ein Ob-
jekt wollte man
nachbilden, um
„die spielerische
Freude an der
Übereinstimmung"
zwischen der Dar-
stellung und ihm zu
empfinden, son-
dern ein Subjekti-
ves ausdrücken:
das Daseinserleb-
nis des Künstlers
gegenüber diesem
Objekt. — Dazu
lagen zwei Mög-
lichkeiten vor. Der
Künstler konnte
das Erlebnis ver-
festigen , in dem
er ihm in sich einen
neuen möglichst
intensiven Aus-
druck suchte, ge-
wissermaßen den
Eindruck zu sicht-
barem Symbol ver-
dichtete und an
diesem gestaltend
zum Ausdruck
244