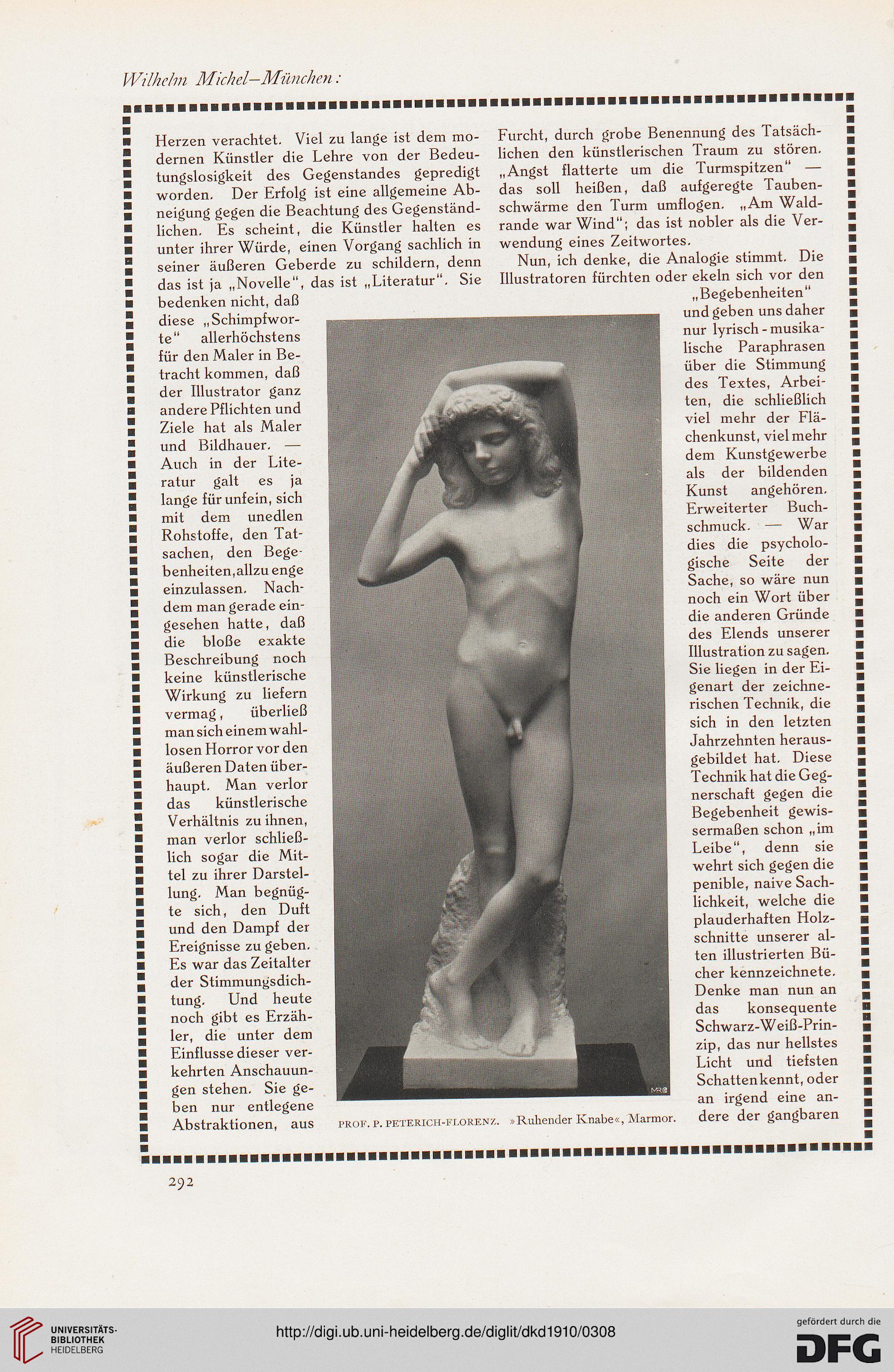Wilhelm Michel—München:
Herzen verachtet. Viel zu lange ist dem mo-
dernen Künstler die Lehre von der Bedeu-
tungslosigkeit des Gegenstandes gepredigt
worden. Der Erfolg ist eine allgemeine Ab-
neigung gegen die Beachtung des Gegenständ-
lichen. Es scheint, die Künstler halten es
unter ihrer Würde, einen Vorgang sachlich in
seiner äußeren Geberde zu schildern, denn
das ist ja „Novelle", das ist „Literatur". Sie
bedenken nicht, daß
diese „Schimpfwor-
te" allerhöchstens
für den Maler in Be-
tracht kommen, daß
der Illustrator ganz
andere Pflichten und
Ziele hat als Maler
und Bildhauer. —
Auch in der Lite-
ratur galt es ja
lange für unfein, sich
mit dem unedlen
Rohstoffe, den Tat-
sachen, den Bege-
benheiten,allzu enge
einzulassen. Nach-
dem man gerade ein-
gesehen hatte, daß
die bloße exakte
Beschreibung noch
keine künstlerische
Wirkung zu liefern
vermag, überließ
man sich einem wahl-
losen Horror vor den
äußeren Daten über-
haupt. Man verlor
das künstlerische
Verhältnis zu ihnen,
man verlor schließ-
lich sogar die Mit-
tel zu ihrer Darstel-
lung. Man begnüg-
te sich, den Duft
und den Dampf der
Ereignisse zu geben.
Es war das Zeitalter
der Stimmungsdich-
tung. Und heute
noch gibt es Erzäh-
ler, die unter dem
Einflüsse dieser ver-
kehrten Anschauun-
gen stehen. Sie ge-
ben nur entlegene
Abstraktionen, aus
PROF. p. PETERICH-I'I.OREN/,. »Ruhender Knabe«, Marmor.
Furcht, durch grobe Benennung des Tatsäch-
lichen den künstlerischen Traum zu stören.
„Angst flatterte um die Turmspitzen" —
das soll heißen, daß aufgeregte Tauben-
schwärme den Turm umflogen. „Am Wald-
rande war Wind"; das ist nobler als die Ver-
wendung eines Zeitwortes.
Nun, ich denke, die Analogie stimmt. Die
Illustratoren fürchten oder ekeln sich vor den
„Begebenheiten"
und geben uns daher
nur lyrisch - musika-
lische Paraphrasen
über die Stimmung
des Textes, Arbei-
ten, die schließlich
viel mehr der Flä-
chenkunst, vielmehr
dem Kunstgewerbe
als der bildenden
Kunst angehören.
Erweiterter Buch-
schmuck. — War
dies die psycholo-
gische Seite der
Sache, so wäre nun
noch ein Wort über
die anderen Gründe
des Elends unserer
Illustration zu sagen.
Sie liegen in der Ei-
genart der zeichne-
rischen Technik, die
sich in den letzten
Jahrzehnten heraus-
gebildet hat. Diese
Technik hat die Geg-
nerschaft gegen die
Begebenheit gewis-
sermaßen schon „im
Leibe", denn sie
wehrt sich gegen die
penible, naive Sach-
lichkeit, welche die
plauderhaften Holz-
schnitte unserer al-
ten illustrierten Bü-
cher kennzeichnete.
Denke man nun an
das konsequente
Schwarz-Weiß-Prin-
zip, das nur hellstes
Licht und tiefsten
Schattenkennt, oder
an irgend eine an-
dere der gangbaren
292
Herzen verachtet. Viel zu lange ist dem mo-
dernen Künstler die Lehre von der Bedeu-
tungslosigkeit des Gegenstandes gepredigt
worden. Der Erfolg ist eine allgemeine Ab-
neigung gegen die Beachtung des Gegenständ-
lichen. Es scheint, die Künstler halten es
unter ihrer Würde, einen Vorgang sachlich in
seiner äußeren Geberde zu schildern, denn
das ist ja „Novelle", das ist „Literatur". Sie
bedenken nicht, daß
diese „Schimpfwor-
te" allerhöchstens
für den Maler in Be-
tracht kommen, daß
der Illustrator ganz
andere Pflichten und
Ziele hat als Maler
und Bildhauer. —
Auch in der Lite-
ratur galt es ja
lange für unfein, sich
mit dem unedlen
Rohstoffe, den Tat-
sachen, den Bege-
benheiten,allzu enge
einzulassen. Nach-
dem man gerade ein-
gesehen hatte, daß
die bloße exakte
Beschreibung noch
keine künstlerische
Wirkung zu liefern
vermag, überließ
man sich einem wahl-
losen Horror vor den
äußeren Daten über-
haupt. Man verlor
das künstlerische
Verhältnis zu ihnen,
man verlor schließ-
lich sogar die Mit-
tel zu ihrer Darstel-
lung. Man begnüg-
te sich, den Duft
und den Dampf der
Ereignisse zu geben.
Es war das Zeitalter
der Stimmungsdich-
tung. Und heute
noch gibt es Erzäh-
ler, die unter dem
Einflüsse dieser ver-
kehrten Anschauun-
gen stehen. Sie ge-
ben nur entlegene
Abstraktionen, aus
PROF. p. PETERICH-I'I.OREN/,. »Ruhender Knabe«, Marmor.
Furcht, durch grobe Benennung des Tatsäch-
lichen den künstlerischen Traum zu stören.
„Angst flatterte um die Turmspitzen" —
das soll heißen, daß aufgeregte Tauben-
schwärme den Turm umflogen. „Am Wald-
rande war Wind"; das ist nobler als die Ver-
wendung eines Zeitwortes.
Nun, ich denke, die Analogie stimmt. Die
Illustratoren fürchten oder ekeln sich vor den
„Begebenheiten"
und geben uns daher
nur lyrisch - musika-
lische Paraphrasen
über die Stimmung
des Textes, Arbei-
ten, die schließlich
viel mehr der Flä-
chenkunst, vielmehr
dem Kunstgewerbe
als der bildenden
Kunst angehören.
Erweiterter Buch-
schmuck. — War
dies die psycholo-
gische Seite der
Sache, so wäre nun
noch ein Wort über
die anderen Gründe
des Elends unserer
Illustration zu sagen.
Sie liegen in der Ei-
genart der zeichne-
rischen Technik, die
sich in den letzten
Jahrzehnten heraus-
gebildet hat. Diese
Technik hat die Geg-
nerschaft gegen die
Begebenheit gewis-
sermaßen schon „im
Leibe", denn sie
wehrt sich gegen die
penible, naive Sach-
lichkeit, welche die
plauderhaften Holz-
schnitte unserer al-
ten illustrierten Bü-
cher kennzeichnete.
Denke man nun an
das konsequente
Schwarz-Weiß-Prin-
zip, das nur hellstes
Licht und tiefsten
Schattenkennt, oder
an irgend eine an-
dere der gangbaren
292