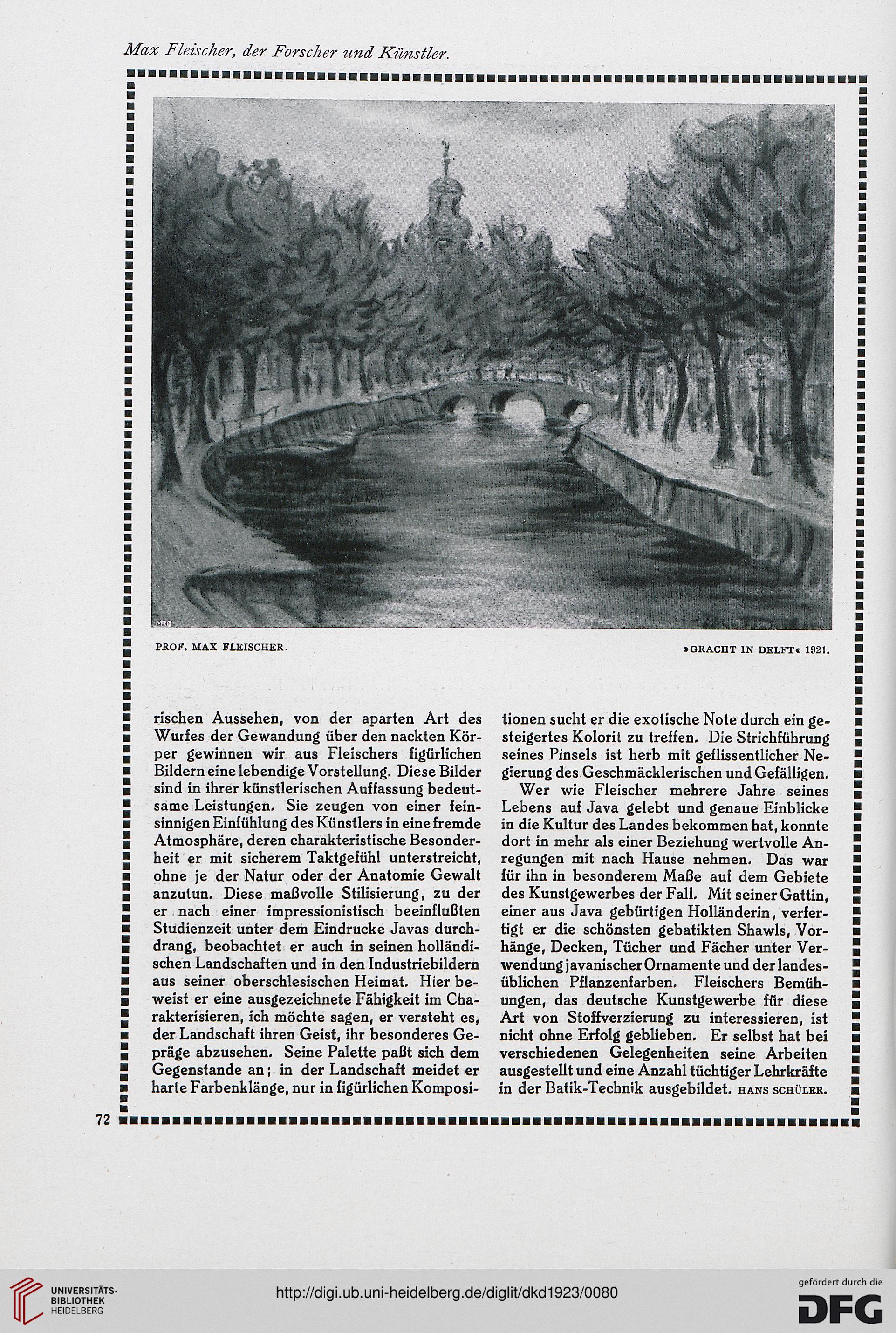Max Fleischer, der Forscher und Künstler.
prok. max fleischer
»gracht in delft« 1921.
rischen Aussehen, von der aparten Art des
Wuifes der Gewandung über den nackten Kör-
per gewinnen wir aus Fleischers figürlichen
Bildern eine lebendige Vorstellung. Diese Bilder
sind in ihrer künstlerischen Auffassung bedeut-
same Leistungen. Sie zeugen von einer fein-
sinnigen Einfühlung des Künstlers in eine fremde
Atmosphäre, deren charakteristische Besonder-
heit er mit sicherem Taktgefühl unterstreicht,
ohne je der Natur oder der Anatomie Gewalt
anzutun. Diese maßvolle Stilisierung, zu der
er nach einer impressionistisch beeinflußten
Studienzeit unter dem Eindrucke Javas durch-
drang, beobachtet er auch in seinen holländi-
schen Landschaften und in den Industriebildern
aus seiner oberschlesischen Heimat. Hier be-
weist er eine ausgezeichnete Fähigkeit im Cha-
rakterisieren, ich möchte sagen, er versteht es,
der Landschaft ihren Geist, ihr besonderes Ge-
präge abzusehen. Seine Palette paßt sich dem
Gegenstande an; in der Landschaft meidet er
harle Farbenklänge, nur in figürlichen Komposi-
tionen sucht er die exotische Note durch ein ge-
steigertes Kolorit zu treffen. Die Strichführung
seines Pinsels ist herb mit geflissentlicher Ne-
gierung des Geschmäcklerischen und Gefälligen.
Wer wie Fleischer mehrere Jahre seines
Lebens auf Java gelebt und genaue Einblicke
in die Kultur des Landes bekommen hat, konnte
dort in mehr als einer Beziehung werlvolle An-
regungen mit nach Hause nehmen. Das war
für ihn in besonderem Maße auf dem Gebiete
des Kunstgewerbes der Fall. Mit seiner Gattin,
einer aus Java gebürligen Holländerin, verfer-
tigt er die schönsten gebatikten Shawls, Vor-
hänge, Decken, Tücher und Fächer unter Ver-
wendungjavanischer Ornamente und der landes-
üblichen Pflanzenfarben. Fleischers Bemüh-
ungen, das deutsche Kunstgewerbe für diese
Art von Stoff Verzierung zu interessieren, ist
nicht ohne Erfolg geblieben. Er selbst hat bei
verschiedenen Gelegenheiten seine Arbeiten
ausgestellt und eine Anzahl tüchtiger Lehrkräfte
in der Batik-Technik ausgebildet, hans schüler.
prok. max fleischer
»gracht in delft« 1921.
rischen Aussehen, von der aparten Art des
Wuifes der Gewandung über den nackten Kör-
per gewinnen wir aus Fleischers figürlichen
Bildern eine lebendige Vorstellung. Diese Bilder
sind in ihrer künstlerischen Auffassung bedeut-
same Leistungen. Sie zeugen von einer fein-
sinnigen Einfühlung des Künstlers in eine fremde
Atmosphäre, deren charakteristische Besonder-
heit er mit sicherem Taktgefühl unterstreicht,
ohne je der Natur oder der Anatomie Gewalt
anzutun. Diese maßvolle Stilisierung, zu der
er nach einer impressionistisch beeinflußten
Studienzeit unter dem Eindrucke Javas durch-
drang, beobachtet er auch in seinen holländi-
schen Landschaften und in den Industriebildern
aus seiner oberschlesischen Heimat. Hier be-
weist er eine ausgezeichnete Fähigkeit im Cha-
rakterisieren, ich möchte sagen, er versteht es,
der Landschaft ihren Geist, ihr besonderes Ge-
präge abzusehen. Seine Palette paßt sich dem
Gegenstande an; in der Landschaft meidet er
harle Farbenklänge, nur in figürlichen Komposi-
tionen sucht er die exotische Note durch ein ge-
steigertes Kolorit zu treffen. Die Strichführung
seines Pinsels ist herb mit geflissentlicher Ne-
gierung des Geschmäcklerischen und Gefälligen.
Wer wie Fleischer mehrere Jahre seines
Lebens auf Java gelebt und genaue Einblicke
in die Kultur des Landes bekommen hat, konnte
dort in mehr als einer Beziehung werlvolle An-
regungen mit nach Hause nehmen. Das war
für ihn in besonderem Maße auf dem Gebiete
des Kunstgewerbes der Fall. Mit seiner Gattin,
einer aus Java gebürligen Holländerin, verfer-
tigt er die schönsten gebatikten Shawls, Vor-
hänge, Decken, Tücher und Fächer unter Ver-
wendungjavanischer Ornamente und der landes-
üblichen Pflanzenfarben. Fleischers Bemüh-
ungen, das deutsche Kunstgewerbe für diese
Art von Stoff Verzierung zu interessieren, ist
nicht ohne Erfolg geblieben. Er selbst hat bei
verschiedenen Gelegenheiten seine Arbeiten
ausgestellt und eine Anzahl tüchtiger Lehrkräfte
in der Batik-Technik ausgebildet, hans schüler.