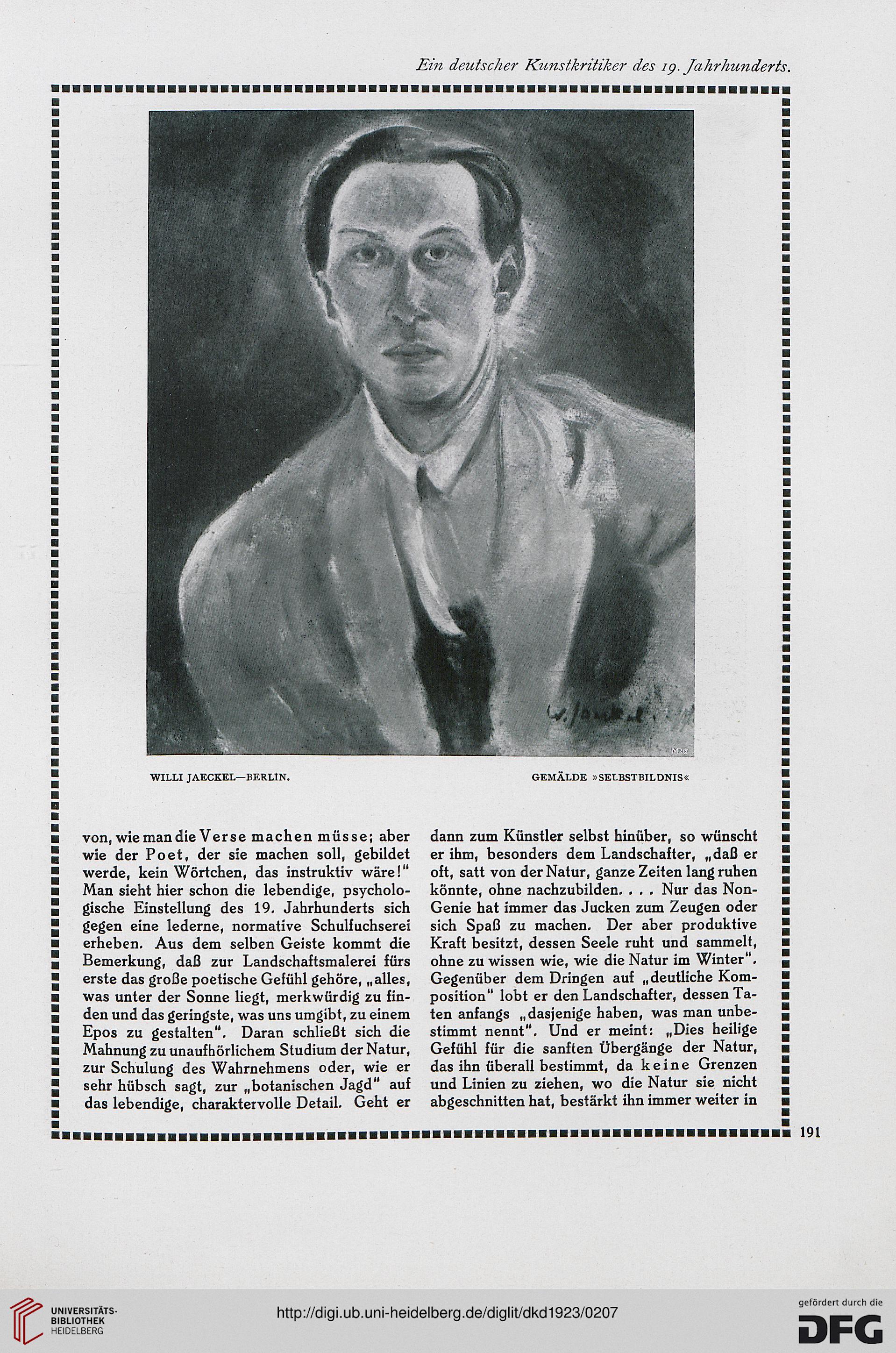Ein deutscher Kunstkritiker des ig. Jahrhunderts.
WILLI JAECKEL—BERLIN.
GEMÄLDE »SELBSTBILDNIS«
von, wie man die Verse machen müsse; aber
wie der Poet, der sie machen soll, gebildet
werde, kein Wörtchen, das instruktiv wäre!"
Man sieht hier schon die lebendige, psycholo-
gische Einstellung des 19. Jahrhunderts sich
gegen eine lederne, normative Schulfuchserei
erheben. Aus dem selben Geiste kommt die
Bemerkung, daß zur Landschaftsmalerei fürs
erste das große poetische Gefühl gehöre, „alles,
was unter der Sonne liegt, merkwürdig zu fin-
den und das geringste, was uns umgibt, zu einem
Epos zu gestalten". Daran schließt sich die
Mahnung zu unaufhörlichem Studium der Natur,
zur Schulung des Wahrnehmens oder, wie er
sehr hübsch sagt, zur „botanischen Jagd" auf
das lebendige, charaktervolle Detail. Geht er
dann zum Künstler selbst hinüber, so wünscht
er ihm, besonders dem Landschafter, „daß er
oft, satt von der Natur, ganze Zeiten lang ruhen
könnte, ohne nachzubilden. . . . Nur das Non-
Genie hat immer das Jucken zum Zeugen oder
sich Spaß zu machen. Der aber produktive
Kraft besitzt, dessen Seele ruht und sammelt,
ohne zu wissen wie, wie die Natur im Winter".
Gegenüber dem Dringen auf „deutliche Kom-
position" lobt er den Landschafter, dessen Ta-
ten anfangs „dasjenige haben, was man unbe-
stimmt nennt". Und er meint: „Dies heilige
Gefühl für die sanften Übergänge der Natur,
das ihn überall bestimmt, da keine Grenzen
und Linien zu ziehen, wo die Natur sie nicht
abgeschnitten hat, bestärkt ihn immer weiter in
WILLI JAECKEL—BERLIN.
GEMÄLDE »SELBSTBILDNIS«
von, wie man die Verse machen müsse; aber
wie der Poet, der sie machen soll, gebildet
werde, kein Wörtchen, das instruktiv wäre!"
Man sieht hier schon die lebendige, psycholo-
gische Einstellung des 19. Jahrhunderts sich
gegen eine lederne, normative Schulfuchserei
erheben. Aus dem selben Geiste kommt die
Bemerkung, daß zur Landschaftsmalerei fürs
erste das große poetische Gefühl gehöre, „alles,
was unter der Sonne liegt, merkwürdig zu fin-
den und das geringste, was uns umgibt, zu einem
Epos zu gestalten". Daran schließt sich die
Mahnung zu unaufhörlichem Studium der Natur,
zur Schulung des Wahrnehmens oder, wie er
sehr hübsch sagt, zur „botanischen Jagd" auf
das lebendige, charaktervolle Detail. Geht er
dann zum Künstler selbst hinüber, so wünscht
er ihm, besonders dem Landschafter, „daß er
oft, satt von der Natur, ganze Zeiten lang ruhen
könnte, ohne nachzubilden. . . . Nur das Non-
Genie hat immer das Jucken zum Zeugen oder
sich Spaß zu machen. Der aber produktive
Kraft besitzt, dessen Seele ruht und sammelt,
ohne zu wissen wie, wie die Natur im Winter".
Gegenüber dem Dringen auf „deutliche Kom-
position" lobt er den Landschafter, dessen Ta-
ten anfangs „dasjenige haben, was man unbe-
stimmt nennt". Und er meint: „Dies heilige
Gefühl für die sanften Übergänge der Natur,
das ihn überall bestimmt, da keine Grenzen
und Linien zu ziehen, wo die Natur sie nicht
abgeschnitten hat, bestärkt ihn immer weiter in