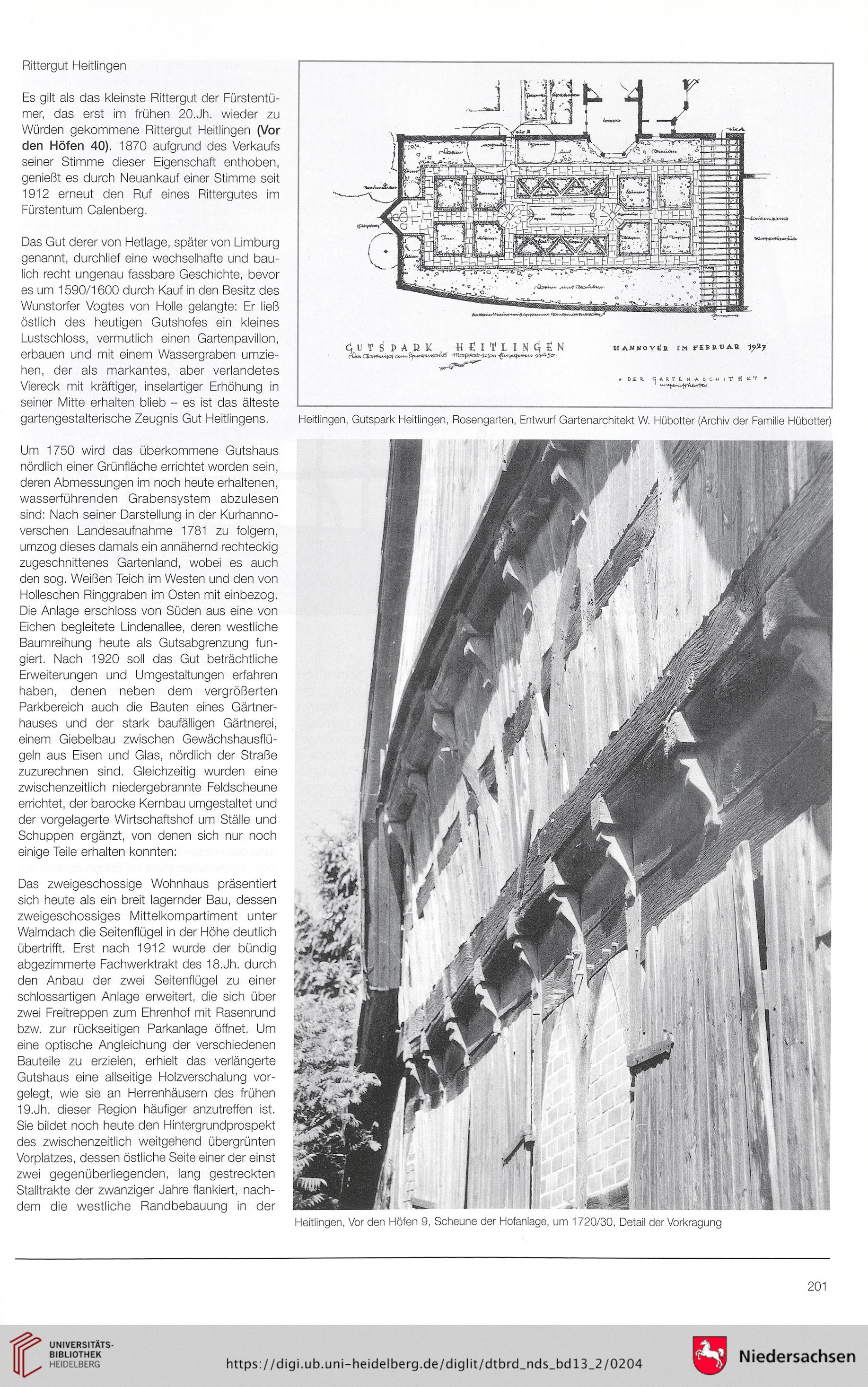Rittergut Heitlingen
Es gilt als das kleinste Rittergut der Fürstentü-
mer, das erst im frühen 20.Jh. wieder zu
Würden gekommene Rittergut Heitlingen (Vor
den Höfen 40). 1870 aufgrund des Verkaufs
seiner Stimme dieser Eigenschaft enthoben,
genießt es durch Neuankauf einer Stimme seit
1912 erneut den Ruf eines Rittergutes im
Fürstentum Calenberg.
Das Gut derer von Hetlage, später von Limburg
genannt, durchlief eine wechselhafte und bau-
lich recht ungenau fassbare Geschichte, bevor
es um 1590/1600 durch Kauf in den Besitz des
Wunstorfer Vogtes von Holle gelangte: Er ließ
östlich des heutigen Gutshofes ein kleines
Lustschloss, vermutlich einen Gartenpavillon,
erbauen und mit einem Wassergraben umzie-
hen, der als markantes, aber verlandetes
Viereck mit kräftiger, inselartiger Erhöhung in
seiner Mitte erhalten blieb - es ist das älteste
gartengestalterische Zeugnis Gut Heitlingens.
Heitlingen, Gutspark Heitlingen, Rosengarten, Entwurf Gartenarchitekt W. Hübotter (Archiv der Familie Hübotter)
Um 1750 wird das überkommene Gutshaus
nördlich einer Grünfläche errichtet worden sein,
deren Abmessungen im noch heute erhaltenen,
wasserführenden Grabensystem abzulesen
sind: Nach seiner Darstellung in der Kurhanno-
verschen Landesaufnahme 1781 zu folgern,
umzog dieses damals ein annähernd rechteckig
zugeschnittenes Gartenland, wobei es auch
den sog. Weißen Teich im Westen und den von
Holieschen Ringgraben im Osten mit einbezog.
Die Anlage erschloss von Süden aus eine von
Eichen begleitete Lindenallee, deren westliche
Baumreihung heute als Gutsabgrenzung fun-
giert. Nach 1920 soll das Gut beträchtliche
Erweiterungen und Umgestaltungen erfahren
haben, denen neben dem vergrößerten
Parkbereich auch die Bauten eines Gärtner-
hauses und der stark baufälligen Gärtnerei,
einem Giebelbau zwischen Gewächshausflü-
geln aus Eisen und Glas, nördlich der Straße
zuzurechnen sind. Gleichzeitig wurden eine
zwischenzeitlich niedergebrannte Feldscheune
errichtet, der barocke Kernbau umgestaltet und
der vorgelagerte Wirtschaftshof um Ställe und
Schuppen ergänzt, von denen sich nur noch
einige Teile erhalten konnten:
Das zweigeschossige Wohnhaus präsentiert
sich heute als ein breit lagernder Bau, dessen
zweigeschossiges Mittelkompartiment unter
Walmdach die Seitenflügel in der Höhe deutlich
übertrifft. Erst nach 1912 wurde der bündig
abgezimmerte Fachwerktrakt des 18.Jh. durch
den Anbau der zwei Seitenflügel zu einer
schlossartigen Anlage erweitert, die sich über
zwei Freitreppen zum Ehrenhof mit Rasenrund
bzw. zur rückseitigen Parkanlage öffnet. Um
eine optische Angleichung der verschiedenen
Bauteile zu erzielen, erhielt das verlängerte
Gutshaus eine allseitige Holzverschalung vor-
gelegt, wie sie an Herrenhäusern des frühen
19.Jh. dieser Region häufiger anzutreffen ist.
Sie bildet noch heute den Hintergrundprospekt
des zwischenzeitlich weitgehend übergrünten
Vorplatzes, dessen östliche Seite einer der einst
zwei gegenüberliegenden, lang gestreckten
Stalltrakte der zwanziger Jahre flankiert, nach-
dem die westliche Randbebauung in der
Heitlingen, Vor den Höfen 9, Scheune der Hofanlage, um 1720/30, Detail der Vorkragung
201
Es gilt als das kleinste Rittergut der Fürstentü-
mer, das erst im frühen 20.Jh. wieder zu
Würden gekommene Rittergut Heitlingen (Vor
den Höfen 40). 1870 aufgrund des Verkaufs
seiner Stimme dieser Eigenschaft enthoben,
genießt es durch Neuankauf einer Stimme seit
1912 erneut den Ruf eines Rittergutes im
Fürstentum Calenberg.
Das Gut derer von Hetlage, später von Limburg
genannt, durchlief eine wechselhafte und bau-
lich recht ungenau fassbare Geschichte, bevor
es um 1590/1600 durch Kauf in den Besitz des
Wunstorfer Vogtes von Holle gelangte: Er ließ
östlich des heutigen Gutshofes ein kleines
Lustschloss, vermutlich einen Gartenpavillon,
erbauen und mit einem Wassergraben umzie-
hen, der als markantes, aber verlandetes
Viereck mit kräftiger, inselartiger Erhöhung in
seiner Mitte erhalten blieb - es ist das älteste
gartengestalterische Zeugnis Gut Heitlingens.
Heitlingen, Gutspark Heitlingen, Rosengarten, Entwurf Gartenarchitekt W. Hübotter (Archiv der Familie Hübotter)
Um 1750 wird das überkommene Gutshaus
nördlich einer Grünfläche errichtet worden sein,
deren Abmessungen im noch heute erhaltenen,
wasserführenden Grabensystem abzulesen
sind: Nach seiner Darstellung in der Kurhanno-
verschen Landesaufnahme 1781 zu folgern,
umzog dieses damals ein annähernd rechteckig
zugeschnittenes Gartenland, wobei es auch
den sog. Weißen Teich im Westen und den von
Holieschen Ringgraben im Osten mit einbezog.
Die Anlage erschloss von Süden aus eine von
Eichen begleitete Lindenallee, deren westliche
Baumreihung heute als Gutsabgrenzung fun-
giert. Nach 1920 soll das Gut beträchtliche
Erweiterungen und Umgestaltungen erfahren
haben, denen neben dem vergrößerten
Parkbereich auch die Bauten eines Gärtner-
hauses und der stark baufälligen Gärtnerei,
einem Giebelbau zwischen Gewächshausflü-
geln aus Eisen und Glas, nördlich der Straße
zuzurechnen sind. Gleichzeitig wurden eine
zwischenzeitlich niedergebrannte Feldscheune
errichtet, der barocke Kernbau umgestaltet und
der vorgelagerte Wirtschaftshof um Ställe und
Schuppen ergänzt, von denen sich nur noch
einige Teile erhalten konnten:
Das zweigeschossige Wohnhaus präsentiert
sich heute als ein breit lagernder Bau, dessen
zweigeschossiges Mittelkompartiment unter
Walmdach die Seitenflügel in der Höhe deutlich
übertrifft. Erst nach 1912 wurde der bündig
abgezimmerte Fachwerktrakt des 18.Jh. durch
den Anbau der zwei Seitenflügel zu einer
schlossartigen Anlage erweitert, die sich über
zwei Freitreppen zum Ehrenhof mit Rasenrund
bzw. zur rückseitigen Parkanlage öffnet. Um
eine optische Angleichung der verschiedenen
Bauteile zu erzielen, erhielt das verlängerte
Gutshaus eine allseitige Holzverschalung vor-
gelegt, wie sie an Herrenhäusern des frühen
19.Jh. dieser Region häufiger anzutreffen ist.
Sie bildet noch heute den Hintergrundprospekt
des zwischenzeitlich weitgehend übergrünten
Vorplatzes, dessen östliche Seite einer der einst
zwei gegenüberliegenden, lang gestreckten
Stalltrakte der zwanziger Jahre flankiert, nach-
dem die westliche Randbebauung in der
Heitlingen, Vor den Höfen 9, Scheune der Hofanlage, um 1720/30, Detail der Vorkragung
201