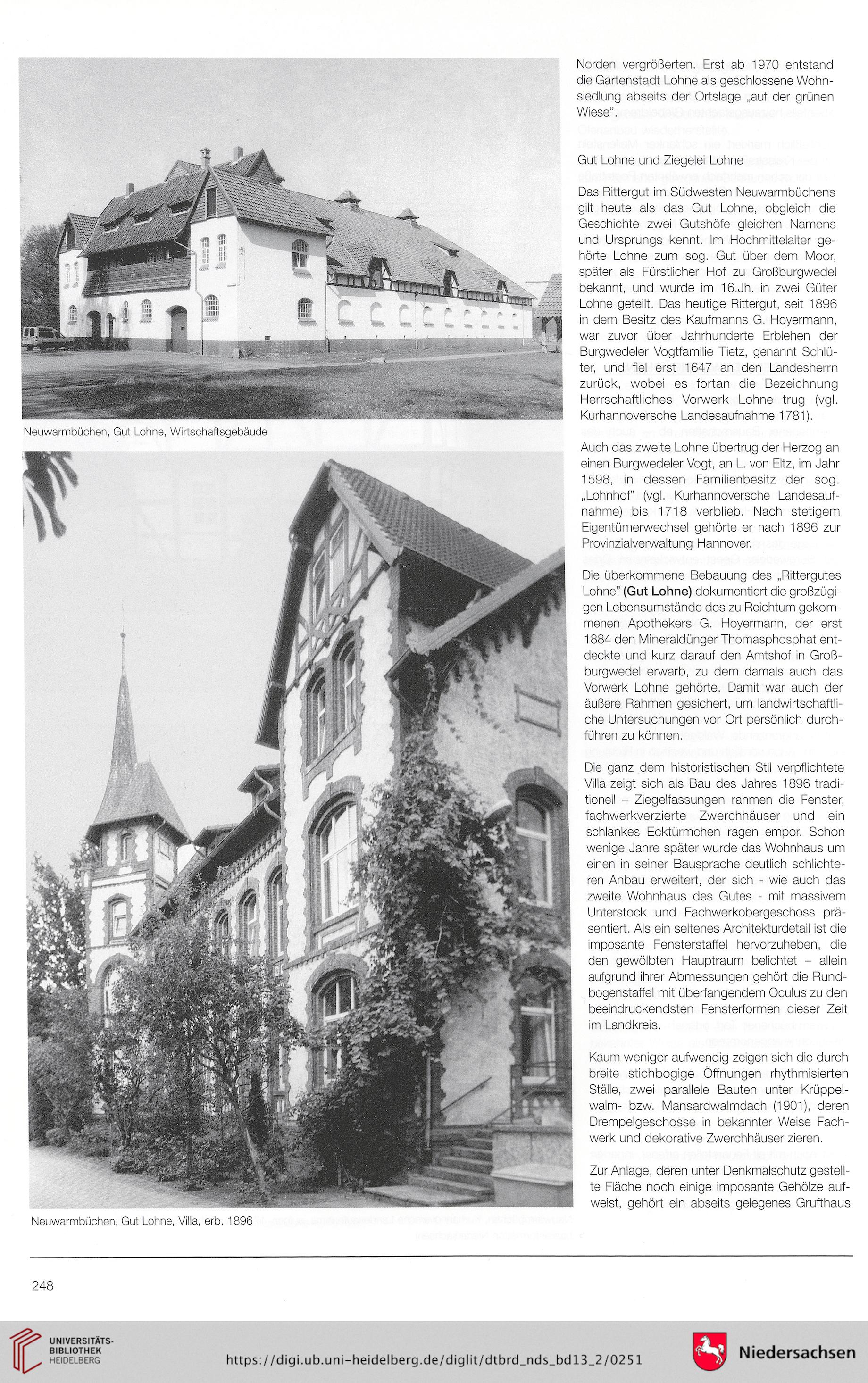Norden vergrößerten. Erst ab 1970 entstand
die Gartenstadt Lohne als geschlossene Wohn-
siedlung abseits der Ortslage „auf der grünen
Wiese”.
Gut Lohne und Ziegelei Lohne
Das Rittergut im Südwesten Neuwarmbüchens
gilt heute als das Gut Lohne, obgleich die
Geschichte zwei Gutshöfe gleichen Namens
und Ursprungs kennt. Im Hochmittelalter ge-
hörte Lohne zum sog. Gut über dem Moor,
später als Fürstlicher Hof zu Großburgwedel
bekannt, und wurde im 16.Jh. in zwei Güter
Lohne geteilt. Das heutige Rittergut, seit 1896
in dem Besitz des Kaufmanns G. Hoyermann,
war zuvor über Jahrhunderte Erbiehen der
Burgwedeler Vogtfamilie Tietz, genannt Schlü-
ter, und fiel erst 1647 an den Landesherrn
zurück, wobei es fortan die Bezeichnung
Herrschaftliches Vorwerk Lohne trug (vgl.
Kurhannoversche Landesaufnahme 1781).
Neuwarmbüchen, Gut Lohne, Wirtschaftsgebäude
Auch das zweite Lohne übertrug der Herzog an
einen Burgwedeler Vogt, an L. von Eltz, im Jahr
1598, in dessen Familienbesitz der sog.
„Lohnhof” (vgl. Kurhannoversche Landesauf-
nahme) bis 1718 verblieb. Nach stetigem
Eigentümerwechsel gehörte er nach 1896 zur
Provinzialverwaltung Hannover.
Die überkommene Bebauung des „Rittergutes
Lohne” (Gut Lohne) dokumentiert die großzügi-
gen Lebensumstände des zu Reichtum gekom-
menen Apothekers G. Hoyermann, der erst
1884 den Mineraldünger Thomasphosphat ent-
deckte und kurz darauf den Amtshof in Groß-
burgwedel erwarb, zu dem damals auch das
Vorwerk Lohne gehörte. Damit war auch der
äußere Rahmen gesichert, um landwirtschaftli-
che Untersuchungen vor Ort persönlich durch-
führen zu können.
Die ganz dem historistischen Stil verpflichtete
Villa zeigt sich als Bau des Jahres 1896 tradi-
tionell - Ziegelfassungen rahmen die Fenster,
fachwerkverzierte Zwerchhäuser und ein
schlankes Ecktürmchen ragen empor. Schon
wenige Jahre später wurde das Wohnhaus um
einen in seiner Bausprache deutlich schlichte-
ren Anbau erweitert, der sich - wie auch das
zweite Wohnhaus des Gutes - mit massivem
Unterstock und Fachwerkobergeschoss prä-
sentiert. Als ein seltenes Architekturdetail ist die
imposante Fensterstaffel hervorzuheben, die
den gewölbten Hauptraum belichtet - allein
aufgrund ihrer Abmessungen gehört die Rund-
bogenstaffel mit überfangendem Oculus zu den
beeindruckendsten Fensterformen dieser Zeit
im Landkreis.
Kaum weniger aufwendig zeigen sich die durch
breite stichbogige Öffnungen rhythmisierten
Ställe, zwei parallele Bauten unter Krüppel-
walm- bzw. Mansardwalmdach (1901), deren
Drempelgeschosse in bekannter Weise Fach-
werk und dekorative Zwerchhäuser zieren.
Zur Anlage, deren unter Denkmalschutz gestell-
te Fläche noch einige imposante Gehölze auf-
weist, gehört ein abseits gelegenes Grufthaus
Neuwarmbüchen, Gut Lohne, Villa, erb. 1896
248