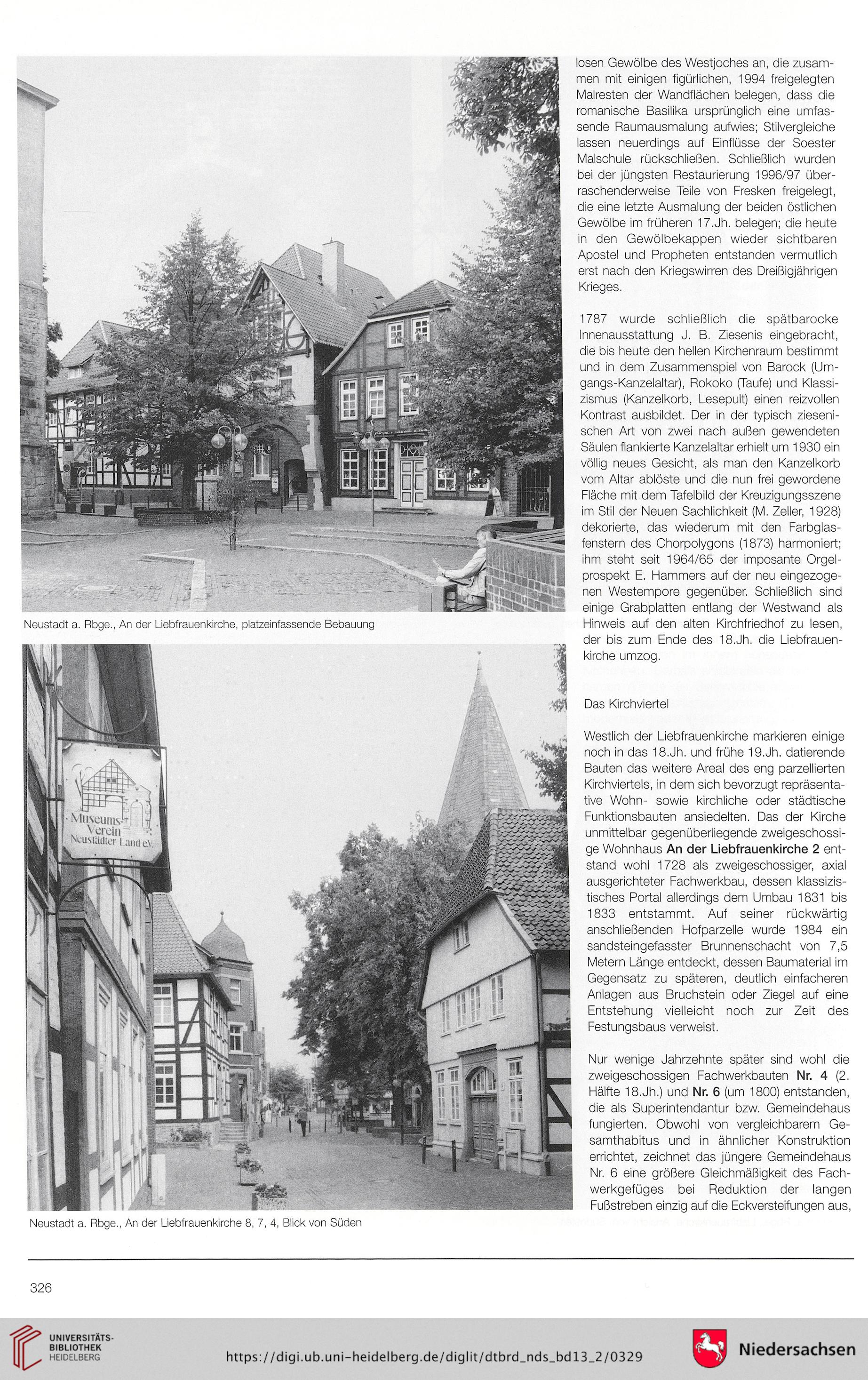Neustadt a. Rbge., An der Liebfrauenkirche, platzeinfassende Bebauung
losen Gewölbe des Westjoches an, die zusam-
men mit einigen figürlichen, 1994 freigelegten
Malresten der Wandflächen belegen, dass die
romanische Basilika ursprünglich eine umfas-
sende Raumausmalung aufwies; Stilvergleiche
lassen neuerdings auf Einflüsse der Soester
Malschule rückschließen. Schließlich wurden
bei der jüngsten Restaurierung 1996/97 über-
raschenderweise Teile von Fresken freigelegt,
die eine letzte Ausmalung der beiden östlichen
Gewölbe im früheren 17.Jh. belegen; die heute
in den Gewölbekappen wieder sichtbaren
Apostel und Propheten entstanden vermutlich
erst nach den Kriegswirren des Dreißigjährigen
Krieges.
1787 wurde schließlich die spätbarocke
Innenausstattung J. B. Ziesenis eingebracht,
die bis heute den hellen Kirchenraum bestimmt
und in dem Zusammenspiel von Barock (Um-
gangs-Kanzelaltar), Rokoko (Taufe) und Klassi-
zismus (Kanzelkorb, Lesepult) einen reizvollen
Kontrast ausbildet. Der in der typisch zieseni-
schen Art von zwei nach außen gewendeten
Säulen flankierte Kanzelaltar erhielt um 1930 ein
völlig neues Gesicht, als man den Kanzelkorb
vom Altar ablöste und die nun frei gewordene
Fläche mit dem Tafelbild der Kreuzigungsszene
im Stil der Neuen Sachlichkeit (M. Zeller, 1928)
dekorierte, das wiederum mit den Farbglas-
fenstern des Chorpolygons (1873) harmoniert;
ihm steht seit 1964/65 der imposante Orgel-
prospekt E. Hammers auf der neu eingezoge-
nen Westempore gegenüber. Schließlich sind
einige Grabplatten entlang der Westwand als
Hinweis auf den alten Kirchfriedhof zu lesen,
der bis zum Ende des 18.Jh. die Liebfrauen-
kirche umzog.
Das Kirchviertel
Westlich der Liebfrauenkirche markieren einige
noch in das 18.Jh. und frühe 19.Jh. datierende
Bauten das weitere Areal des eng parzellierten
Kirchviertels, in dem sich bevorzugt repräsenta-
tive Wohn- sowie kirchliche oder städtische
Funktionsbauten ansiedelten. Das der Kirche
unmittelbar gegenüberliegende zweigeschossi-
ge Wohnhaus An der Liebfrauenkirche 2 ent-
stand wohl 1728 als zweigeschossiger, axial
ausgerichteter Fachwerkbau, dessen klassizis-
tisches Portal allerdings dem Umbau 1831 bis
1833 entstammt. Auf seiner rückwärtig
anschließenden Hofparzelle wurde 1984 ein
sandsteingefasster Brunnenschacht von 7,5
Metern Länge entdeckt, dessen Baumaterial im
Gegensatz zu späteren, deutlich einfacheren
Anlagen aus Bruchstein oder Ziegel auf eine
Entstehung vielleicht noch zur Zeit des
Festungsbaus verweist.
Nur wenige Jahrzehnte später sind wohl die
zweigeschossigen Fachwerkbauten Nr. 4 (2.
Hälfte 18.Jh.) und Nr. 6 (um 1800) entstanden,
die als Superintendantur bzw. Gemeindehaus
fungierten. Obwohl von vergleichbarem Ge-
samthabitus und in ähnlicher Konstruktion
errichtet, zeichnet das jüngere Gemeindehaus
Nr. 6 eine größere Gleichmäßigkeit des Fach-
werkgefüges bei Reduktion der langen
Fußstreben einzig auf die Eckversteifungen aus,
Neustadt a. Rbge., An der Liebfrauenkirche 8, 7, 4, Blick von Süden
326
losen Gewölbe des Westjoches an, die zusam-
men mit einigen figürlichen, 1994 freigelegten
Malresten der Wandflächen belegen, dass die
romanische Basilika ursprünglich eine umfas-
sende Raumausmalung aufwies; Stilvergleiche
lassen neuerdings auf Einflüsse der Soester
Malschule rückschließen. Schließlich wurden
bei der jüngsten Restaurierung 1996/97 über-
raschenderweise Teile von Fresken freigelegt,
die eine letzte Ausmalung der beiden östlichen
Gewölbe im früheren 17.Jh. belegen; die heute
in den Gewölbekappen wieder sichtbaren
Apostel und Propheten entstanden vermutlich
erst nach den Kriegswirren des Dreißigjährigen
Krieges.
1787 wurde schließlich die spätbarocke
Innenausstattung J. B. Ziesenis eingebracht,
die bis heute den hellen Kirchenraum bestimmt
und in dem Zusammenspiel von Barock (Um-
gangs-Kanzelaltar), Rokoko (Taufe) und Klassi-
zismus (Kanzelkorb, Lesepult) einen reizvollen
Kontrast ausbildet. Der in der typisch zieseni-
schen Art von zwei nach außen gewendeten
Säulen flankierte Kanzelaltar erhielt um 1930 ein
völlig neues Gesicht, als man den Kanzelkorb
vom Altar ablöste und die nun frei gewordene
Fläche mit dem Tafelbild der Kreuzigungsszene
im Stil der Neuen Sachlichkeit (M. Zeller, 1928)
dekorierte, das wiederum mit den Farbglas-
fenstern des Chorpolygons (1873) harmoniert;
ihm steht seit 1964/65 der imposante Orgel-
prospekt E. Hammers auf der neu eingezoge-
nen Westempore gegenüber. Schließlich sind
einige Grabplatten entlang der Westwand als
Hinweis auf den alten Kirchfriedhof zu lesen,
der bis zum Ende des 18.Jh. die Liebfrauen-
kirche umzog.
Das Kirchviertel
Westlich der Liebfrauenkirche markieren einige
noch in das 18.Jh. und frühe 19.Jh. datierende
Bauten das weitere Areal des eng parzellierten
Kirchviertels, in dem sich bevorzugt repräsenta-
tive Wohn- sowie kirchliche oder städtische
Funktionsbauten ansiedelten. Das der Kirche
unmittelbar gegenüberliegende zweigeschossi-
ge Wohnhaus An der Liebfrauenkirche 2 ent-
stand wohl 1728 als zweigeschossiger, axial
ausgerichteter Fachwerkbau, dessen klassizis-
tisches Portal allerdings dem Umbau 1831 bis
1833 entstammt. Auf seiner rückwärtig
anschließenden Hofparzelle wurde 1984 ein
sandsteingefasster Brunnenschacht von 7,5
Metern Länge entdeckt, dessen Baumaterial im
Gegensatz zu späteren, deutlich einfacheren
Anlagen aus Bruchstein oder Ziegel auf eine
Entstehung vielleicht noch zur Zeit des
Festungsbaus verweist.
Nur wenige Jahrzehnte später sind wohl die
zweigeschossigen Fachwerkbauten Nr. 4 (2.
Hälfte 18.Jh.) und Nr. 6 (um 1800) entstanden,
die als Superintendantur bzw. Gemeindehaus
fungierten. Obwohl von vergleichbarem Ge-
samthabitus und in ähnlicher Konstruktion
errichtet, zeichnet das jüngere Gemeindehaus
Nr. 6 eine größere Gleichmäßigkeit des Fach-
werkgefüges bei Reduktion der langen
Fußstreben einzig auf die Eckversteifungen aus,
Neustadt a. Rbge., An der Liebfrauenkirche 8, 7, 4, Blick von Süden
326