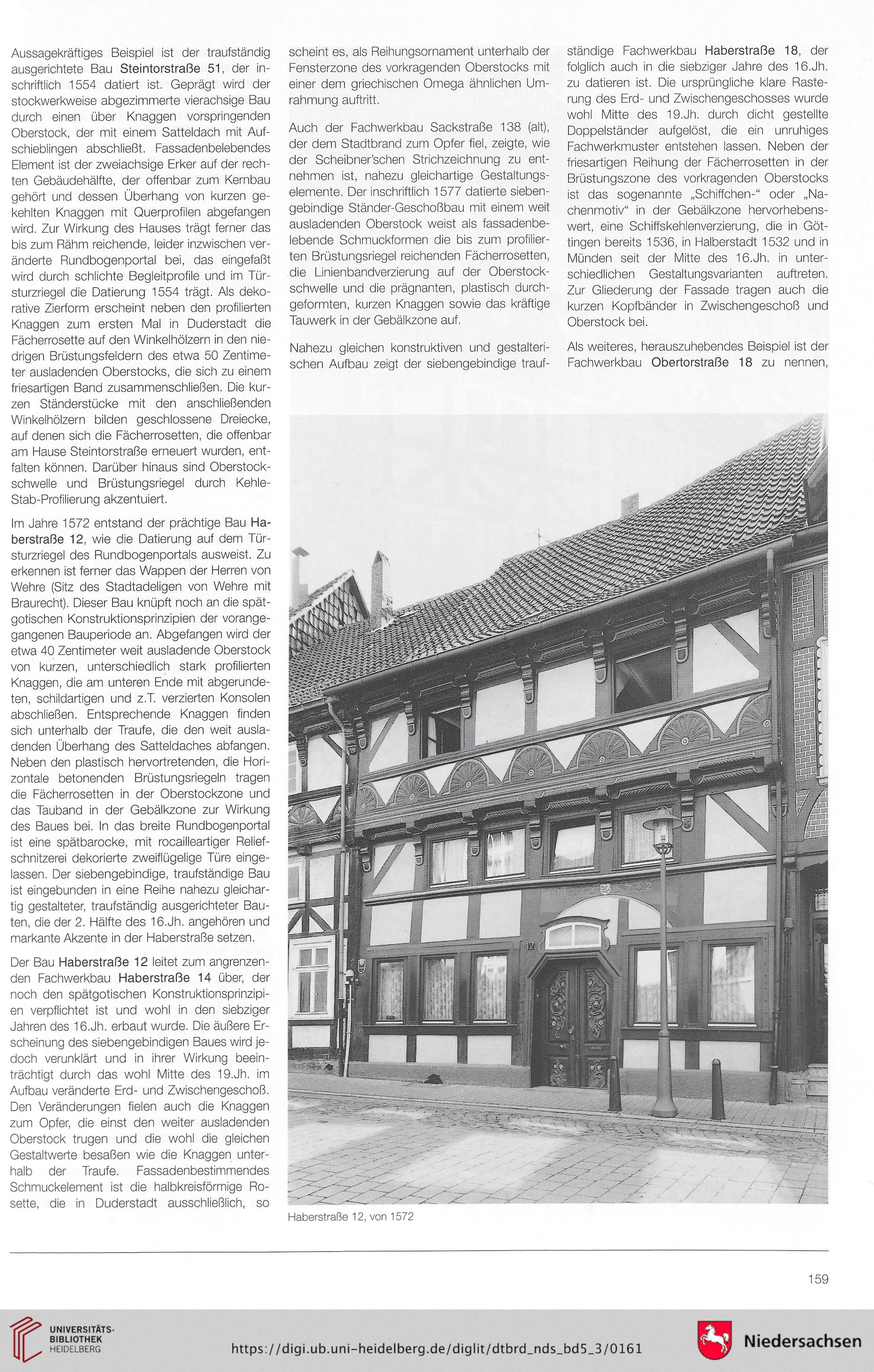Aussagekräftiges Beispiel ist der traufständig
ausgerichtete Bau Steintorstraße 51, der in-
schriftlich 1554 datiert ist. Geprägt wird der
stockwerkweise abgezimmerte vierachsige Bau
durch einen über Knaggen vorspringenden
Oberstock, der mit einem Satteldach mit Auf-
schieblingen abschließt. Fassadenbelebendes
Element ist der zweiachsige Erker auf der rech-
ten Gebäudehälfte, der offenbar zum Kernbau
gehört und dessen Überhang von kurzen ge-
kehlten Knaggen mit Querprofilen abgefangen
wird. Zur Wirkung des Hauses trägt ferner das
bis zum Rähm reichende, leider inzwischen ver-
änderte Rundbogenportal bei, das eingefaßt
wird durch schlichte Begleitprofile und im Tür-
sturzriegel die Datierung 1554 trägt. Als deko-
rative Zierform erscheint neben den profilierten
Knaggen zum ersten Mal in Duderstadt die
Fächerrosette auf den Winkelhölzern in den nie-
drigen Brüstungsfeldern des etwa 50 Zentime-
ter ausladenden Oberstocks, die sich zu einem
friesartigen Band zusammenschließen. Die kur-
zen Ständerstücke mit den anschließenden
Winkelhölzern bilden geschlossene Dreiecke,
auf denen sich die Fächerrosetten, die offenbar
am Hause Steintorstraße erneuert wurden, ent-
falten können. Darüber hinaus sind Oberstock-
schwelle und Brüstungsriegel durch Kehle-
Stab-Profilierung akzentuiert.
Im Jahre 1572 entstand der prächtige Bau Ha-
berstraße 12, wie die Datierung auf dem Tür-
sturzriegel des Rundbogenportals ausweist. Zu
erkennen ist ferner das Wappen der Herren von
Wehre (Sitz des Stadtadeligen von Wehre mit
Braurecht). Dieser Bau knüpft noch an die spät-
gotischen Konstruktionsprinzipien der vorange-
gangenen Bauperiode an. Abgefangen wird der
etwa 40 Zentimeter weit ausladende Oberstock
von kurzen, unterschiedlich stark profilierten
Knaggen, die am unteren Ende mit abgerunde-
ten, schildartigen und z.T. verzierten Konsolen
abschließen. Entsprechende Knaggen finden
sich unterhalb der Traufe, die den weit ausla-
denden Überhang des Satteldaches abfangen.
Neben den plastisch hervortretenden, die Hori-
zontale betonenden Brüstungsriegeln tragen
die Fächerrosetten in der Oberstockzone und
das Tauband in der Gebälkzone zur Wirkung
des Baues bei. In das breite Rundbogenportal
ist eine spätbarocke, mit rocailleartiger Relief-
schnitzerei dekorierte zweiflügelige Türe einge-
lassen. Der siebengebindige, traufständige Bau
ist eingebunden in eine Reihe nahezu gleichar-
tig gestalteter, traufständig ausgerichteter Bau-
ten, die der 2. Hälfte des 16.Jh. angehören und
markante Akzente in der Haberstraße setzen.
Der Bau Haberstraße 12 leitet zum angrenzen-
den Fachwerkbau Haberstraße 14 über, der
noch den spätgotischen Konstruktionsprinzipi-
en verpflichtet ist und wohl in den siebziger
Jahren des 16.Jh. erbaut wurde. Die äußere Er-
scheinung des siebengebindigen Baues wird je-
doch verunklärt und in ihrer Wirkung beein-
trächtigt durch das wohl Mitte des 19.Jh. im
Aufbau veränderte Erd- und Zwischengeschoß.
Den Veränderungen fielen auch die Knaggen
zum Opfer, die einst den weiter ausladenden
Oberstock trugen und die wohl die gleichen
Gestaltwerte besaßen wie die Knaggen unter-
halb der Traufe. Fassadenbestimmendes
Schmuckelement ist die halbkreisförmige Ro-
sette, die in Duderstadt ausschließlich, so
scheint es, als Reihungsornament unterhalb der
Fensterzone des vorkragenden Oberstocks mit
einer dem griechischen Omega ähnlichen Um-
rahmung auftritt.
Auch der Fachwerkbau Sackstraße 138 (alt),
der dem Stadtbrand zum Opfer fiel, zeigte, wie
der Scheibner’schen Strichzeichnung zu ent-
nehmen ist, nahezu gleichartige Gestaltungs-
elemente. Der inschriftlich 1577 datierte sieben-
gebindige Ständer-Geschoßbau mit einem weit
ausladenden Oberstock weist als fassadenbe-
lebende Schmuckformen die bis zum profilier-
ten Brüstungsriegel reichenden Fächerrosetten,
die Linienbandverzierung auf der Oberstock-
schwelle und die prägnanten, plastisch durch-
geformten, kurzen Knaggen sowie das kräftige
Tauwerk in der Gebälkzone auf.
Nahezu gleichen konstruktiven und gestalteri-
schen Aufbau zeigt der siebengebindige trauf-
ständige Fachwerkbau Haberstraße 18, der
folglich auch in die siebziger Jahre des 16.Jh.
zu datieren ist. Die ursprüngliche klare Raste-
rung des Erd- und Zwischengeschosses wurde
wohl Mitte des 19.Jh. durch dicht gestellte
Doppelständer aufgelöst, die ein unruhiges
Fachwerkmuster entstehen lassen. Neben der
friesartigen Reihung der Fächerrosetten in der
Brüstungszone des vorkragenden Oberstocks
ist das sogenannte „Schiffchen-“ oder „Na-
chenmotiv“ in der Gebälkzone hervorhebens-
wert, eine Schiffskehlenverzierung, die in Göt-
tingen bereits 1536, in Halberstadt 1532 und in
Münden seit der Mitte des 16.Jh. in unter-
schiedlichen Gestaltungsvarianten auftreten.
Zur Gliederung der Fassade tragen auch die
kurzen Kopfbänder in Zwischengeschoß und
Oberstock bei.
Als weiteres, herauszuhebendes Beispiel ist der
Fachwerkbau Obertorstraße 18 zu nennen,
Haberstraße 12, von 1572
159
ausgerichtete Bau Steintorstraße 51, der in-
schriftlich 1554 datiert ist. Geprägt wird der
stockwerkweise abgezimmerte vierachsige Bau
durch einen über Knaggen vorspringenden
Oberstock, der mit einem Satteldach mit Auf-
schieblingen abschließt. Fassadenbelebendes
Element ist der zweiachsige Erker auf der rech-
ten Gebäudehälfte, der offenbar zum Kernbau
gehört und dessen Überhang von kurzen ge-
kehlten Knaggen mit Querprofilen abgefangen
wird. Zur Wirkung des Hauses trägt ferner das
bis zum Rähm reichende, leider inzwischen ver-
änderte Rundbogenportal bei, das eingefaßt
wird durch schlichte Begleitprofile und im Tür-
sturzriegel die Datierung 1554 trägt. Als deko-
rative Zierform erscheint neben den profilierten
Knaggen zum ersten Mal in Duderstadt die
Fächerrosette auf den Winkelhölzern in den nie-
drigen Brüstungsfeldern des etwa 50 Zentime-
ter ausladenden Oberstocks, die sich zu einem
friesartigen Band zusammenschließen. Die kur-
zen Ständerstücke mit den anschließenden
Winkelhölzern bilden geschlossene Dreiecke,
auf denen sich die Fächerrosetten, die offenbar
am Hause Steintorstraße erneuert wurden, ent-
falten können. Darüber hinaus sind Oberstock-
schwelle und Brüstungsriegel durch Kehle-
Stab-Profilierung akzentuiert.
Im Jahre 1572 entstand der prächtige Bau Ha-
berstraße 12, wie die Datierung auf dem Tür-
sturzriegel des Rundbogenportals ausweist. Zu
erkennen ist ferner das Wappen der Herren von
Wehre (Sitz des Stadtadeligen von Wehre mit
Braurecht). Dieser Bau knüpft noch an die spät-
gotischen Konstruktionsprinzipien der vorange-
gangenen Bauperiode an. Abgefangen wird der
etwa 40 Zentimeter weit ausladende Oberstock
von kurzen, unterschiedlich stark profilierten
Knaggen, die am unteren Ende mit abgerunde-
ten, schildartigen und z.T. verzierten Konsolen
abschließen. Entsprechende Knaggen finden
sich unterhalb der Traufe, die den weit ausla-
denden Überhang des Satteldaches abfangen.
Neben den plastisch hervortretenden, die Hori-
zontale betonenden Brüstungsriegeln tragen
die Fächerrosetten in der Oberstockzone und
das Tauband in der Gebälkzone zur Wirkung
des Baues bei. In das breite Rundbogenportal
ist eine spätbarocke, mit rocailleartiger Relief-
schnitzerei dekorierte zweiflügelige Türe einge-
lassen. Der siebengebindige, traufständige Bau
ist eingebunden in eine Reihe nahezu gleichar-
tig gestalteter, traufständig ausgerichteter Bau-
ten, die der 2. Hälfte des 16.Jh. angehören und
markante Akzente in der Haberstraße setzen.
Der Bau Haberstraße 12 leitet zum angrenzen-
den Fachwerkbau Haberstraße 14 über, der
noch den spätgotischen Konstruktionsprinzipi-
en verpflichtet ist und wohl in den siebziger
Jahren des 16.Jh. erbaut wurde. Die äußere Er-
scheinung des siebengebindigen Baues wird je-
doch verunklärt und in ihrer Wirkung beein-
trächtigt durch das wohl Mitte des 19.Jh. im
Aufbau veränderte Erd- und Zwischengeschoß.
Den Veränderungen fielen auch die Knaggen
zum Opfer, die einst den weiter ausladenden
Oberstock trugen und die wohl die gleichen
Gestaltwerte besaßen wie die Knaggen unter-
halb der Traufe. Fassadenbestimmendes
Schmuckelement ist die halbkreisförmige Ro-
sette, die in Duderstadt ausschließlich, so
scheint es, als Reihungsornament unterhalb der
Fensterzone des vorkragenden Oberstocks mit
einer dem griechischen Omega ähnlichen Um-
rahmung auftritt.
Auch der Fachwerkbau Sackstraße 138 (alt),
der dem Stadtbrand zum Opfer fiel, zeigte, wie
der Scheibner’schen Strichzeichnung zu ent-
nehmen ist, nahezu gleichartige Gestaltungs-
elemente. Der inschriftlich 1577 datierte sieben-
gebindige Ständer-Geschoßbau mit einem weit
ausladenden Oberstock weist als fassadenbe-
lebende Schmuckformen die bis zum profilier-
ten Brüstungsriegel reichenden Fächerrosetten,
die Linienbandverzierung auf der Oberstock-
schwelle und die prägnanten, plastisch durch-
geformten, kurzen Knaggen sowie das kräftige
Tauwerk in der Gebälkzone auf.
Nahezu gleichen konstruktiven und gestalteri-
schen Aufbau zeigt der siebengebindige trauf-
ständige Fachwerkbau Haberstraße 18, der
folglich auch in die siebziger Jahre des 16.Jh.
zu datieren ist. Die ursprüngliche klare Raste-
rung des Erd- und Zwischengeschosses wurde
wohl Mitte des 19.Jh. durch dicht gestellte
Doppelständer aufgelöst, die ein unruhiges
Fachwerkmuster entstehen lassen. Neben der
friesartigen Reihung der Fächerrosetten in der
Brüstungszone des vorkragenden Oberstocks
ist das sogenannte „Schiffchen-“ oder „Na-
chenmotiv“ in der Gebälkzone hervorhebens-
wert, eine Schiffskehlenverzierung, die in Göt-
tingen bereits 1536, in Halberstadt 1532 und in
Münden seit der Mitte des 16.Jh. in unter-
schiedlichen Gestaltungsvarianten auftreten.
Zur Gliederung der Fassade tragen auch die
kurzen Kopfbänder in Zwischengeschoß und
Oberstock bei.
Als weiteres, herauszuhebendes Beispiel ist der
Fachwerkbau Obertorstraße 18 zu nennen,
Haberstraße 12, von 1572
159