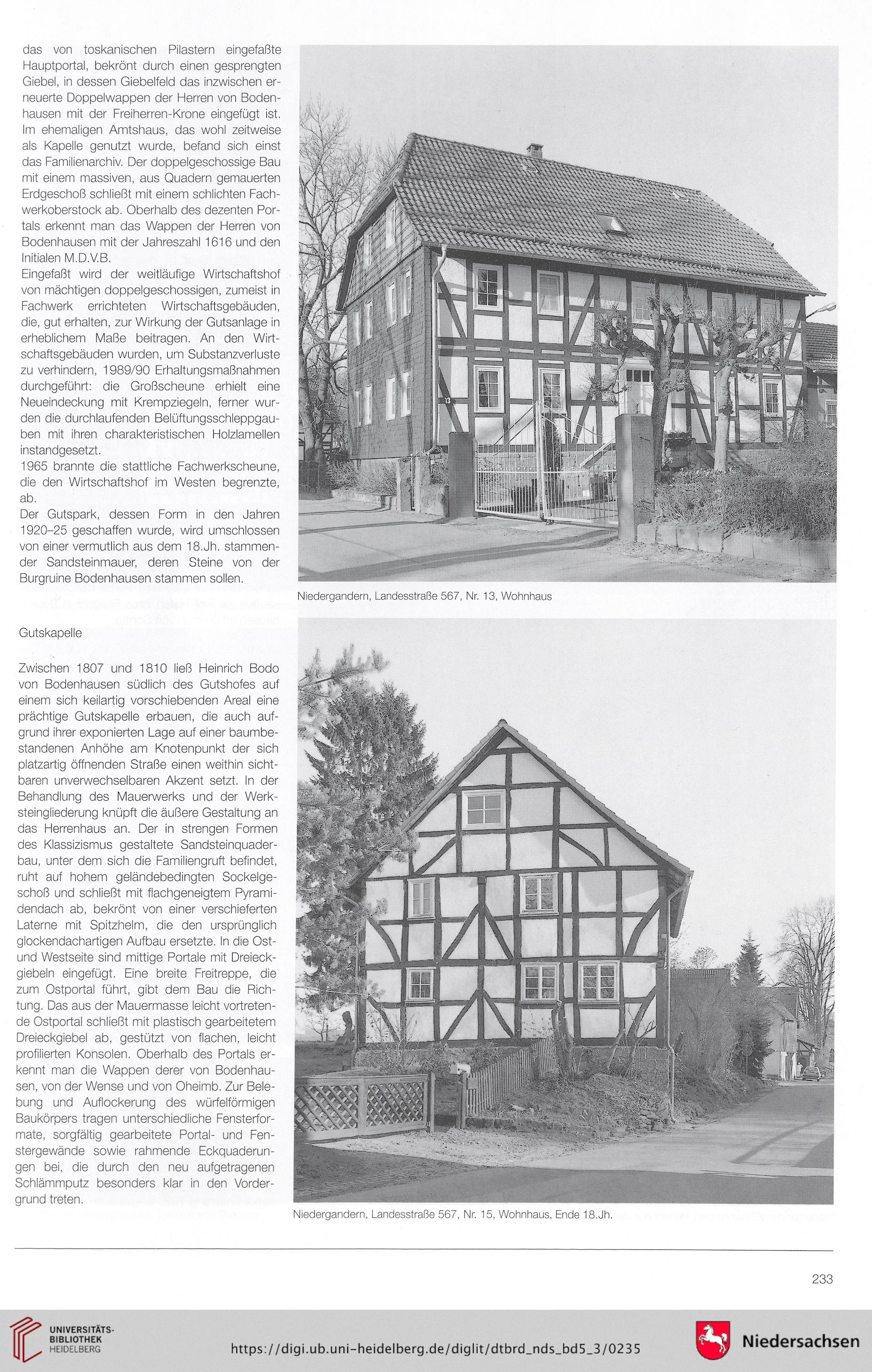das von toskanischen Pilastern eingefaßte
Hauptportal, bekrönt durch einen gesprengten
Giebel, in dessen Giebelfeld das inzwischen er-
neuerte Doppelwappen der Herren von Boden-
hausen mit der Freiherren-Krone eingefügt ist.
Im ehemaligen Amtshaus, das wohl zeitweise
als Kapelle genutzt wurde, befand sich einst
das Familienarchiv. Der doppelgeschossige Bau
mit einem massiven, aus Quadern gemauerten
Erdgeschoß schließt mit einem schlichten Fach-
werkoberstock ab. Oberhalb des dezenten Por-
tals erkennt man das Wappen der Herren von
Bodenhausen mit der Jahreszahl 1616 und den
Initialen M.D.V.B.
Eingefaßt wird der weitläufige Wirtschaftshof
von mächtigen doppelgeschossigen, zumeist in
Fachwerk errichteten Wirtschaftsgebäuden,
die, gut erhalten, zur Wirkung der Gutsanlage in
erheblichem Maße beitragen. An den Wirt-
schaftsgebäuden wurden, um Substanzverluste
zu verhindern, 1989/90 Erhaltungsmaßnahmen
durchgeführt: die Großscheune erhielt eine
Neueindeckung mit Krempziegeln, ferner wur-
den die durchlaufenden Belüftungsschleppgau-
ben mit ihren charakteristischen Holzlamellen
instandgesetzt.
1965 brannte die stattliche Fachwerkscheune,
die den Wirtschaftshof im Westen begrenzte,
ab.
Der Gutspark, dessen Form in den Jahren
1920-25 geschaffen wurde, wird umschlossen
von einer vermutlich aus dem 18.Jh. stammen-
der Sandsteinmauer, deren Steine von der
Burgruine Bodenhausen stammen sollen.
Gutskapelle
Zwischen 1807 und 1810 ließ Heinrich Bodo
von Bodenhausen südlich des Gutshofes auf
einem sich keilartig vorschiebenden Areal eine
prächtige Gutskapelle erbauen, die auch auf-
grund ihrer exponierten Lage auf einer baumbe-
standenen Anhöhe am Knotenpunkt der sich
platzartig öffnenden Straße einen weithin sicht-
baren unverwechselbaren Akzent setzt. In der
Behandlung des Mauerwerks und der Werk-
steingliederung knüpft die äußere Gestaltung an
das Herrenhaus an. Der in strengen Formen
des Klassizismus gestaltete Sandsteinquader-
bau, unter dem sich die Familiengruft befindet,
ruht auf hohem geländebedingten Sockelge-
schoß und schließt mit flachgeneigtem Pyrami-
dendach ab, bekrönt von einer verschieferten
Laterne mit Spitzhelm, die den ursprünglich
glockendachartigen Aufbau ersetzte. In die Ost-
und Westseite sind mittige Portale mit Dreieck-
giebeln eingefügt. Eine breite Freitreppe, die
zum Ostportal führt, gibt dem Bau die Rich-
tung. Das aus der Mauermasse leicht vortreten-
de Ostportal schließt mit plastisch gearbeitetem
Dreieckgiebel ab, gestützt von flachen, leicht
profilierten Konsolen. Oberhalb des Portals er-
kennt man die Wappen derer von Bodenhau-
sen, von der Wense und von Oheimb. Zur Bele-
bung und Auflockerung des würfelförmigen
Baukörpers tragen unterschiedliche Fensterfor-
mate, sorgfältig gearbeitete Portal- und Fen-
stergewände sowie rahmende Eckquaderun-
gen bei, die durch den neu aufgetragenen
Schlämmputz besonders klar in den Vorder-
grund treten.
Niedergandern, Landesstraße 567, Nr. 15, Wohnhaus, Ende 18.Jh.
233
Hauptportal, bekrönt durch einen gesprengten
Giebel, in dessen Giebelfeld das inzwischen er-
neuerte Doppelwappen der Herren von Boden-
hausen mit der Freiherren-Krone eingefügt ist.
Im ehemaligen Amtshaus, das wohl zeitweise
als Kapelle genutzt wurde, befand sich einst
das Familienarchiv. Der doppelgeschossige Bau
mit einem massiven, aus Quadern gemauerten
Erdgeschoß schließt mit einem schlichten Fach-
werkoberstock ab. Oberhalb des dezenten Por-
tals erkennt man das Wappen der Herren von
Bodenhausen mit der Jahreszahl 1616 und den
Initialen M.D.V.B.
Eingefaßt wird der weitläufige Wirtschaftshof
von mächtigen doppelgeschossigen, zumeist in
Fachwerk errichteten Wirtschaftsgebäuden,
die, gut erhalten, zur Wirkung der Gutsanlage in
erheblichem Maße beitragen. An den Wirt-
schaftsgebäuden wurden, um Substanzverluste
zu verhindern, 1989/90 Erhaltungsmaßnahmen
durchgeführt: die Großscheune erhielt eine
Neueindeckung mit Krempziegeln, ferner wur-
den die durchlaufenden Belüftungsschleppgau-
ben mit ihren charakteristischen Holzlamellen
instandgesetzt.
1965 brannte die stattliche Fachwerkscheune,
die den Wirtschaftshof im Westen begrenzte,
ab.
Der Gutspark, dessen Form in den Jahren
1920-25 geschaffen wurde, wird umschlossen
von einer vermutlich aus dem 18.Jh. stammen-
der Sandsteinmauer, deren Steine von der
Burgruine Bodenhausen stammen sollen.
Gutskapelle
Zwischen 1807 und 1810 ließ Heinrich Bodo
von Bodenhausen südlich des Gutshofes auf
einem sich keilartig vorschiebenden Areal eine
prächtige Gutskapelle erbauen, die auch auf-
grund ihrer exponierten Lage auf einer baumbe-
standenen Anhöhe am Knotenpunkt der sich
platzartig öffnenden Straße einen weithin sicht-
baren unverwechselbaren Akzent setzt. In der
Behandlung des Mauerwerks und der Werk-
steingliederung knüpft die äußere Gestaltung an
das Herrenhaus an. Der in strengen Formen
des Klassizismus gestaltete Sandsteinquader-
bau, unter dem sich die Familiengruft befindet,
ruht auf hohem geländebedingten Sockelge-
schoß und schließt mit flachgeneigtem Pyrami-
dendach ab, bekrönt von einer verschieferten
Laterne mit Spitzhelm, die den ursprünglich
glockendachartigen Aufbau ersetzte. In die Ost-
und Westseite sind mittige Portale mit Dreieck-
giebeln eingefügt. Eine breite Freitreppe, die
zum Ostportal führt, gibt dem Bau die Rich-
tung. Das aus der Mauermasse leicht vortreten-
de Ostportal schließt mit plastisch gearbeitetem
Dreieckgiebel ab, gestützt von flachen, leicht
profilierten Konsolen. Oberhalb des Portals er-
kennt man die Wappen derer von Bodenhau-
sen, von der Wense und von Oheimb. Zur Bele-
bung und Auflockerung des würfelförmigen
Baukörpers tragen unterschiedliche Fensterfor-
mate, sorgfältig gearbeitete Portal- und Fen-
stergewände sowie rahmende Eckquaderun-
gen bei, die durch den neu aufgetragenen
Schlämmputz besonders klar in den Vorder-
grund treten.
Niedergandern, Landesstraße 567, Nr. 15, Wohnhaus, Ende 18.Jh.
233