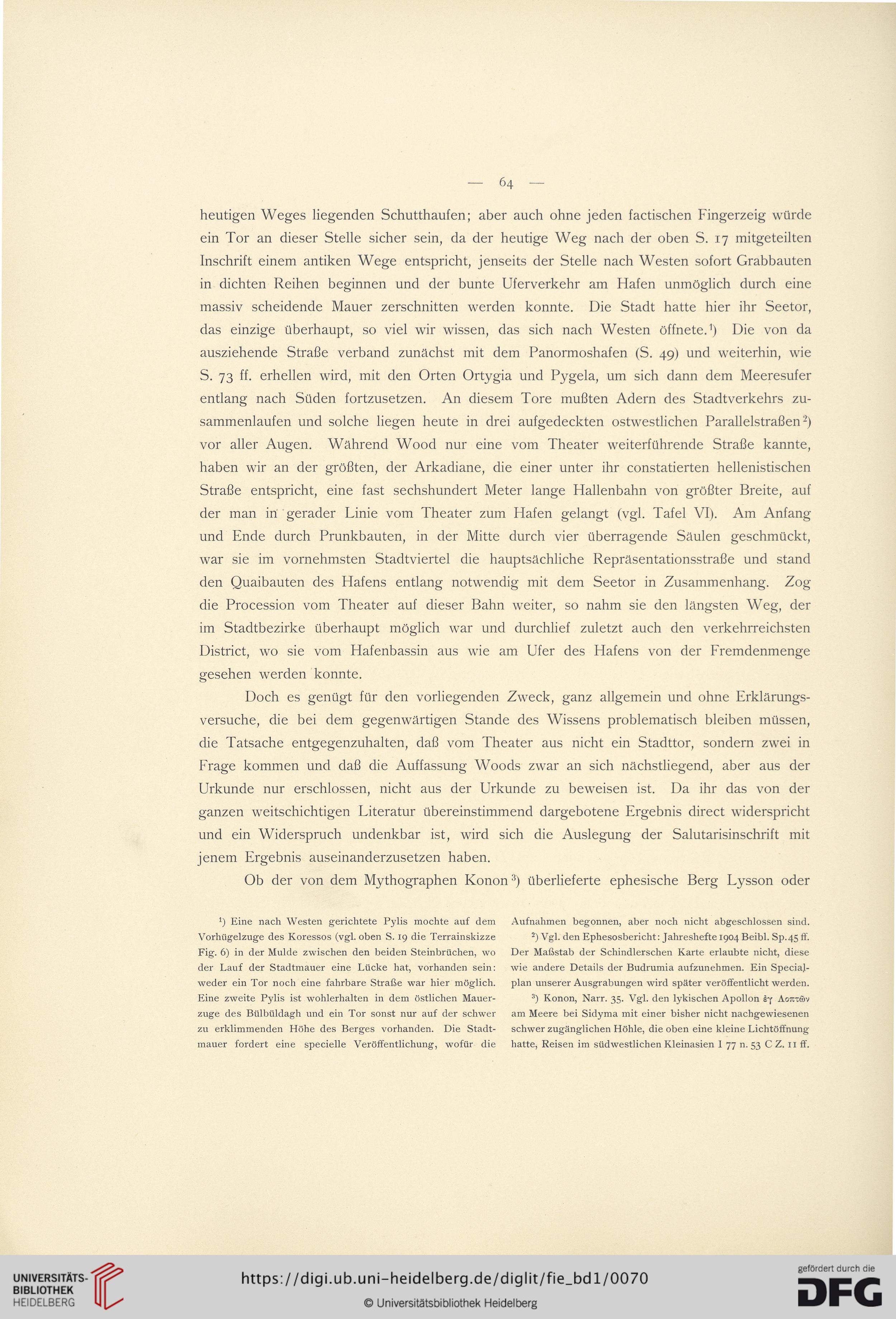64
heutigen Weges liegenden Schutthaufen; aber auch ohne jeden factischen Fingerzeig würde
ein Tor an dieser Stelle sicher sein, da der heutige Weg nach der oben S. 17 mitgeteilten
Inschrift einem antiken Wege entspricht, jenseits der Stelle nach Westen sofort Grabbauten
in dichten Reihen beginnen und der bunte Uferverkehr am Hafen unmöglich durch eine
massiv scheidende Mauer zerschnitten werden konnte. Die Stadt hatte hier ihr Seetor,
das einzige überhaupt, so viel wir wissen, das sich nach Westen öffnete.1) Die von da
ausziehende Straße verband zunächst mit dem Panormoshafen (S. 49) und weiterhin, wie
S. 73 ff. erhellen wird, mit den Orten Ortygia und Pygela, um sich dann dem Meeresufer
entlang nach Süden fortzusetzen. An diesem Tore mußten Adern des Stadtverkehrs zu-
sammenlaufen und solche liegen heute in drei aufgedeckten ostwestlichen Parallelstraßen2)
vor aller Augen. Während Wood nur eine vom Theater weiterführende Straße kannte,
haben wir an der größten, der Arkadiane, die einer unter ihr constatierten hellenistischen
Straße entspricht, eine fast sechshundert Meter lange Hallenbahn von größter Breite, auf
der man in gerader Linie vom Theater zum Hafen gelangt (vgl. Tafel VI). Am Anfang
und Ende durch Prunkbauten, in der Mitte durch vier überragende Säulen geschmückt,
war sie im vornehmsten Stadtviertel die hauptsächliche Repräsentationsstraße und stand
den Quaibauten des Hafens entlang notwendig mit dem Seetor in Zusammenhang. Zog
die Procession vom Theater auf dieser Bahn weiter, so nahm sie den längsten Weg, der
im Stadtbezirke überhaupt möglich war und durchlief zuletzt auch den verkehrreichsten
District, wo sie vom Hafenbassin aus wie am Ufer des Hafens von der Fremdenmenge
gesehen werden konnte.
Doch es genügt für den vorliegenden Zweck, ganz allgemein und ohne Erklärungs-
versuche, die bei dem gegenwärtigen Stande des Wissens problematisch bleiben müssen,
die Tatsache entgegenzuhalten, daß vom Theater aus nicht ein Stadttor, sondern zwei in
Frage kommen und daß die Auffassung Woods zwar an sich nächstliegend, aber aus der
Urkunde nur erschlossen, nicht aus der Urkunde zu beweisen ist. Da ihr das von der
ganzen weitschichtigen Literatur übereinstimmend dargebotene Ergebnis direct widerspricht
und ein Widerspruch undenkbar ist, wird sich die Auslegung der Salutarisinschrift mit
jenem Ergebnis auseinanderzusetzen haben.
Ob der von dem Mythographen Konon3) überlieferte ephesische Berg Lysson oder
1) Eine nach Westen gerichtete Pylis mochte auf dem
Ä^orhtigelzuge des Koressos (vgl. oben S. 19 die Terrainskizze
Fig. 6) in der Mulde zwischen den beiden Steinbrüchen, wo
der Lauf der Stadtmauer eine Lücke hat, vorhanden sein:
weder ein Tor noch eine fahrbare Straße war hier möglich.
Eine zweite Pylis ist wohlerhalten in dem östlichen Mauer-
zuge des Bülbtildagh und ein Tor sonst nur auf der schwer
zu erklimmenden Höhe des Berges vorhanden. Die Stadt-
mauer fordert eine specielle Veröffentlichung, wofür die
Aufnahmen begonnen, aber noch nicht abgeschlossen sind.
2) Vgl. den Ephesosbericht: Jahreshefte 1904 Beibl. Sp.45 ff.
Der Maßstab der Schindlerschen Karte erlaubte nicht, diese
wie andere Details der Budrumia aufzunehmen. Ein Special-
plan unserer Ausgrabungen wird später veröffentlicht werden.
3) Konon, Narr. 35. Vgl. den lykischen Apollon έγ Αοπτών
am Meere bei Sidyma mit einer bisher nicht nachgewiesenen
schwer zugänglichen Höhle, die oben eine kleine Lichtöffnung
hatte, Reisen im südwestlichen Kleinasien I 77 n. 53 C Z. 11 ff.
heutigen Weges liegenden Schutthaufen; aber auch ohne jeden factischen Fingerzeig würde
ein Tor an dieser Stelle sicher sein, da der heutige Weg nach der oben S. 17 mitgeteilten
Inschrift einem antiken Wege entspricht, jenseits der Stelle nach Westen sofort Grabbauten
in dichten Reihen beginnen und der bunte Uferverkehr am Hafen unmöglich durch eine
massiv scheidende Mauer zerschnitten werden konnte. Die Stadt hatte hier ihr Seetor,
das einzige überhaupt, so viel wir wissen, das sich nach Westen öffnete.1) Die von da
ausziehende Straße verband zunächst mit dem Panormoshafen (S. 49) und weiterhin, wie
S. 73 ff. erhellen wird, mit den Orten Ortygia und Pygela, um sich dann dem Meeresufer
entlang nach Süden fortzusetzen. An diesem Tore mußten Adern des Stadtverkehrs zu-
sammenlaufen und solche liegen heute in drei aufgedeckten ostwestlichen Parallelstraßen2)
vor aller Augen. Während Wood nur eine vom Theater weiterführende Straße kannte,
haben wir an der größten, der Arkadiane, die einer unter ihr constatierten hellenistischen
Straße entspricht, eine fast sechshundert Meter lange Hallenbahn von größter Breite, auf
der man in gerader Linie vom Theater zum Hafen gelangt (vgl. Tafel VI). Am Anfang
und Ende durch Prunkbauten, in der Mitte durch vier überragende Säulen geschmückt,
war sie im vornehmsten Stadtviertel die hauptsächliche Repräsentationsstraße und stand
den Quaibauten des Hafens entlang notwendig mit dem Seetor in Zusammenhang. Zog
die Procession vom Theater auf dieser Bahn weiter, so nahm sie den längsten Weg, der
im Stadtbezirke überhaupt möglich war und durchlief zuletzt auch den verkehrreichsten
District, wo sie vom Hafenbassin aus wie am Ufer des Hafens von der Fremdenmenge
gesehen werden konnte.
Doch es genügt für den vorliegenden Zweck, ganz allgemein und ohne Erklärungs-
versuche, die bei dem gegenwärtigen Stande des Wissens problematisch bleiben müssen,
die Tatsache entgegenzuhalten, daß vom Theater aus nicht ein Stadttor, sondern zwei in
Frage kommen und daß die Auffassung Woods zwar an sich nächstliegend, aber aus der
Urkunde nur erschlossen, nicht aus der Urkunde zu beweisen ist. Da ihr das von der
ganzen weitschichtigen Literatur übereinstimmend dargebotene Ergebnis direct widerspricht
und ein Widerspruch undenkbar ist, wird sich die Auslegung der Salutarisinschrift mit
jenem Ergebnis auseinanderzusetzen haben.
Ob der von dem Mythographen Konon3) überlieferte ephesische Berg Lysson oder
1) Eine nach Westen gerichtete Pylis mochte auf dem
Ä^orhtigelzuge des Koressos (vgl. oben S. 19 die Terrainskizze
Fig. 6) in der Mulde zwischen den beiden Steinbrüchen, wo
der Lauf der Stadtmauer eine Lücke hat, vorhanden sein:
weder ein Tor noch eine fahrbare Straße war hier möglich.
Eine zweite Pylis ist wohlerhalten in dem östlichen Mauer-
zuge des Bülbtildagh und ein Tor sonst nur auf der schwer
zu erklimmenden Höhe des Berges vorhanden. Die Stadt-
mauer fordert eine specielle Veröffentlichung, wofür die
Aufnahmen begonnen, aber noch nicht abgeschlossen sind.
2) Vgl. den Ephesosbericht: Jahreshefte 1904 Beibl. Sp.45 ff.
Der Maßstab der Schindlerschen Karte erlaubte nicht, diese
wie andere Details der Budrumia aufzunehmen. Ein Special-
plan unserer Ausgrabungen wird später veröffentlicht werden.
3) Konon, Narr. 35. Vgl. den lykischen Apollon έγ Αοπτών
am Meere bei Sidyma mit einer bisher nicht nachgewiesenen
schwer zugänglichen Höhle, die oben eine kleine Lichtöffnung
hatte, Reisen im südwestlichen Kleinasien I 77 n. 53 C Z. 11 ff.