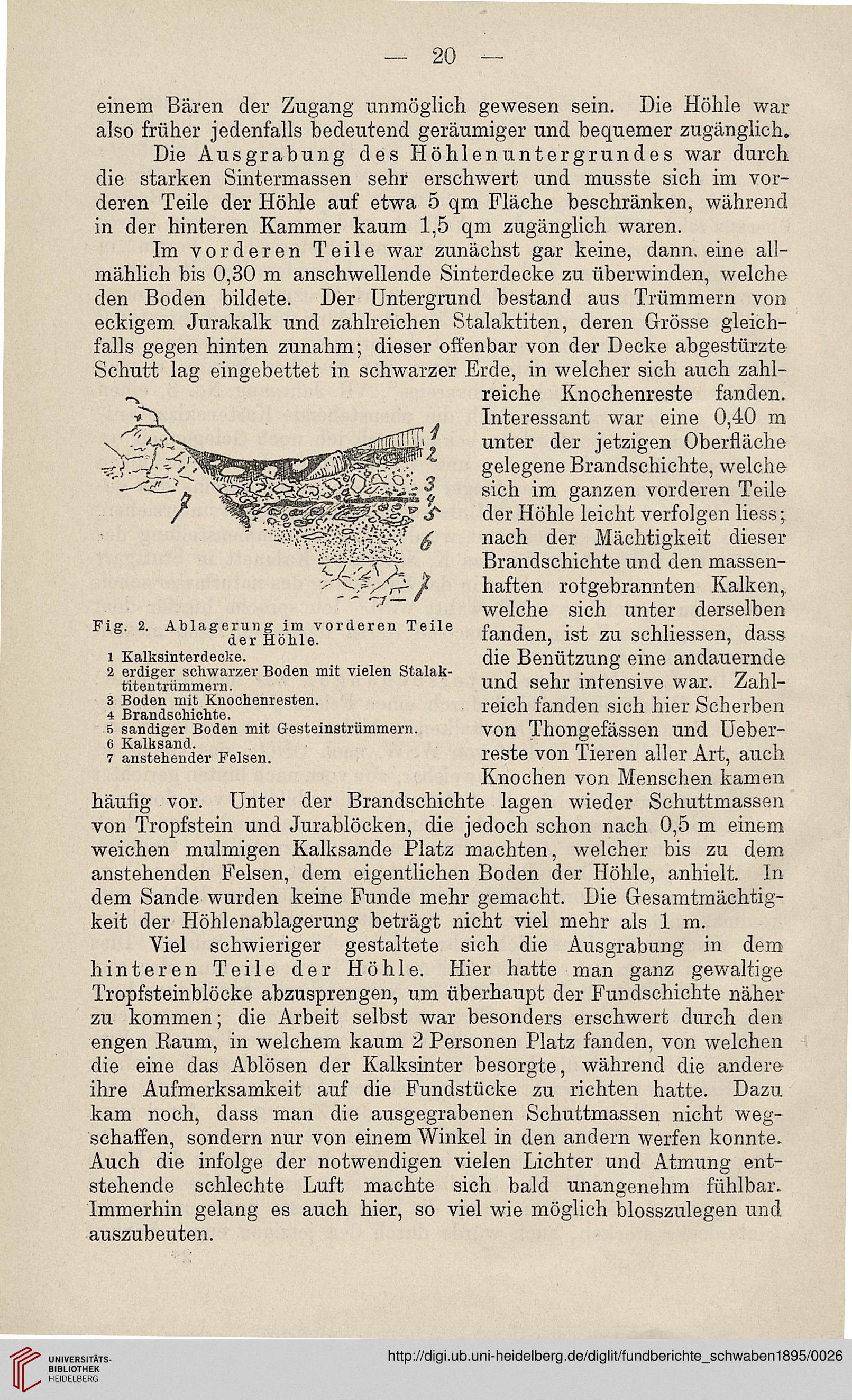20
einem Bären der Zugang unmöglich gewesen sein. Die Höhle war
also früher jedenfalls bedeutend geräumiger und bequemer zugänglich.
Die Ausgrabung des Höhlenuntergrundes war durch
die starken Sintermassen sehr erschwert und musste sich im vor-
deren Teile der Höhle auf etwa 5 qm Fläche beschränken, während
in der hinteren Kammer kaum 1,5 qm zugänglich waren.
Im vorderen Teile war zunächst gar keine, dann, eine all-
mählich bis 0,30 m anschwellende Sinterdecke zu überwinden, welche
den Boden bildete. Der Untergrund bestand aus Trümmern von
eckigem Jurakalk und zahlreichen Stalaktiten, deren Grösse gleich-
falls gegen hinten zunahm; dieser offenbar von der Decke abgestürzte
Schutt lag eingebettet in schwarzer Erde, in welcher sich auch zahl-
reiche Knochenreste fanden.
Interessant war eine 0,40 m
unter der jetzigen Oberfläche
gelegene Brandschichte, welche
sich im ganzen vorderen Teile
der Höhle leicht verfolgen liess;
nach der Mächtigkeit dieser
Brandschichte und den massen-
haften rotgebrannten Kalken,
welche sich unter derselben
fanden, ist zu schliessen, dass
die Benützung eine andauernde
und sehr intensive war. Zahl-
reich fanden sich hier Scherben
von Thongefässen und Ueber-
reste von Tieren aller Art, auch
Knochen von Menschen kamen
häufig vor. Unter der Brandschichte lagen wieder Schuttmassen
von Tropfstein und Jurablöcken, die jedoch schon nach 0,5 m einem
weichen mulmigen Kalksande Platz machten, welcher bis zu dem
anstehenden Felsen, dem eigentlichen Boden der Höhle, anhielt. In
dem Sande wurden keine Funde mehr gemacht. Die Gesamtmächtig-
keit der Höhlenablagerung beträgt nicht viel mehr als 1 m.
Viel schwieriger gestaltete sich die Ausgrabung in dem
hinteren Teile der Höhle. Hier hatte man ganz gewaltige
Tropfsteinblöcke abzusprengen, um überhaupt der Fundschichte näher
zu kommen; die Arbeit selbst war besonders erschwert durch den
engen Baum, in welchem kaum 2 Personen Platz fanden, von welchen
die eine das Ablösen der Kalksinter besorgte, während die andere
ihre Aufmerksamkeit auf die Fundstücke zu richten hatte. Dazu
kam noch, dass man die ausgegrabenen Schuttmassen nicht weg-
schaffen, sondern nur von einem Winkel in den andern werfen konnte.
Auch die infolge der notwendigen vielen Lichter und Atmung ent-
stehende schlechte Luft machte sich bald unangenehm fühlbar.
Immerhin gelang es auch hier, so viel wie möglich blosszulegen und
auszubeuten.
1 Kalksinterdecke.
2 erdiger schwarzer Boden mit vielen Stalak-
titentrümmern .
3 Boden mit Knochenresten.
4 Brandschichte.
5 sandiger Boden mit G-esteinstrümmern.
6 Kalksand.
7 anstehender Felsen.
einem Bären der Zugang unmöglich gewesen sein. Die Höhle war
also früher jedenfalls bedeutend geräumiger und bequemer zugänglich.
Die Ausgrabung des Höhlenuntergrundes war durch
die starken Sintermassen sehr erschwert und musste sich im vor-
deren Teile der Höhle auf etwa 5 qm Fläche beschränken, während
in der hinteren Kammer kaum 1,5 qm zugänglich waren.
Im vorderen Teile war zunächst gar keine, dann, eine all-
mählich bis 0,30 m anschwellende Sinterdecke zu überwinden, welche
den Boden bildete. Der Untergrund bestand aus Trümmern von
eckigem Jurakalk und zahlreichen Stalaktiten, deren Grösse gleich-
falls gegen hinten zunahm; dieser offenbar von der Decke abgestürzte
Schutt lag eingebettet in schwarzer Erde, in welcher sich auch zahl-
reiche Knochenreste fanden.
Interessant war eine 0,40 m
unter der jetzigen Oberfläche
gelegene Brandschichte, welche
sich im ganzen vorderen Teile
der Höhle leicht verfolgen liess;
nach der Mächtigkeit dieser
Brandschichte und den massen-
haften rotgebrannten Kalken,
welche sich unter derselben
fanden, ist zu schliessen, dass
die Benützung eine andauernde
und sehr intensive war. Zahl-
reich fanden sich hier Scherben
von Thongefässen und Ueber-
reste von Tieren aller Art, auch
Knochen von Menschen kamen
häufig vor. Unter der Brandschichte lagen wieder Schuttmassen
von Tropfstein und Jurablöcken, die jedoch schon nach 0,5 m einem
weichen mulmigen Kalksande Platz machten, welcher bis zu dem
anstehenden Felsen, dem eigentlichen Boden der Höhle, anhielt. In
dem Sande wurden keine Funde mehr gemacht. Die Gesamtmächtig-
keit der Höhlenablagerung beträgt nicht viel mehr als 1 m.
Viel schwieriger gestaltete sich die Ausgrabung in dem
hinteren Teile der Höhle. Hier hatte man ganz gewaltige
Tropfsteinblöcke abzusprengen, um überhaupt der Fundschichte näher
zu kommen; die Arbeit selbst war besonders erschwert durch den
engen Baum, in welchem kaum 2 Personen Platz fanden, von welchen
die eine das Ablösen der Kalksinter besorgte, während die andere
ihre Aufmerksamkeit auf die Fundstücke zu richten hatte. Dazu
kam noch, dass man die ausgegrabenen Schuttmassen nicht weg-
schaffen, sondern nur von einem Winkel in den andern werfen konnte.
Auch die infolge der notwendigen vielen Lichter und Atmung ent-
stehende schlechte Luft machte sich bald unangenehm fühlbar.
Immerhin gelang es auch hier, so viel wie möglich blosszulegen und
auszubeuten.
1 Kalksinterdecke.
2 erdiger schwarzer Boden mit vielen Stalak-
titentrümmern .
3 Boden mit Knochenresten.
4 Brandschichte.
5 sandiger Boden mit G-esteinstrümmern.
6 Kalksand.
7 anstehender Felsen.