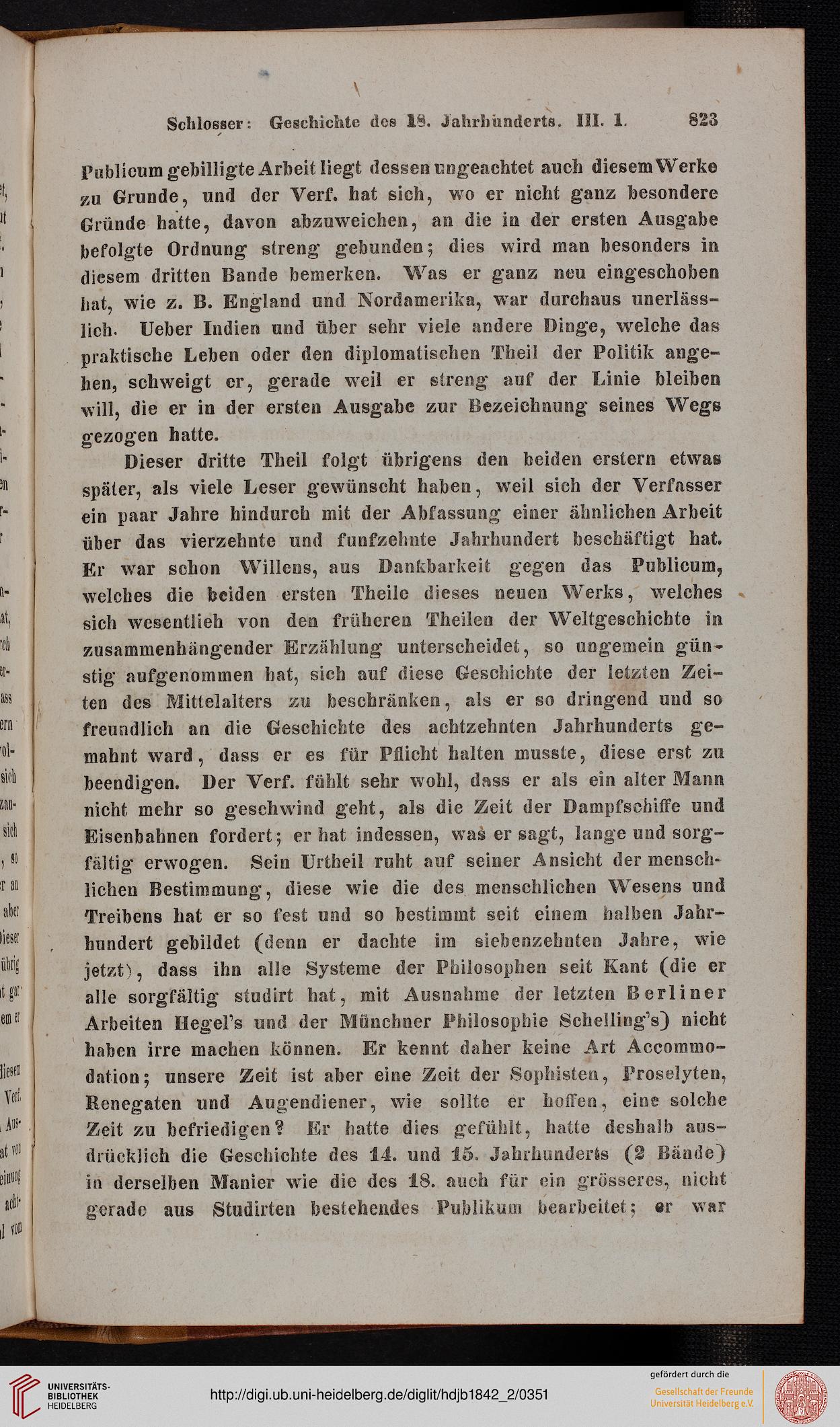Schlosser*. Geschichte des 18. Jahrhunderts. III. 1.
823
Publicum gebilligte Arbeit liegt dessenungeachtet auch diesem Werke
7M Grunde, und der Verf. hat sich, wo er nicht ganz besondere
Gründe hatte, davon abzuweichen, an die in der ersten Ausgabe
befolgte Ordnung streng gebunden; dies wird man besonders in
diesem dritten Bande bemerken. Was er ganz neu eingeschoben
hat, wie z. B. England und Nordamerika, war durchaus unerläss-
lich. Ueber Indien und über sehr viele andere Dinge, welche das
praktische Leben oder den diplomatischen Theil der Politik ange-
hen, schweigt er, gerade weil er streng auf der Linie bleiben
will, die er in der ersten Ausgabe zur Bezeichnung seines Wegs
gezogen hatte.
Dieser dritte Theil folgt übrigens den beiden erstem etwas
später, als viele Leser gewünscht haben, weil sich der Verfasser
ein paar Jahre hindurch mit der Abfassung einer ähnlichen Arbeit
über das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert beschäftigt hat
Er war schon Willens, aus Dankbarkeit gegen das Publicum,
welches die beiden ersten Theile dieses neuen Werks, welches
sich wesentlich von den früheren Theileo der Weltgeschichte in
zusammenhängender Erzählung unterscheidet, so ungemein gün-
stig aufgenommen hat, sich auf diese Geschichte der letzten Zei-
ten des Mittelalters zu beschränken, als er so dringend und so
freundlich an die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts ge-
mahnt ward, dass er es für Pflicht halten musste, diese erst zu
beendigen. Der Verf. fühlt sehr wohl, dass er als ein alter Mann
nicht mehr so geschwind geht, als die Zeit der Dampfschiffe und
Eisenbahnen fordert; er hat indessen, wTass er sagt, lange und sorg-
fältig erwogen. Sein Urtheil ruht auf seiner Ansicht der mensch-
lichen Bestimmung, diese wie die des menschlichen Wesens und
Treibens hat er so fest und so bestimmt seit einem halben Jahr-
hundert gebildet (denn er dachte im siebenzehnten Jahre, wie
jetzt), dass ihn alle Systeme der Philosophen seit Kant (die er
alle sorgfältig studirt hat, mit Ausnahme der letzten Berliner
Arbeiten Ilegel’s und der Münchner Philosophie Schelling’s) nicht
haben irre machen können. Er kennt daher keine Art Accoramo-
dation; unsere Zeit ist aber eine Zeit der Sophisten, Proselyten,
Renegaten und Augendiener, wie sollte er hoffen, eine solche
Zeit zu befriedigen? Er hatte dies gefühlt, hatte deshalb aus-
drücklich die Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderis (2 Bände)
in derselben Manier wie die des 18. auch für ein grösseres, nicht
gerade aus Studirten bestehendes Publikum bearbeitet; er war
823
Publicum gebilligte Arbeit liegt dessenungeachtet auch diesem Werke
7M Grunde, und der Verf. hat sich, wo er nicht ganz besondere
Gründe hatte, davon abzuweichen, an die in der ersten Ausgabe
befolgte Ordnung streng gebunden; dies wird man besonders in
diesem dritten Bande bemerken. Was er ganz neu eingeschoben
hat, wie z. B. England und Nordamerika, war durchaus unerläss-
lich. Ueber Indien und über sehr viele andere Dinge, welche das
praktische Leben oder den diplomatischen Theil der Politik ange-
hen, schweigt er, gerade weil er streng auf der Linie bleiben
will, die er in der ersten Ausgabe zur Bezeichnung seines Wegs
gezogen hatte.
Dieser dritte Theil folgt übrigens den beiden erstem etwas
später, als viele Leser gewünscht haben, weil sich der Verfasser
ein paar Jahre hindurch mit der Abfassung einer ähnlichen Arbeit
über das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert beschäftigt hat
Er war schon Willens, aus Dankbarkeit gegen das Publicum,
welches die beiden ersten Theile dieses neuen Werks, welches
sich wesentlich von den früheren Theileo der Weltgeschichte in
zusammenhängender Erzählung unterscheidet, so ungemein gün-
stig aufgenommen hat, sich auf diese Geschichte der letzten Zei-
ten des Mittelalters zu beschränken, als er so dringend und so
freundlich an die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts ge-
mahnt ward, dass er es für Pflicht halten musste, diese erst zu
beendigen. Der Verf. fühlt sehr wohl, dass er als ein alter Mann
nicht mehr so geschwind geht, als die Zeit der Dampfschiffe und
Eisenbahnen fordert; er hat indessen, wTass er sagt, lange und sorg-
fältig erwogen. Sein Urtheil ruht auf seiner Ansicht der mensch-
lichen Bestimmung, diese wie die des menschlichen Wesens und
Treibens hat er so fest und so bestimmt seit einem halben Jahr-
hundert gebildet (denn er dachte im siebenzehnten Jahre, wie
jetzt), dass ihn alle Systeme der Philosophen seit Kant (die er
alle sorgfältig studirt hat, mit Ausnahme der letzten Berliner
Arbeiten Ilegel’s und der Münchner Philosophie Schelling’s) nicht
haben irre machen können. Er kennt daher keine Art Accoramo-
dation; unsere Zeit ist aber eine Zeit der Sophisten, Proselyten,
Renegaten und Augendiener, wie sollte er hoffen, eine solche
Zeit zu befriedigen? Er hatte dies gefühlt, hatte deshalb aus-
drücklich die Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderis (2 Bände)
in derselben Manier wie die des 18. auch für ein grösseres, nicht
gerade aus Studirten bestehendes Publikum bearbeitet; er war